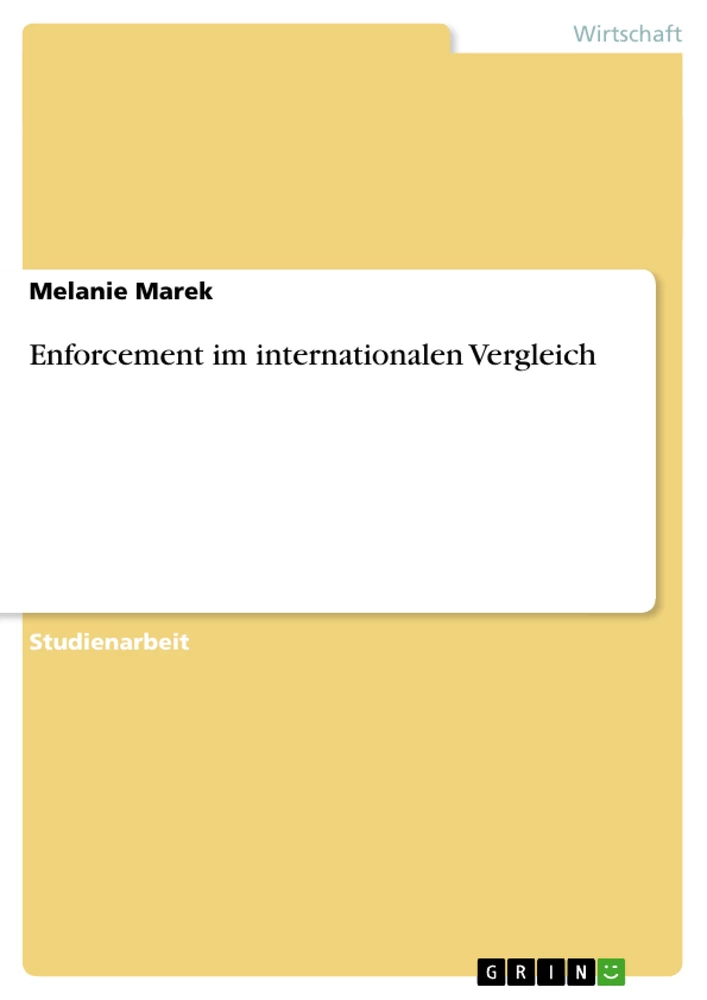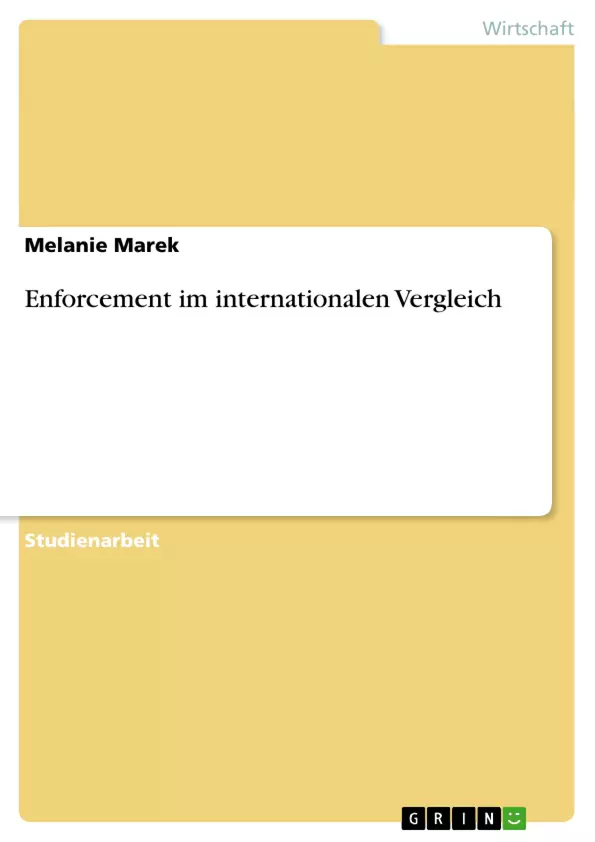Durch die verschiedenen internationalen Bilanzskandale, z.B. Parmalat, haben die Kapitalgeber ihr Vertrauen in die Glaubwürdigkeit von Rechnungslegungsinformationen verloren. Auch der Bankrott bekannter amerikanischer Firmen löste die Vertrauenskrise aus. Die Bilanzskandale resultierten aus der Verschleierung der tatsächlichen wirtschaftlichen Lage des betroffenen Unternehmens. So wurde durch die Ausnutzung bilanzpolitischer Maßnahmen, die unkorrekte Angabe von Unternehmensdaten und einer widerrechtlichen Anwendung von Bilanzierungsregeln die Finanzlage besser dargestellt, als sie in Wirklichkeit war. Um das Vertrauen der Investoren wiederaufzubauen, bedarf es einer Institution, die die Einhaltung der Rechnungslegungsstandards durchsetzt. In den Vereinigten Staaten von Amerika (USA) sowie in Großbritannien (GB) existiert bereits eine solche Enforcementinstanz. So wurde 1990 in GB das Financial Reporting Review Panel (FRRP) in das Leben gerufen und bereits Anfang der dreißiger Jahre in Amerika die Securities and Exchange Commission (SEC) gegründet. Anlässlich der Unternehmenszusammenbrüche wie z.B. von Enron und Worldcom wurde der Durchsetzungsmechanismus der SEC um den Sarbanes-Oxley Act of 2002 (SOA) erweitert. Das Gesetz richtet sich an alle Unternehmen, die an der amerikanischen Börse notiert sind, d.h. auch an deutsche Firmen. Allerdings besteht in Deutschland eine sog. Enforcement-Lücke, das bedeutet es wurde noch keine Durchsetzungsinstitution etabliert. Die Notwendigkeit einer Enforcementinstanz in Deutschland resultiert nicht nur aus der Unterbindung von Bilanzverstößen, sondern auch im Hinblick auf die Vereinheitlichung der Rechnungslegungsnormen innerhalb der Europäischen Union (EU). Ab dem 01.01.2005 müssen alle kapitalmarktorientierten Unternehmen ihre Konzernabschlüsse nach IAS/IFRS aufstellen. Aufgrund dessen ist für die Erhaltung der Konkurrenzfähigkeit ein glaubwürdiges deutsches Enforcement-Modell nötig.
Inhaltsverzeichnis
- Einführung
- Problemstellung
- Aufbau der Arbeit
- Notwendigkeit eines Enforcement-Systems
- Das Prinzipal-Agent-Problem
- Anforderungen an ein wirksames Enforcement
- Übersicht und Vergleich bestehender Enforcement-Modelle
- Großbritannien - Durchsetzung durch eine privatrechtliche Instanz
- Financial Reporting Review Panel - Institutionelle Grundlagen
- Verfahrensablauf und Kontrollpolitik
- Sanktionsmöglichkeiten des FRRP
- Vereinigte Staaten von Amerika - Kontrolle durch eine staatliche Instanz
- Securities and Exchange Commission - Institutionelle Grundlagen
- Verfahrensablauf und Kontrollpolitik
- Sanktionsmöglichkeiten der SEC
- Lösungsvorschlag zur Errichtung einer Enforcementstelle in Deutschland
- Die Modifizierung des derzeitigen Kontrollsystems
- Das Verfahren nach dem Entwurf des Bilanzkontrollgesetzes
- Eine privatrechtliche Kontrollinstanz auf der ersten Stufe
- Eine staatliche Sanktionsinstanz auf der zweiten Stufe
- Großbritannien - Durchsetzung durch eine privatrechtliche Instanz
- Ergebnisse
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Seminararbeit untersucht die Notwendigkeit einer Enforcementstelle in Deutschland im Kontext internationaler Bilanzskandale und der zunehmenden Regulierung der Rechnungslegung im Zuge der Globalisierung. Sie analysiert das Prinzipal-Agent-Problem in der Beziehung zwischen Aktionären und Managern sowie zwischen Aktionären und Wirtschaftsprüfern und leitet daraus die Anforderungen an ein wirksames Enforcement-System ab.
- Analyse des Prinzipal-Agent-Problems in der Rechnungslegung
- Vergleich von Enforcement-Modellen in Großbritannien und den Vereinigten Staaten
- Bewertung des vorgeschlagenen Enforcement-Modells für Deutschland
- Diskussion der Anforderungen an ein effektives Enforcement-System
- Bedeutung der Vereinheitlichung der Rechnungslegungsnormen in der EU
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel stellt die Problematik von Bilanzskandalen und die Notwendigkeit einer Enforcementstelle in Deutschland dar. Es beleuchtet die Folgen der Informationsasymmetrie zwischen Aktionären und Managern sowie zwischen Aktionären und Wirtschaftsprüfern. Das zweite Kapitel beschäftigt sich mit dem Prinzipal-Agent-Problem und den Anforderungen an ein wirksames Enforcement-System. Die Kapitel 3.1 und 3.2 vergleichen die bestehenden Enforcement-Modelle in Großbritannien und den Vereinigten Staaten. Es werden die jeweiligen institutionellen Grundlagen, Verfahrensabläufe, Kontrollpolitik und Sanktionsmöglichkeiten analysiert. Das dritte Kapitel stellt den Lösungsvorschlag zur Errichtung einer Enforcementstelle in Deutschland vor, der die Elemente des britischen und amerikanischen Modells verknüpft.
Schlüsselwörter
Enforcement, Bilanzskandale, Prinzipal-Agent-Problem, Rechnungslegungsstandards, Corporate Governance, Financial Reporting Review Panel (FRRP), Securities and Exchange Commission (SEC), Bilanzkontrollgesetz (BilKoG), IAS/IFRS, Globalisierung, Informationsasymmetrie.
Häufig gestellte Fragen
Was versteht man unter „Enforcement“ in der Rechnungslegung?
Enforcement bezeichnet die Durchsetzung der Einhaltung von Rechnungslegungsstandards (wie IFRS) durch unabhängige Institutionen zur Sicherung der Bilanzqualität.
Warum ist ein Enforcement-System notwendig?
Bilanzskandale wie Enron oder Parmalat haben das Vertrauen der Investoren zerstört; Enforcement soll die Glaubwürdigkeit von Finanzberichten wiederherstellen.
Wie unterscheidet sich das US-Modell vom britischen Modell?
In den USA kontrolliert eine staatliche Instanz (SEC), während in Großbritannien eine privatrechtliche Instanz (FRRP) für die Durchsetzung zuständig ist.
Was ist das Prinzipal-Agent-Problem in der Bilanzierung?
Es beschreibt den Interessenkonflikt zwischen Aktionären (Prinzipale) und Managern (Agenten), der zu Verschleierungen der tatsächlichen wirtschaftlichen Lage führen kann.
Welches Modell wird für Deutschland vorgeschlagen?
Vorgeschlagen wird ein zweistufiges Modell: eine privatrechtliche Instanz auf der ersten Stufe und eine staatliche Sanktionsinstanz auf der zweiten Stufe.
- Quote paper
- Melanie Marek (Author), 2005, Enforcement im internationalen Vergleich, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/43683