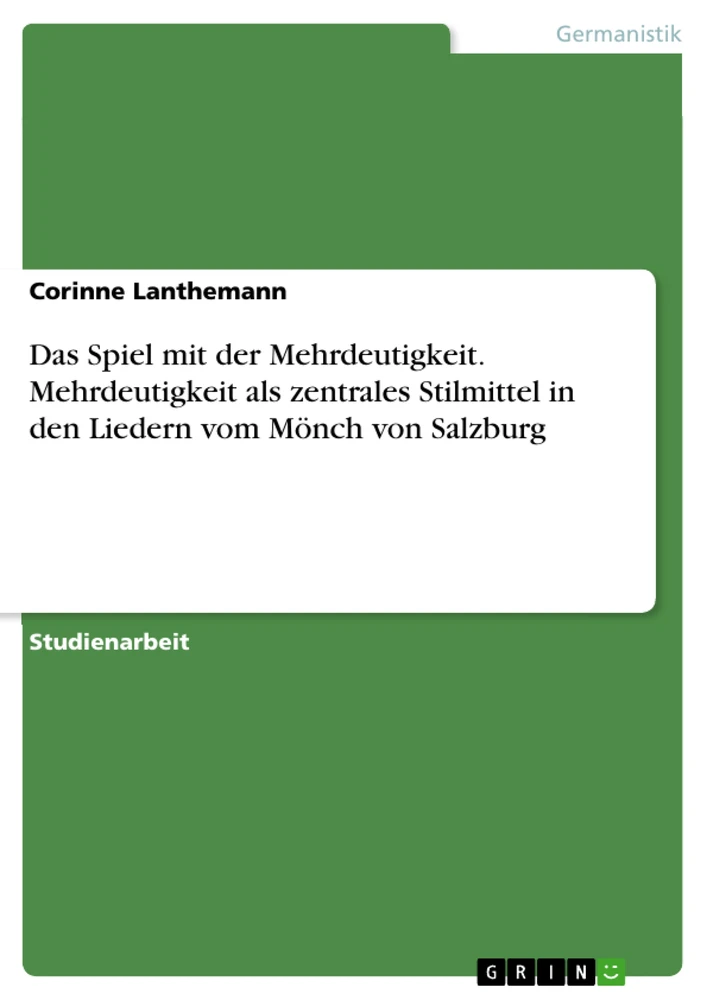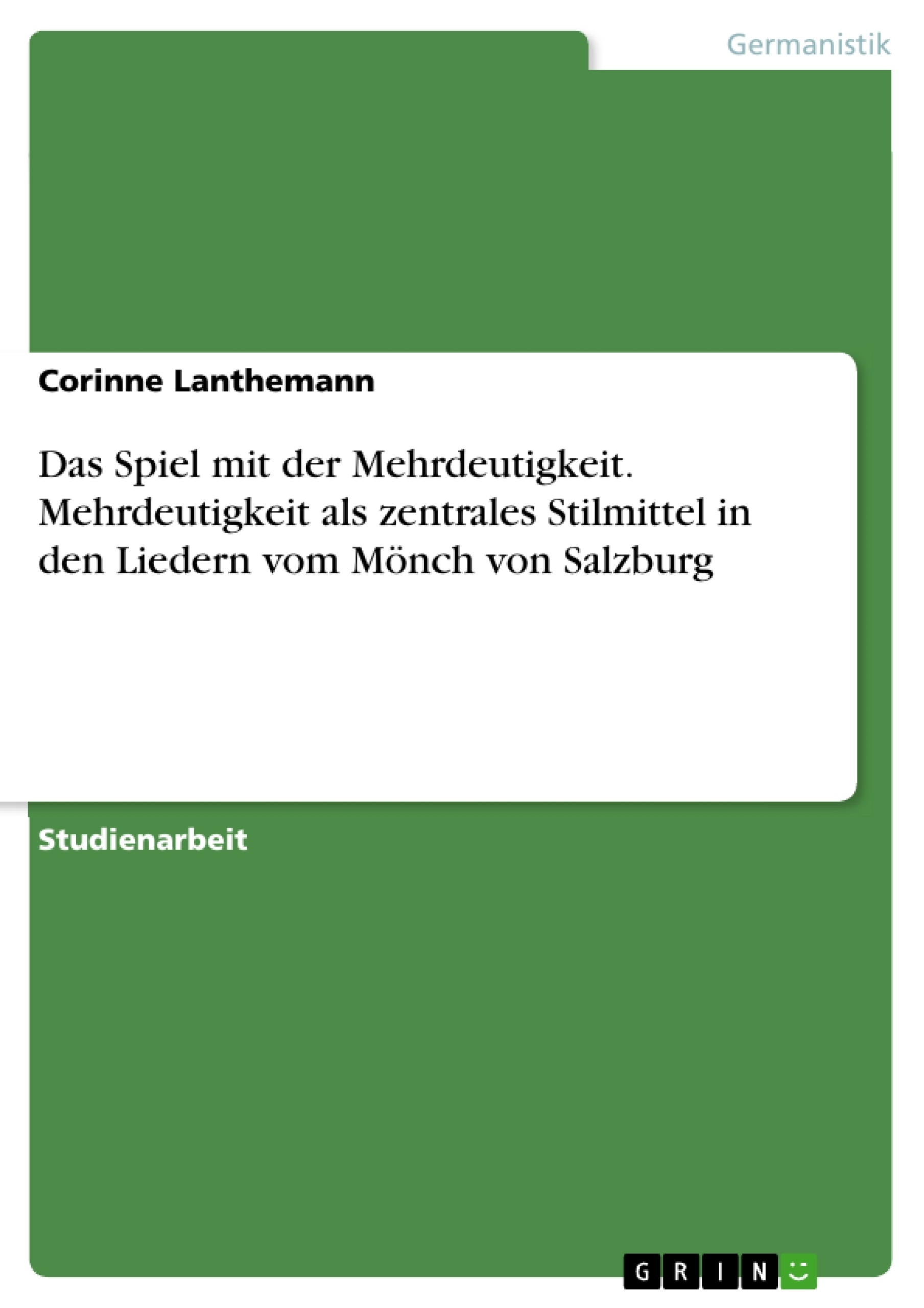Der Mönch von Salzburg gilt als einer der berühmtesten Lyriker des deutschen Spätmittelalters. Sein lyrisches Gesamtwerk besteht aus über einhundert weltlichen und geistlichen Lieddichtungen. Eine Besonderheit des Schreibstils des Mönchs von Salzburg ist das Spiel mit den Gattungen und literarischen Mustern. Er versteht es gekonnt die verschiedenen literarischen Traditionen zu vermischen und sich nicht strikt an Vorgaben zu halten. Viele seiner Texte sind dadurch oft ironisch und auf mehrere Weisen interpretierbar. Der Mönch erzeugt durch doppeldeutige Begriffe und Redewendungen jeweils verschiedene Interpretationsmöglichkeiten, welche er aber durch Widersprüchliches durchbricht. Somit befasst sich die vorliegende Arbeit mit folgender These: Der Mönch von Salzburg benutzt die Mehrdeutigkeit als zentrales Stilmittel seiner Lieder.
Dazu werden in dieser Arbeit zwei Lieder vorgestellt, welche lediglich als Beispiel für das Spiel mit den literarischen Mustern des Mönchs dienen sollen, die aber nicht weiter vertieft werden. Anschliessend wird das Lied Seint Röslein, plüemlein maniger lay auf genau diese Mehrdeutigkeit analysiert. Es wird zuerst auf der inhaltlichen Ebene interpretiert, indem die verschiedenen Bedeutungen der einzelnen Wörter und ihre Wirkung auf das ganze Lied erläutert werden. Somit ergibt sich ein Gesamtbild über den Kontext. In einem zweiten Schritt werden die formalen Elemente des Liedes betrachtet. Dies beinhaltet Informationen über die Stellung des Liedes in den Handschriften und das Reim- sowie das Strophenschema.
Inhaltsverzeichnis
- EINLEITUNG
- DAS MARTINS- UND FALKENLIED
- SEINT RÖSLEIN, PLÜEMLEIN MANIGER LAY
- FAZIT
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit zielt darauf ab, die Verwendung von Mehrdeutigkeit als zentrales Stilmittel in den Liedern des Mönchs von Salzburg aufzuzeigen. Sie analysiert zwei Lieder als Beispiele für sein Spiel mit literarischen Mustern und untersucht anschliessend das Lied "Seint Röslein, plüemlein maniger lay" genauer hinsichtlich seiner Mehrdeutigkeit.
- Analyse der Mehrdeutigkeit im Werk des Mönchs von Salzburg
- Untersuchung der literarischen Muster und Traditionen
- Interpretation der Mehrdeutigkeit in ausgewählten Liedern
- Analyse der formalen Elemente der Lieder
- Zusammenhang zwischen Inhalt und Form
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung
Die Einleitung stellt den Mönch von Salzburg als bedeutenden Lyriker des Spätmittelalters vor und erläutert seine Spielfreude mit Gattungen und literarischen Mustern. Die Arbeit fokussiert auf die Mehrdeutigkeit als zentrales Stilmittel seiner Lieder.
2. Das Martins- und Falkenlied
Dieses Kapitel untersucht die Mehrdeutigkeit am Beispiel des Martinsliedes "Wolauf, lieben gesellen unverzait" und des Falkenliedes "Ich het czu hannt geloket mir". Es analysiert die Bedeutung der Lieder im Kontext von geistlichen und weltlichen Traditionen.
3. Seint röslein, plüemlein maniger lay
Das Kapitel analysiert das Lied "Seint röslein, plüemlein maniger lay" auf der inhaltlichen und formalen Ebene. Es untersucht die Mehrdeutigkeit des Blumenkranzes als Symbol und die verschiedenen Bedeutungen der verwendeten Sprache.
Schlüsselwörter
Mönch von Salzburg, Mehrdeutigkeit, Spiel mit Gattungen, literarische Muster, Martinslied, Falkenlied, "Seint Röslein, plüemlein maniger lay", Symbolismus, Sprachliche Analyse, Mittelalterliche Lyrik.
Häufig gestellte Fragen
Wer war der Mönch von Salzburg?
Der Mönch von Salzburg gilt als einer der bedeutendsten Lyriker des deutschen Spätmittelalters und verfasste über einhundert weltliche und geistliche Lieder.
Was ist das zentrale Stilmittel in den Liedern des Mönchs von Salzburg?
Das zentrale Stilmittel ist die Mehrdeutigkeit. Der Mönch nutzt doppeldeutige Begriffe und vermischt literarische Traditionen, um verschiedene Interpretationsmöglichkeiten zu schaffen.
Welches Lied wird in der Arbeit detailliert analysiert?
Das Lied "Seint Röslein, plüemlein maniger lay" wird sowohl auf inhaltlicher Ebene als auch hinsichtlich seiner formalen Elemente (Reim- und Strophenschema) genau untersucht.
Welche Rolle spielen das Martins- und das Falkenlied in der Untersuchung?
Diese beiden Lieder dienen als Beispiele für das Spiel des Mönchs mit literarischen Mustern und der Vermischung von geistlichen und weltlichen Traditionen.
Warum sind die Texte des Mönchs oft ironisch?
Die Ironie entsteht durch das bewusste Durchbrechen von Erwartungen und das Spiel mit Widersprüchlichkeiten innerhalb der mehrdeutigen Aussagen.
- Quote paper
- Corinne Lanthemann (Author), 2017, Das Spiel mit der Mehrdeutigkeit. Mehrdeutigkeit als zentrales Stilmittel in den Liedern vom Mönch von Salzburg, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/437247