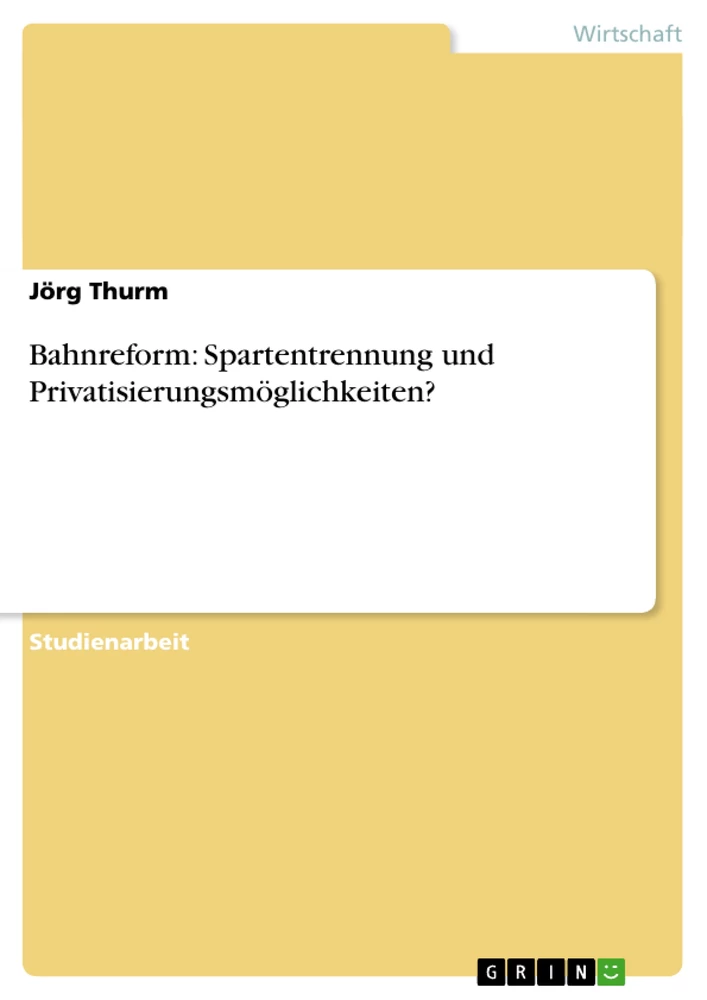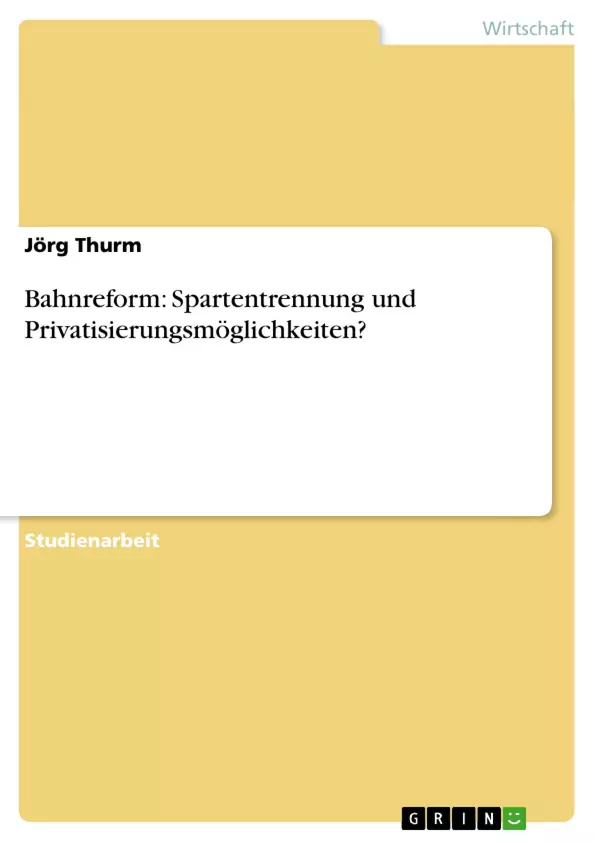1994 wurde mit dem ersten Schritt der Bahnreform der Versuch gestartet, die zu diesem Zeitpunkt in wirtschaftlich desolatem Zustand befindliche Deutsche Bundesbahn (DB) sowie die Deutsche Reichsbahn (DR) gemeinsam in Form der Deutschen Bahn AG (DB AG) neu zu organisieren und zu privatisieren. Hauptziel war eine Verbesserung der allgemeinen Leistungsfähigkeit und damit die Erfüllung ordnungs- verkehrs- umwelt- und finanzpolitischer Ziele. 111 Jahre nach diesem ersten Schritt befindet sich die Bahn nach wie vor zu 100% in staatlichem Besitz, die finanzielle Situation der Bahn AG sowie der Marktanteil der Wettbewerber sind eher unbefriedigend.
Die vorliegende Arbeit befasst sich mit dem Bahnsektor und der Bahnreform und untersucht die Privatisierungsmöglichkeiten bzw. die verbleibende Regulierungsnotwendigkeit. Im Mittelpunkt steht dabei die Frage nach der Bedeutung der Trennung von Infrastruktur- und Verkehrssparte für eine erfolgreiche Privatisierung. Als Bewertungsmaßstab dient das o.g. Hauptziel der Bahnreform sowie im Speziellen die unter 2.1. geschilderte marktwirtschaftliche Maxime.
Kapitel 2 untersucht die ökonomischen Rahmenbedingungen des Bahnsektors und begibt sich dabei auf die Suche nach wirtschaftspolitischen Ausnahmebereichen und Konsequenzen für das Marktgeschehen. Kapitel 3 beschreibt die Maßnahmen der Bahnreform sowie die heutige Situation und formuliert auf Basis der Erkenntnisse aus Kapitel 2 konkrete Folgerungen für die Privatisierung und Deregulierung (im Sinne einer Verringerung von wirtschaftspolitischen Spezialvorschriften für den Bahnsektor). Die Arbeit schließt in Kapitel 4 mit Fazit und Ausblick.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Ökonomische Rahmenbedingungen im Bahnsektor
- 2.1. Die Eisenbahn – ein wirtschaftspolitischer Ausnahmebereich?
- 2.2. Besonderheiten der Netzindustrie
- 2.2.1. Natürliches Monopol
- 2.2.2. Irreversible Kosten
- 2.3. Disaggregierte Betrachtung des Eisenbahnsektors
- 2.3.1. Darstellung der Ebenen der Leistungserstellung
- 2.3.2. Untersuchung der Ebenen auf Wettbewerbsfähigkeit
- 3. Folgerungen für eine effiziente Bahnpolitik
- 3.1. Die Bahnreform und ihre Konsequenzen
- 3.1.1. Stufen der Bahnreform
- 3.1.2. Die heutige Situation
- 3.2. Weiterentwicklung und Alternativen
- 3.2.1. Integrationsgrad der EIU
- 3.2.2. Eigentumsstruktur von EIU und ETU
- 3.2.3. Betriebsrahmen und Regulierungsnotwenigkeit
- 4. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit befasst sich mit dem Bahnsektor und der Bahnreform. Sie untersucht die Privatisierungsmöglichkeiten und die verbleibende Regulierungsnotwendigkeit. Im Mittelpunkt steht die Bedeutung der Trennung von Infrastruktur- und Verkehrssparte für eine erfolgreiche Privatisierung.
- Analyse der ökonomischen Rahmenbedingungen des Bahnsektors
- Bewertung der Privatisierungsmöglichkeiten im Bahnsektor
- Untersuchung der Regulierungsnotwendigkeit im Bahnsektor
- Bedeutung der Trennung von Infrastruktur- und Verkehrssparte für die Privatisierung
- Formulierung von konkreten Folgerungen für die Privatisierung und Deregulierung des Bahnsektors
Zusammenfassung der Kapitel
Kapitel 2 untersucht die ökonomischen Rahmenbedingungen des Bahnsektors und betrachtet die Frage nach wirtschaftspolitischen Ausnahmebereichen und den Konsequenzen für das Marktgeschehen. Kapitel 3 beschreibt die Maßnahmen der Bahnreform und die heutige Situation. Auf Grundlage der Erkenntnisse aus Kapitel 2 werden konkrete Folgerungen für die Privatisierung und Deregulierung des Bahnsektors formuliert.
Schlüsselwörter
Bahnreform, Privatisierung, Deregulierung, Netzindustrie, natürliches Monopol, Infrastruktur, Verkehrssparte, Wettbewerbsfähigkeit, volkswirtschaftliches Ergebnis, staatliches Engagement.
Häufig gestellte Fragen
Was war das Hauptziel der Bahnreform von 1994?
Ziel war es, die Deutsche Bundesbahn und die Deutsche Reichsbahn wirtschaftlich zu sanieren, die Leistungsfähigkeit zu steigern und die Privatisierung vorzubereiten.
Warum gilt der Bahnsektor als "natürliches Monopol"?
Besonders die Schieneninfrastruktur (das Netz) gilt aufgrund hoher irreversibler Kosten als natürliches Monopol, in dem Wettbewerb schwer zu etablieren ist.
Was bedeutet "Spartentrennung" bei der Bahn?
Es bezeichnet die organisatorische Trennung zwischen dem Betrieb des Schienennetzes (Infrastruktur) und dem Betrieb der Züge (Verkehr), um fairen Wettbewerb zu ermöglichen.
Ist die Bahn heute vollständig privatisiert?
Nein, die Deutsche Bahn AG befindet sich nach wie vor zu 100 % in staatlichem Besitz, obwohl die Rechtsform eine Aktiengesellschaft ist.
Welche Regulierungsnotwendigkeiten bestehen weiterhin?
Es bedarf einer Regulierung des Netzzugangs, um sicherzustellen, dass Wettbewerber diskriminierungsfreien Zugang zur Schieneninfrastruktur erhalten.
- Quote paper
- Jörg Thurm (Author), 2005, Bahnreform: Spartentrennung und Privatisierungsmöglichkeiten?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/43901