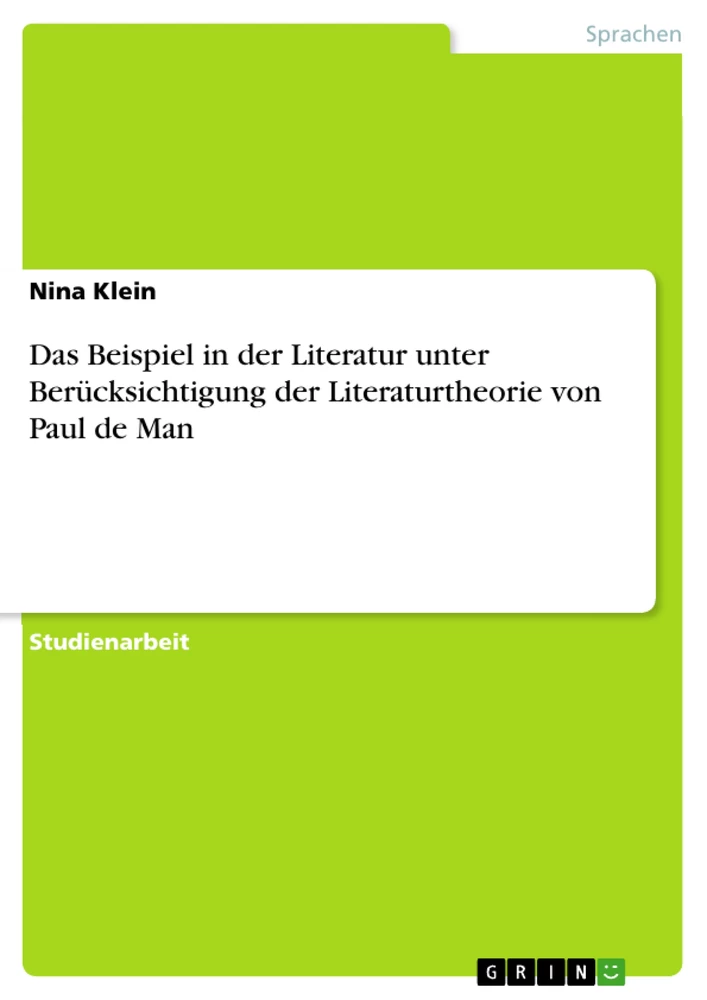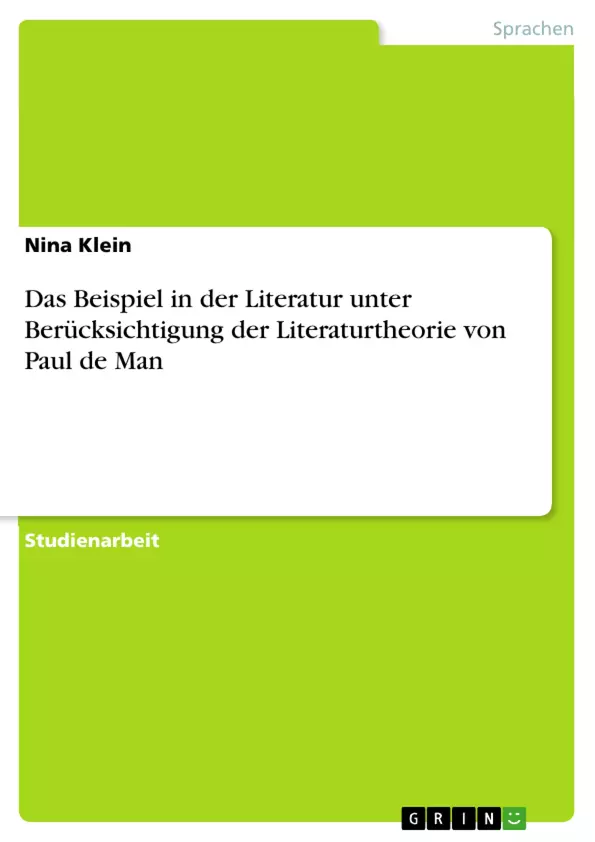Die Literaturtheorien der Literaturwissenschaft vollziehen mit den Entwicklungen des Strukturalismus über den Poststrukturalismus bis hin zur amerikanischen Dekonstruktion einen immensen Sprung. Während der Strukturalismus die „[…] Verkürzung des literarischen Textes auf seine wissenschaftlich handhabbaren Maße […]“ praktiziert, „baut [der Poststrukturalismus] auf den Grundlagen des Strukturalismus auf, […] verändert und kritisiert sie, mehr noch: er greift sie auf und radikalisiert sie […]“ . Allein in diesen beiden Literaturtheorien steht die „Abkehr [von] Subjekt und Sinn“ einer bewussten Zuwendung dieser Bestandteile gegenüber. Während die eine Seite einen Text wissenschaftlich reduziert, wird der Text auf der anderen Seite dekonstruiert und die Ordnung seiner Konstituenten neu hinterfragt. Anhand dieser entgegengesetzten Auffassungen bezüglich literarischer Texte, sind auch die rhetorischen, ästhetischen und hermeneutischen Bestandteile literarischer Werke erneut, und vor allem in der aus dem Poststrukturalismus sprießenden Ausrichtung der Dekonstruktion, auf dem Prüfstand.
Das sprachliche Mittel des Beispiels balanciert in seiner Tradition stetig auf der Grenze zwischen der unmittelbaren Gewinnung von Evidenz und der Abwehr der eigenen „Generalisierung und Systematisierung“ . Es entsteht ein definitorischer Konflikt zwischen Regelhaftigkeit und „Ungebärdigkeit“ . Ist ein Beispiel somit eine vollkommene Veranschaulichung einer allgemeinen Regel oder muss dieses Idealbild einer unfolgsamen, sprachlichen Gewalt weichen?
Auf der Basis dieses Konfliktes soll die vorliegende Hausarbeit eine kritische, literaturtheoretische Sicht auf das Beispiel in der Literatur werfen. Aufgebaut auf einen Einblick in die literaturtheoretische Dekonstruktion sollen die beispieltheoretischen Thesen de Mans vor allem an seinem Aufsatz "Ästhetische Formalisierung: Kleists Über das Marionettentheater" herausgearbeitet werden. De Mans Überlegungen sollen anschließend, auf der Basis der Erzählweise Heinrich von Kleists in dessen Aufsatz Über das Marionettentheater, aufgegriffen und anwendungsbezogen rekonstruiert werden. Damit ist es das Ziel dieser schriftlichen Hausarbeit, einen Einblick in die dekonstruktionistische Arbeit Paul de Mans zu geben, dessen allumfassende Unterwanderung literarischer Prinzipien vor allem keine Verschonung des literarischen Beispiels vorsieht.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Die Dekonstruktion: Allgemein
- Die Dekonstruktion: Paul de Man
- Das rhetorische Beispiel
- Die Beispieltheorie Paul de Mans in Ästhetische Formalisierung: Kleists Über das Marionettentheater
- Die Umsetzung des Beispiels durch Heinrich von Kleist
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Hausarbeit befasst sich mit der literaturtheoretischen Dekonstruktion des Beispiels in der Literatur. Dabei steht die Literaturtheorie von Paul de Man im Vordergrund, insbesondere seine Analyse von Kleists "Über das Marionettentheater". Die Arbeit zielt darauf ab, einen Einblick in die dekonstruktivistische Arbeitsweise de Mans zu geben und deren Anwendung auf ein literarisches Beispiel zu demonstrieren.
- Dekonstruktion des literarischen Beispiels
- Kritik an der "Generalisierung und Systematisierung" des Beispiels
- De Mans Beispieltheorie in "Ästhetische Formalisierung"
- Analyse von Kleists "Über das Marionettentheater" im Kontext der dekonstruktivistischen Theorie
- Die Rolle des Beispiels in der Literatur
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Die Einleitung stellt den Kontext der Hausarbeit dar und beleuchtet die Entwicklung des Strukturalismus und Poststrukturalismus bis hin zur Dekonstruktion. Sie hebt die gegensätzlichen Auffassungen bezüglich literarischer Texte und deren Bestandteile hervor, insbesondere hinsichtlich des Beispiels als sprachliches Mittel.
- Die Dekonstruktion: Allgemein: Dieses Kapitel erläutert die Entstehung und Konzepte des Poststrukturalismus und der Dekonstruktion, insbesondere in Bezug auf die Werke von Jacques Derrida. Es wird die kritische Infragestellung etablierter Annahmen und die Zerlegung theoretischer Systeme durch die Dekonstruktion hervorgehoben.
- Das rhetorische Beispiel: Das Kapitel beleuchtet die Rolle des Beispiels als rhetorisches Mittel und den Konflikt zwischen der Gewinnung von Evidenz und der Abwehr von "Generalisierung und Systematisierung".
- Die Beispieltheorie Paul de Mans in Ästhetische Formalisierung: Kleists Über das Marionettentheater: Dieses Kapitel stellt die Beispieltheorie von Paul de Man vor und analysiert seinen Aufsatz "Ästhetische Formalisierung" im Kontext von Kleists "Über das Marionettentheater". Es untersucht, wie de Man das literarische Beispiel dekonstruiert und welche Implikationen diese Dekonstruktion für die Interpretation des Textes hat.
Schlüsselwörter
Die wichtigsten Schlüsselwörter dieser Hausarbeit sind: Dekonstruktion, Beispiel, Literaturtheorie, Paul de Man, Heinrich von Kleist, "Über das Marionettentheater", Ästhetische Formalisierung, Rhetorik, Sprache, Differenz, Sinn, Bedeutung, System, Text, Interpretation, Ambivalenz, Widerspruch.
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Hauptthema dieser Hausarbeit?
Die Arbeit befasst sich mit der literaturtheoretischen Dekonstruktion des "Beispiels" in der Literatur, insbesondere unter Berücksichtigung der Theorie von Paul de Man.
Welche Rolle spielt Paul de Man in dieser Untersuchung?
Paul de Mans dekonstruktivistische Arbeitsweise und seine beispieltheoretischen Thesen bilden das theoretische Fundament der Analyse.
Welches literarische Werk wird als Fallbeispiel herangezogen?
Die Arbeit analysiert Heinrich von Kleists Aufsatz "Über das Marionettentheater" im Kontext von de Mans Essay "Ästhetische Formalisierung".
Was wird an der "Generalisierung und Systematisierung" des Beispiels kritisiert?
Die Dekonstruktion hinterfragt, ob ein Beispiel wirklich nur eine allgemeine Regel veranschaulicht oder ob es eine eigene "sprachliche Gewalt" besitzt, die sich der Ordnung widersetzt.
Was ist der Unterschied zwischen Strukturalismus und Poststrukturalismus laut Text?
Während der Strukturalismus Texte wissenschaftlich reduziert, radikalisiert der Poststrukturalismus diese Ansätze und hinterfragt die Ordnung der Konstituenten neu.
- Quote paper
- Nina Klein (Author), 2018, Das Beispiel in der Literatur unter Berücksichtigung der Literaturtheorie von Paul de Man, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/441528