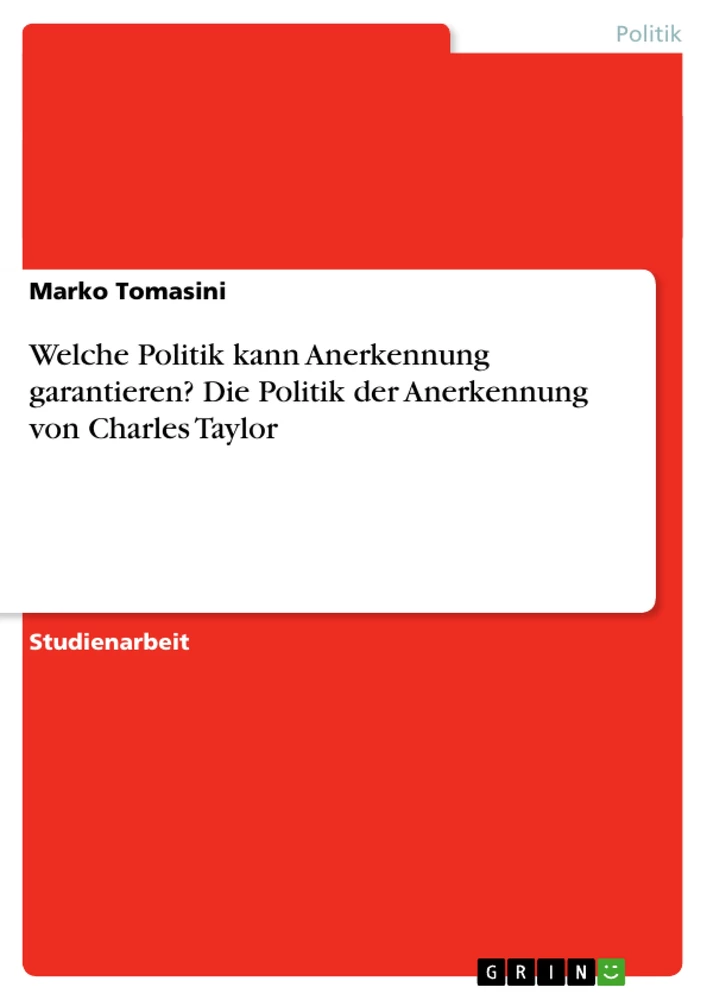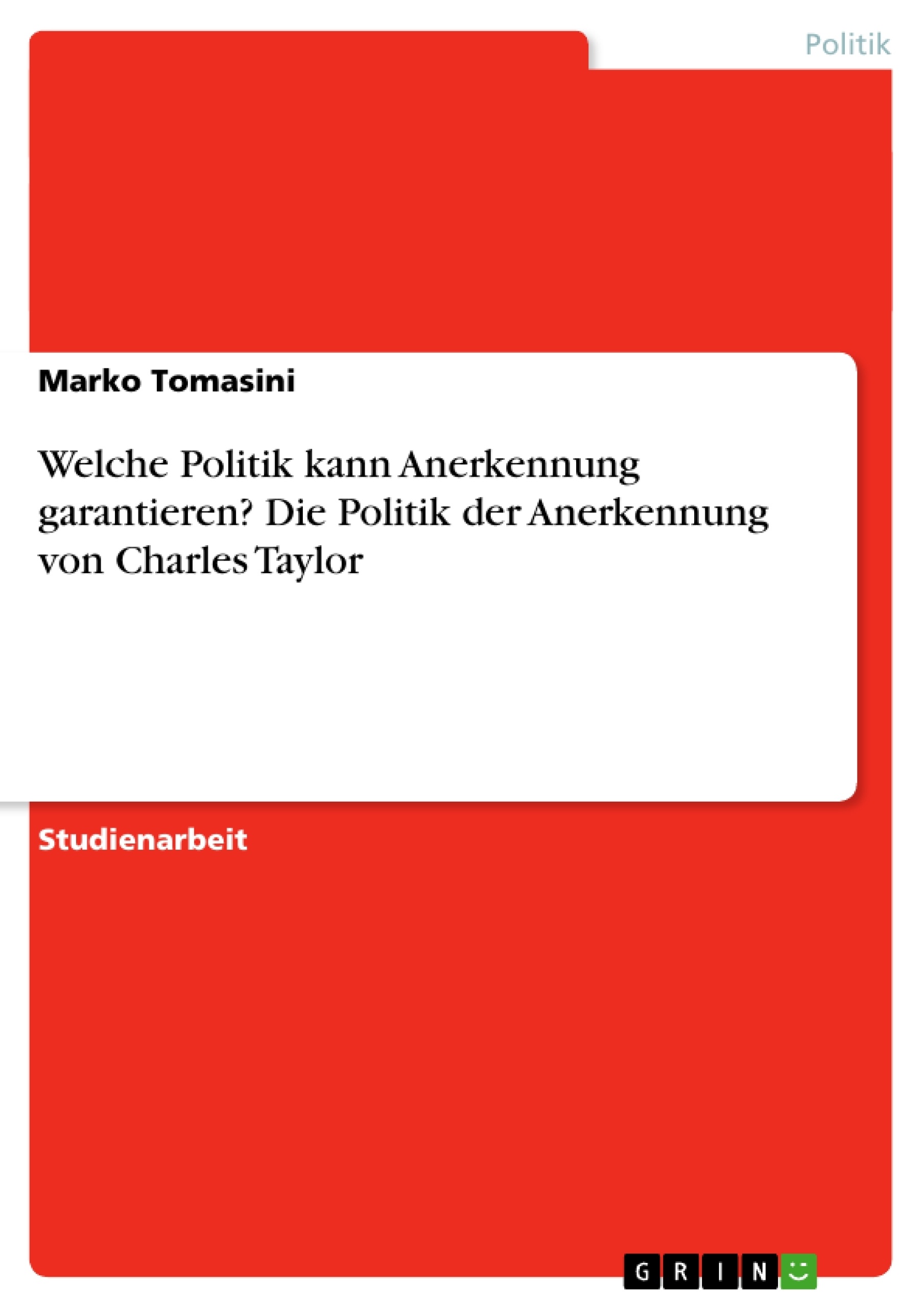Die Frage, der Charles Taylor in seinem Essay „Die Politik der Anerkennung“ nachgeht, lautet: „Welche Politik kann gleichberechtigte Anerkennung, sowohl zwischen verschieden Individuen innerhalb einer Gesellschaft, als auch interkulturell zwischen verschiedenen Kulturen, gewährleisten?“. Dabei zeigt er zwei verschiedene Politikformen auf und stellt sie gegenüber: Einmal den Liberalismus, den er auch Universalismus oder Liberalismus 1 benennt und zum Anderen die Politik der Differenz oder auch Liberalismus 2. Seine Kriterien, welche er als Maßstab ansetzt sind dabei Anerkennung der individuellen und der kulturellen Identität, Gleichberechtigung und Chancengleichheit.
Ohne es vorweg nehmen zu wollen, setzt Taylor im Verlauf und am Ende seines Essays auf die Stärken der zweiten Auslegung liberaler Politik, da er die Grundlagen des „herkömmlichen Liberalismus“ als unzureichend hält um gleichermaßen Anerkennung garantieren zu können. Er steht dabei in einer Reihe von Philosophen und Politologen, welche man unter die politikphilosophische Bezeichnung der „Kommunitaristen“ zusammenfassen kann und ist somit eingebunden in die Diskussion zwischen diesen Denkern und den Liberalisten. Dabei stellen die Kommunitaristen eine reaktionäre politische „Denkrichtung“ dar, welche Anfang der 1980er Jahre entstanden ist und im wesentlichen als eine Reaktion auf das Werk von John Rawls „a theory of justice“ aus dem Jahr 1971 betrachtet wird. Die Theorie von Rawls und die weitere Entwicklung des Liberalismus geht davon aus, dass Gleichberechtigung und Chancengleichheit allein mit neutralem Recht, welches von den Mitgliedern einer Gesellschaft ausgehandelt und vertraglich festgehalten wird und allen Mitgliedern in gleichem Maße zugänglich ist, erreicht werden kann, wogegen die Kommunitaristen die Meinung vertreten, dass der Staat aktiv und substantiell eingreifen kann, wenn es darum geht, kollektive Ziele zu verfolgen. Es kann also nach dieser politischen Philosophie auch sein, dass gewissen Gruppen oder Individuen mehr Rechte eingeräumt werden als Anderen, wodurch unterschiedliche Freiheiten erzeugt werden. Dies kann geschehen, wenn Werte, Traditionen u.ä. geschützt und erhalten werden sollen. Sie sind im Kommunitarismus das zentrale Element.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Taylor und die Politik der Anerkennung
- Würde, Identität und Anerkennung
- Taylors Sicht auf den Universalismus und seine Kritik
- Taylors Gegenkonzept: Die Politik der Differenz
- Die Kritik von Habermas
- Resümee
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit befasst sich mit Charles Taylors Essay "Die Politik der Anerkennung" und untersucht, welche Politik gleichberechtigte Anerkennung zwischen Individuen und Kulturen gewährleisten kann. Taylor analysiert dabei die Grenzen des Universalismus und entwickelt ein Gegenkonzept, die Politik der Differenz.
- Die Bedeutung von Anerkennung für individuelle und kulturelle Identität
- Taylors Kritik am Universalismus und seine Konzeption des Liberalismus 2
- Die Rolle von Identität und Differenz in der Politik
- Der Vergleich zwischen Taylors und Habermas' Positionen zur Anerkennung
- Die Frage nach der am besten geeigneten Politik zur Gewährleistung von Anerkennung und Gleichberechtigung
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung
In der Einleitung stellt der Autor die zentrale Frage des Essays vor: Welche Politik kann gleichberechtigte Anerkennung zwischen Individuen und Kulturen garantieren? Taylor stellt zwei Politikformen gegenüber: den Universalismus und die Politik der Differenz. Seine Analyse basiert auf den Kriterien Anerkennung der Identität, Gleichberechtigung und Chancengleichheit.
Taylor und die Politik der Anerkennung
Dieser Abschnitt untersucht Taylors Konzept der Anerkennung im Detail. Er beleuchtet die Bedeutung von Würde, Identität und Anerkennung für das menschliche Dasein und zeigt auf, wie Nichtanerkennung zu Leiden und Unterdrückung führen kann. Taylor argumentiert, dass Anerkennung sowohl universell als auch individuell ist: Jeder Mensch besitzt die gleiche Würde aufgrund seiner Fähigkeit zu rationalem Handeln, aber gleichzeitig eine einzigartige Identität, die durch den Dialog mit "signifikanten Anderen" geformt wird.
Die Kritik von Habermas
In diesem Kapitel wird die Kritik von Habermas an Taylors Konzept der Anerkennung dargestellt. Habermas argumentiert, dass Taylors Politik der Differenz zu einem unüberwindbaren Konflikt zwischen verschiedenen Kulturen führen kann. Er kritisiert, dass Taylors Ansatz die Gefahr birgt, die Universalität von Menschenrechten zu untergraben.
Schlüsselwörter
Die zentralen Begriffe dieser Arbeit sind Anerkennung, Identität, Differenz, Universalismus, Liberalismus, Politik, Gleichberechtigung, Chancengleichheit, Kommunitarismus, und Kultur.
Häufig gestellte Fragen
Was versteht Charles Taylor unter der „Politik der Anerkennung“?
Taylor untersucht, wie eine Gesellschaft gleichberechtigte Anerkennung für individuelle und kulturelle Identitäten gewährleisten kann, um Diskriminierung und Leiden zu vermeiden.
Was ist der Unterschied zwischen Liberalismus 1 und Liberalismus 2?
Liberalismus 1 (Universalismus) setzt auf neutrales Recht für alle. Liberalismus 2 (Politik der Differenz) erlaubt staatliche Eingriffe zur Förderung kollektiver Ziele und zum Schutz von Minderheiten.
Warum kritisiert Taylor den reinen Universalismus?
Er hält ihn für unzureichend, da neutrales Recht die Besonderheiten kultureller Identitäten oft ignoriert und somit keine echte Anerkennung garantieren kann.
Was werfen Kommunitaristen dem Denken von John Rawls vor?
Sie kritisieren, dass Rawls' Fokus auf individuellen Verträgen die Bedeutung von Werten, Traditionen und kollektiven Zielen für die Stabilität einer Gesellschaft vernachlässigt.
Wie beurteilt Habermas Taylors Ansatz?
Habermas warnt davor, dass eine Politik der Differenz die Universalität der Menschenrechte untergraben und zu unüberwindbaren Konflikten zwischen Kulturen führen könnte.
- Quote paper
- Marko Tomasini (Author), 2005, Welche Politik kann Anerkennung garantieren? Die Politik der Anerkennung von Charles Taylor, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/44181