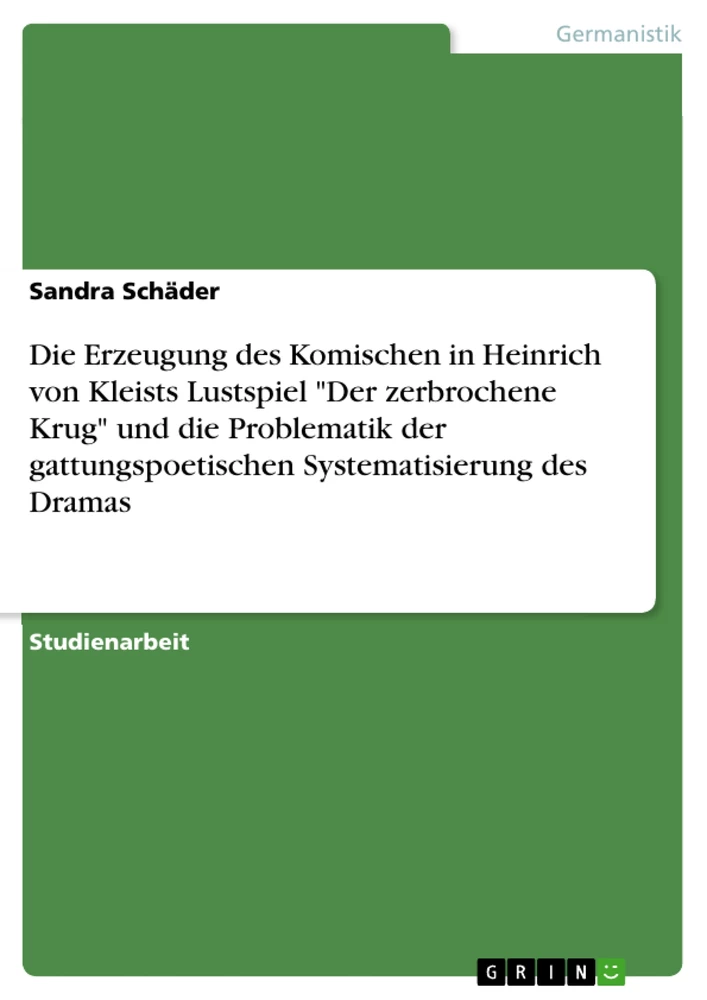Heinrich von Kleist war ein bedeutender deutscher Schriftsteller, dessen literarische Werke besonders von seinem tragischen Lebensweg inspiriert worden sind. In starkem Kontrast dazu steht Kleists erheiterndes Lustspiel „Der zerbrochene Krug“, bei welchem es sich um „eines der wenigen deutschen Lustspiele [handelt], das die Zeiten überdauert hat und noch immer das Theaterpublikum erfreut.“ Problematisch ist bei diesem Drama Kleists jedoch, dass es neben seinen komischen Elementen auch tragische Elemente enthält, weswegen sich bis heute Kritiker nicht darüber einig sind, ob es sich bei Kleists Lustspiel tatsächlich um eine Komödie, ein Lustspiel, handelt oder ob nicht doch die Tragik überwiegt, sodass es der literarischen Gattung Tragödie zugeordnet werden sollte. Wie also wird das Komische in Kleists Lustspiel „Der zerbrochene Krug“ evoziert und inwiefern kann der Lustspielcharakter des Dramas trotz dieser komischen Elemente in Frage gestellt werden?
Inhaltsverzeichnis
1. Einleitung
2. Die Erzeugung des Komischen in Kleists Lustspiel ״Der zerbrochene Krug‘[1]
2.1. Handlungs- und Situationskomik
2.2. Figurenkomik
2.3. Sprachkomik
2.4. Namensgebung
3. Die Problematik der Unterwerfung des Dramas unter das Konzept gattungspoetischer Systematisierung als Lustspiel
3.1. Kritik an der Gattungszugehörigkeit
3.2. Kleists Eigendefinition von ,Lustspiel‘
4. Fazit
5. Literaturverzei chnis
-
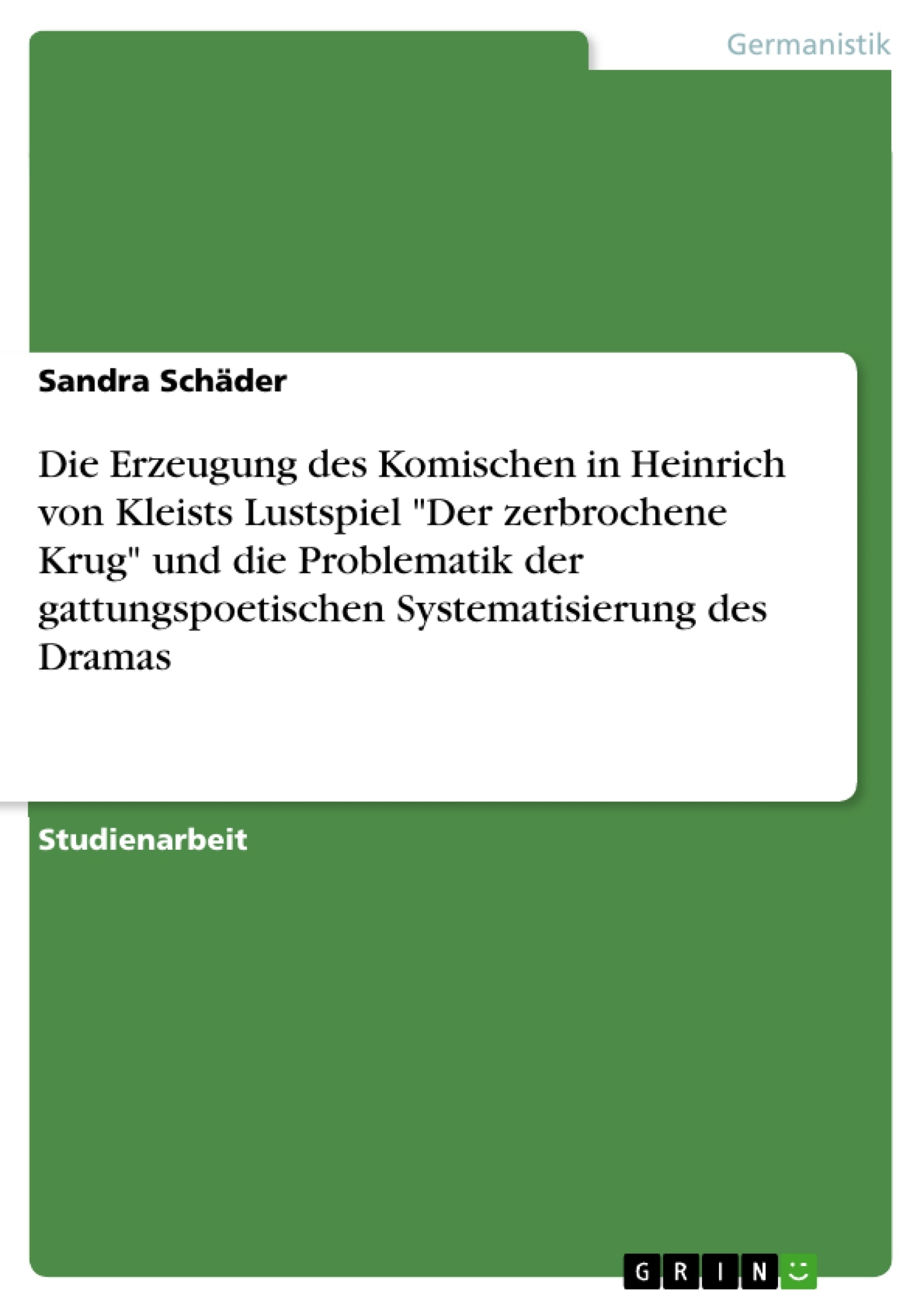
-

-

-
Laden Sie Ihre eigenen Arbeiten hoch! Geld verdienen und iPhone X gewinnen. -

-
Laden Sie Ihre eigenen Arbeiten hoch! Geld verdienen und iPhone X gewinnen. -

-
Laden Sie Ihre eigenen Arbeiten hoch! Geld verdienen und iPhone X gewinnen. -

-
Laden Sie Ihre eigenen Arbeiten hoch! Geld verdienen und iPhone X gewinnen. -

-
Laden Sie Ihre eigenen Arbeiten hoch! Geld verdienen und iPhone X gewinnen. -

-
Laden Sie Ihre eigenen Arbeiten hoch! Geld verdienen und iPhone X gewinnen.