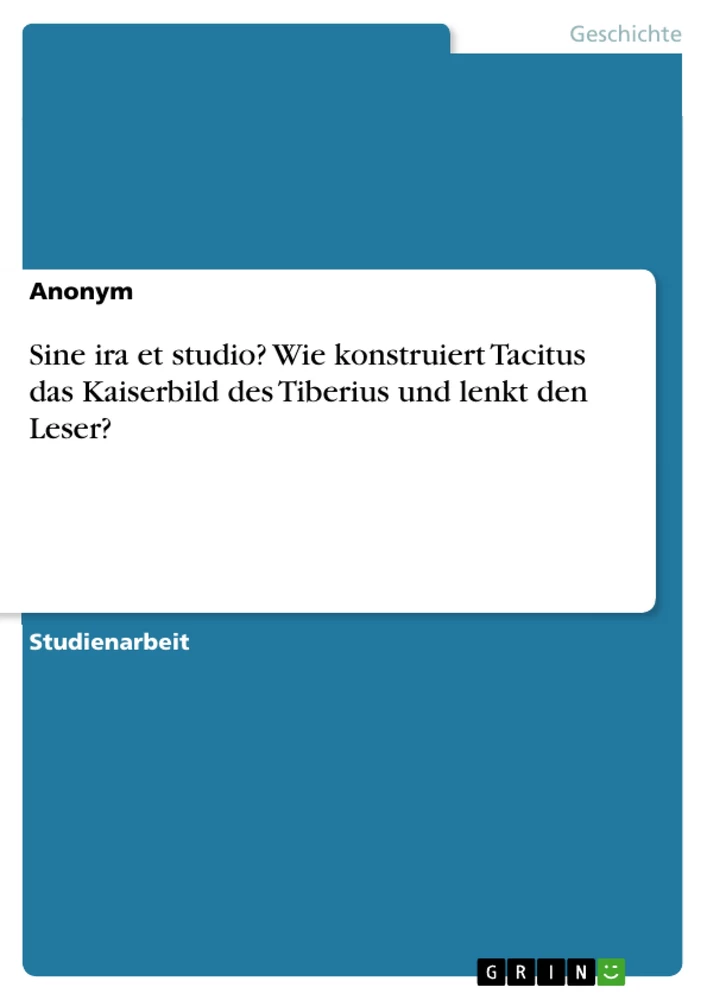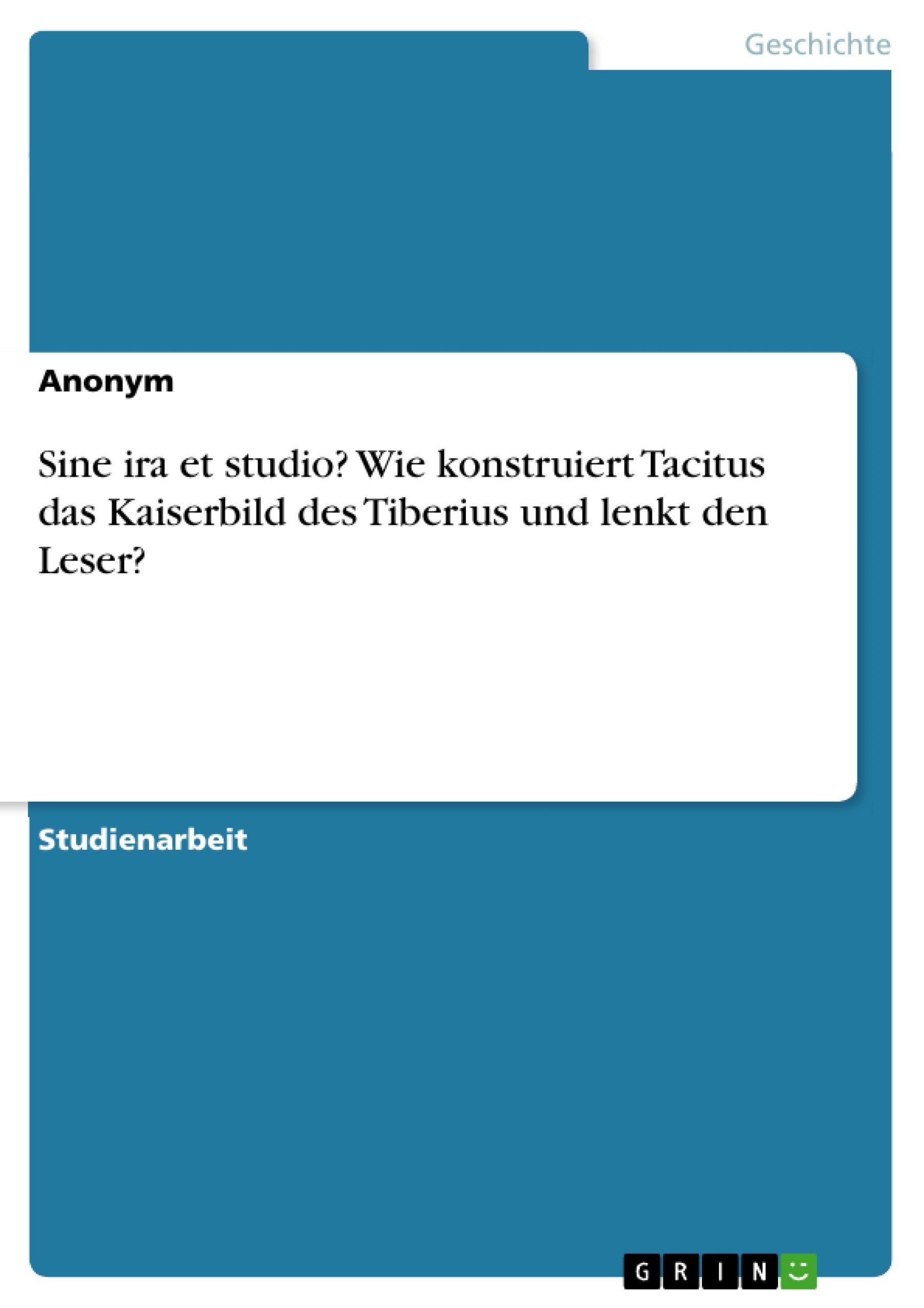„Sine ira et studio“ (lateinisch: ohne Zorn und ohne Eifer) lautet eine Maxime des römischen Geschichtsschreibers Tacitus. Diese Redewendung findet sich in dem Vorwort der Analen. Er erhebt damit einen Objektivitätsanspruch auf seine Geschichtsschreibung. Als Begründung gibt er an, dass die Epoche, die er behandele, schon so weit zurückliege, dass er keine Motive hätte, seine Geschichtsschreibung zum Instrument seiner persönlichen Erfahrungen mit den einzelnen Individuen, über die er berichtete, zu machen. Die Art der Geschichtsschreibung von Tacitus wird auch als senatorische Geschichtsschreibung bezeichnet, da Tacitus selber Senator war und über die römischen Herrscher berichtete. In den Analen konstruiert Tacitus ein Bild des Tiberius als Tyrannen und versucht mit mehreren literarischen Methoden, den Leser so zu lenken, dass selbst positive Aspekte des Tiberius negativ erscheinen. In dieser Hausarbeit möchte ich deutlich machen, wie Tacitus das konstruierte Kaiserbild darstellt und wie er genau den Leser lenkt, um ihn von seinem Kaiserbild zu überzeugen. Am Ende werde ich die Frage beantworten, ob die Maxime „sine ira et studio“ von Tacitus überhaupt haltbar ist
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Das Kaiserbild des Tiberius nach Tacitus in den Annalen
- 3. Die subtilen Methoden der Leserlenkung in den Annalen
- 4. Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit analysiert Tacitus' Darstellung des Kaisers Tiberius in den Annalen und untersucht die rhetorischen Strategien, mit denen Tacitus den Leser beeinflusst. Ziel ist es, aufzuzeigen, wie Tacitus ein bestimmtes Kaiserbild konstruiert und den Leser gezielt in diese Konstruktion einbindet. Die Arbeit hinterfragt letztlich die Gültigkeit von Tacitus' Maxime „sine ira et studio“.
- Konstruktion des Kaiserbildes des Tiberius bei Tacitus
- Analyse der rhetorischen Mittel der Leserlenkung
- Die Frage nach der Objektivität von Tacitus' Darstellung
- Tacitus' politische Intentionen und seine Kritik am Prinzipat
- Das Verhältnis zwischen Tacitus' persönlicher Erfahrung und seiner Geschichtsschreibung
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema ein und stellt die zentrale Forschungsfrage nach der Konstruktion des Kaiserbildes des Tiberius bei Tacitus und der Wirkung auf den Leser. Sie führt in Tacitus' Maxime „sine ira et studio“ ein und stellt seine Biografie und die Entstehung der Annalen kurz dar. Die Einleitung etabliert den Kontext der senatorischen Geschichtsschreibung und skizziert den methodischen Ansatz der Arbeit, der darauf abzielt, Tacitus’ Darstellung zu analysieren und die Frage nach der Objektivität seiner Geschichtsschreibung zu beantworten. Der Fokus liegt auf der methodischen Herangehensweise und den Forschungszielen.
2. Das Kaiserbild des Tiberius nach Tacitus in den Annalen: Dieses Kapitel präsentiert Tacitus' Konstruktion des Kaiserbildes von Tiberius. Tacitus zeichnet das Bild eines ängstlichen (anxius), betrübten (tristis), hochmütigen (superbus) und listig-bösartigen (callidus) Herrschers. Es werden detailliert Tacitus' Beschreibungen und die verwendeten Attribute analysiert, um die negative Darstellung des Kaisers zu belegen. Die Beschreibungen von Tiberius' vermeintlichen Charaktereigenschaften werden im Detail analysiert und mit Beispielen aus den Annalen belegt. Gleichzeitig wird die Frage nach der Objektivität dieser Darstellung aufgeworfen, indem mögliche Interpretationsspielräume und die Einbettung in den Kontext der senatorischen Geschichtsschreibung berücksichtigt werden. Die Analyse verdeutlicht Tacitus' methodische Vorgehensweise, um den Leser von seinem negativen Bild Tiberius' zu überzeugen.
Schlüsselwörter
Tacitus, Annalen, Tiberius, Kaiserbild, Leserlenkung, Rhetorik, senatorische Geschichtsschreibung, „sine ira et studio“, Prinzipat, Objektivität, Tyrannenbild, politische Intention.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Analyse von Tacitus' Darstellung des Kaisers Tiberius in den Annalen
Was ist der Gegenstand dieser Hausarbeit?
Die Hausarbeit analysiert Tacitus' Darstellung des Kaisers Tiberius in seinen Annalen und untersucht die rhetorischen Strategien, mit denen Tacitus den Leser beeinflusst. Im Mittelpunkt steht die Konstruktion des Kaiserbildes und die Frage nach der Objektivität von Tacitus' Schilderung.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt die Konstruktion des Kaiserbildes von Tiberius, die Analyse der rhetorischen Mittel der Leserlenkung, die Objektivität von Tacitus' Darstellung, seine politischen Intentionen und Kritik am Prinzipat sowie das Verhältnis zwischen persönlicher Erfahrung und Geschichtsschreibung.
Wie ist die Arbeit aufgebaut?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, ein Kapitel zur Analyse des Kaiserbildes des Tiberius, ein Kapitel zu den Methoden der Leserlenkung und einen Ausblick. Die Einleitung führt in das Thema ein, erläutert die Forschungsfrage und den methodischen Ansatz. Das Hauptkapitel analysiert detailliert Tacitus' Darstellung von Tiberius, beleuchtet seine Charakterisierung und die verwendeten rhetorischen Mittel. Der Ausblick fasst die Ergebnisse zusammen und bietet Perspektiven für weitere Forschung.
Wie charakterisiert Tacitus Tiberius?
Tacitus zeichnet ein negatives Bild von Tiberius als ängstlich (anxius), betrübt (tristis), hochmütig (superbus) und listig-bösartig (callidus) Herrscher. Diese Charakterisierung wird durch detaillierte Analysen von Tacitus' Beschreibungen und Attributen belegt.
Welche Methoden der Leserlenkung werden untersucht?
Die Arbeit analysiert die rhetorischen Strategien, die Tacitus einsetzt, um den Leser von seinem negativen Bild Tiberius' zu überzeugen. Es wird untersucht, wie Tacitus durch Wortwahl, Beschreibungen und die Auswahl von Details den Leser beeinflusst und zu einer bestimmten Interpretation führt.
Wie wird die Objektivität von Tacitus' Darstellung bewertet?
Die Arbeit hinterfragt die Objektivität von Tacitus' Darstellung und berücksichtigt mögliche Interpretationsspielräume. Sie bezieht den Kontext der senatorischen Geschichtsschreibung mit ein und diskutiert Tacitus' politische Intentionen und seine mögliche Voreingenommenheit.
Welche Schlüsselwörter sind relevant?
Relevante Schlüsselwörter sind: Tacitus, Annalen, Tiberius, Kaiserbild, Leserlenkung, Rhetorik, senatorische Geschichtsschreibung, „sine ira et studio“, Prinzipat, Objektivität, Tyrannenbild, politische Intention.
Was ist die zentrale Forschungsfrage?
Die zentrale Forschungsfrage lautet: Wie konstruiert Tacitus das Kaiserbild des Tiberius in den Annalen und wie beeinflusst er damit den Leser? Ein weiterer wichtiger Punkt ist die Überprüfung der Gültigkeit von Tacitus' Maxime „sine ira et studio“.
- Citation du texte
- Anonym (Auteur), 2017, Sine ira et studio? Wie konstruiert Tacitus das Kaiserbild des Tiberius und lenkt den Leser?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/443944