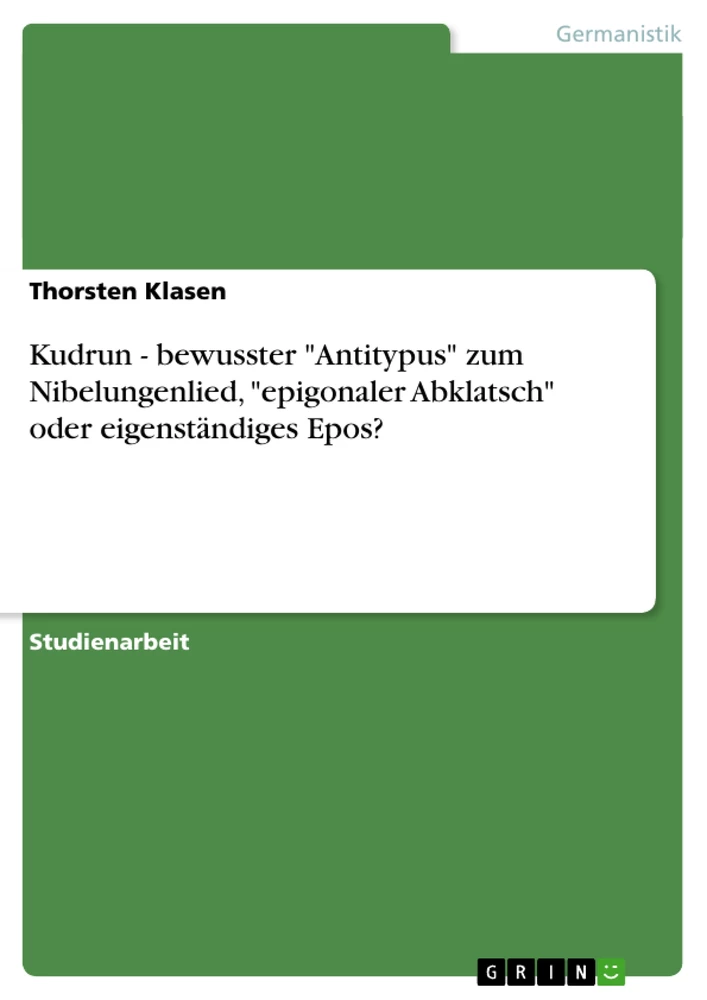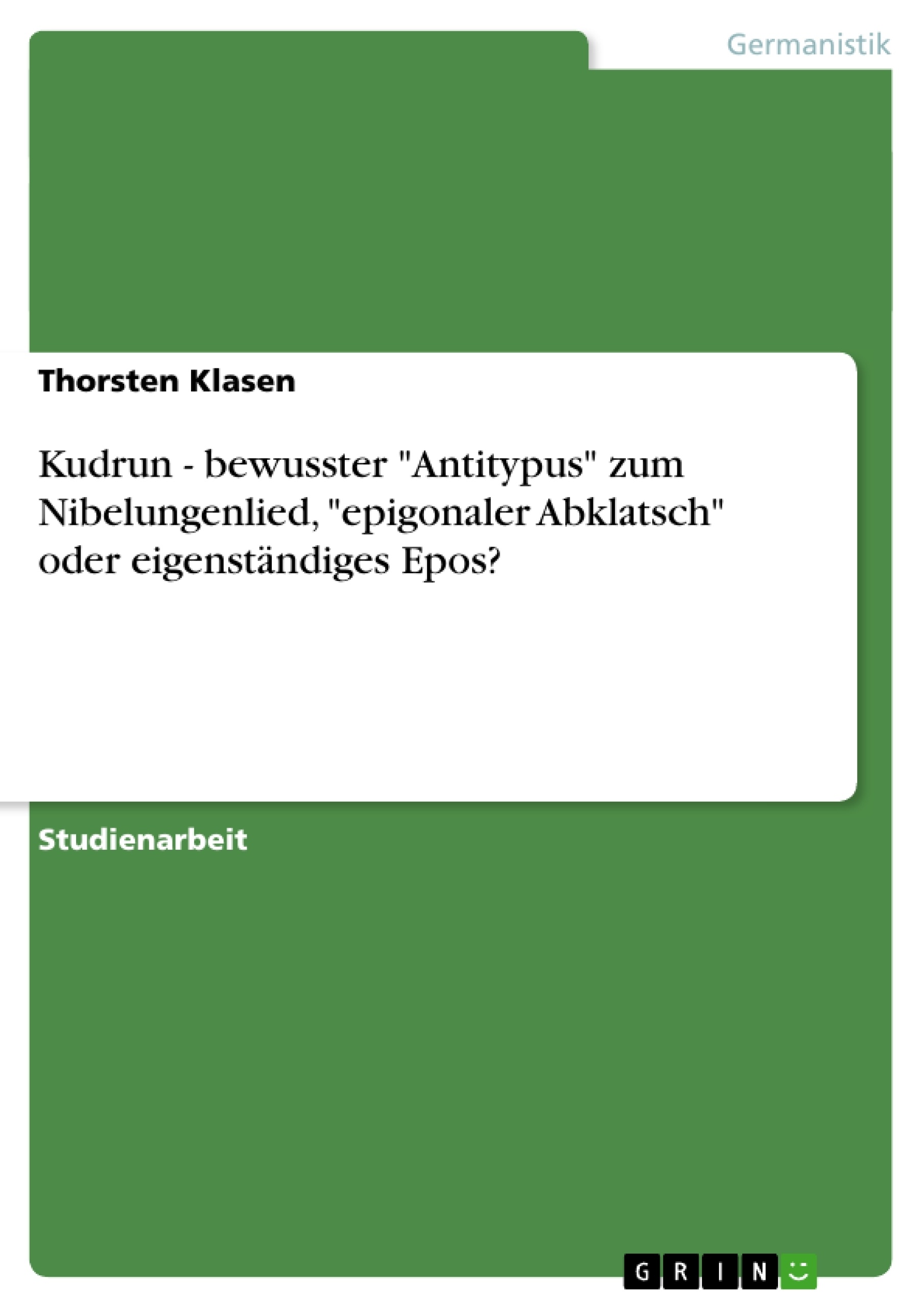»Überall ist Mittelalter« – diese, von Horst Fuhrmann geprägte Erkenntnis schlägt sich auch im Sprachgebrauch tagesaktueller Politik nieder. So zuletzt am 01.07.2005 in der Rede Franz Müntefehrings in der Debatte zur Vertrauensfrage im Deutschen Bundestag. Dort kritisiert er die unproduktive und schädliche politische Blockadehaltung der CDU-Fraktion im Bundesrat, die er wörtlich als »Nibelungentreue« bezeichnet und die maßgeblich dafür verantwortlich sei, dass der Politikprozess in Deutschland scheitere.
Zwar fällt zwar das Wort triuwe im Niebelungenlied (im weiteren Verlauf mit dem Sigle NL bezeichnet) öfter, nie aber ›Nibelungentreue‹. Sie wird erst im 20. Jahrhundert als Schlagwort für bedingungslose, selbstlose Gefolgschaftstreue gegenüber einem politischen Verbündeten oder Führer geprägt. Dies ist nur ein Beispiel für den immensen Einfluß den dieses Epos bis heute hinterlassen hat. Ob dieser Einfluss unter zeitgenössischen Rezipienten ebenfalls so groß war, dass ein unbekannter Autor inspiriert davon eine Antwort schreibt und dem ganzen den Namen Kudrun gibt, ist schwer zu beantworten.
Der plakative Titel dieser Hausarbeit allerdings spiegelt grob die Ergebnisse verschiedener Etappen der Forschung zum Kudrun-Epos im Zusammenhang mit dem NL wider. In den unterschiedlichen Einschätzungen der Kudrun und der möglichen Motivation des Kudrun-Autors kommen immer auch verschiedene Fragestellungen im jeweiligen historischen Kontext zum Vorschein.
Die Frage nach Gegenentwurf oder Abklatsch‹ des Werkes lässt sich nicht generell mit »Ja« oder »Nein« beantworten, da die Frage immer eingegrenzt werden muss auf einen bestimmten Aspekt des Werkes. Es geht also um die Prämissen die man an die Fragestellung knüpft. Geht man von formalen Aspekten aus, oder von intertextuellen Bezügen, von Figurenkonstellation oder vom Inhalt und Intention eines Werkes aus? Um bei der Beantwortung der Frage ob und inwiefern die Kudrun als Antitypus oder ›epigonaler Abklatsch‹ oder sogar als eigenständiges Werk einzuschätzen ist, soll der Zugang zu dem Thema von Aussen – also über Aufbau und Struktur, nach Innen – zum Inhalt, wie Personenkonstellationen und sozialer Rollenverteilungen führen, um zu einer Einschätzung hinsichtlich der Fragestellung zu gelangen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Überlieferung von Nibelungenlied und Kudrun
- Zur Einordnung der Kudrun in die Heldenepik
- Formaler Aufbau von NL und Kudrun im Vergleich
- Personenkonstellationen von NL und Kudrun im Vergleich
- Ein anderer Zugang zur Kudrun – der mittelalterliche Diskurs über die ideale Ehefrau
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht das Kudrun-Epos im Vergleich zum Nibelungenlied. Ziel ist es, die Frage nach dem Verhältnis beider Werke zu klären: Ist die Kudrun ein bewusster Gegenentwurf (Antitypus), ein bloßer Abklatsch oder ein eigenständiges Epos? Die Untersuchung betrachtet formale Aspekte, intertextuelle Bezüge, Figurenkonstellationen und den Inhalt beider Werke.
- Vergleich der Überlieferungsgeschichte von Nibelungenlied und Kudrun
- Gattungszuordnung der Kudrun und ihre Einordnung in die Heldenepik
- Formale Unterschiede und Gemeinsamkeiten im Aufbau beider Epen
- Analyse der Figurenkonstellationen und der Darstellung sozialer Rollen
- Der Einfluss des mittelalterlichen Diskurses über die ideale Ehefrau auf die Kudrun
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung stellt die Relevanz des Nibelungenliedes für die heutige Zeit dar und führt in die Forschungsfrage ein: Ist die Kudrun ein bewusster Gegenentwurf, ein Abklatsch oder ein eigenständiges Werk? Die Arbeit skizziert den methodischen Ansatz, der sowohl formale Aspekte als auch inhaltliche Elemente der beiden Epen berücksichtigt. Die Fragestellung wird als komplex dargestellt, die Beantwortung erfordert eine differenzierte Betrachtung verschiedener Aspekte.
Überlieferung von Nibelungenlied und Kudrun: Dieses Kapitel vergleicht die Überlieferungsgeschichte beider Epen. Das Nibelungenlied existiert in zahlreichen Handschriften, was auf seine große Popularität hinweist. Im Gegensatz dazu ist die Kudrun nur in einer einzigen Handschrift, dem Ambraser Heldenbuch, überliefert. Dieser Unterschied in der Überlieferung wird als Indiz für eine unterschiedliche Rezeption und Verbreitung der beiden Werke interpretiert. Die späte schriftliche Fixierung der Kudrun und der daraus resultierende schlechte Zustand des erhaltenen Textes erschweren den Vergleich zusätzlich.
Zur Einordnung der Kudrun in die Heldenepik: Dieses Kapitel diskutiert die gattungsspezifische Einordnung der Kudrun. Im Gegensatz zum Nibelungenlied, das eindeutig der Heldendichtung zugeordnet wird, ist die Einordnung der Kudrun schwieriger. Die Kudrun zeigt eine Vermischung verschiedener Gattungen, wie Heldendichtung, Spielmannsdichtung und höfischer Roman. Die unterschiedlichen Interpretationen dieser gattungstechnischen Unschärfe werden vorgestellt und diskutiert, wobei die Rolle des mittelalterlichen Diskurses über die ideale Ehefrau hervorgehoben wird.
Formaler Aufbau von NL und Kudrun im Vergleich: Dieses Kapitel befasst sich mit einem Vergleich des formalen Aufbaus beider Epen. Es werden die verschiedenen Ansichten der Forschung zu der Frage beleuchtet, inwiefern sich der Autor der Kudrun am Nibelungenlied orientiert hat. Es werden Ergebnisse früherer Studien zum Strophenvergleich zitiert, ohne dabei selbst auf den detaillierten Vergleich einzugehen. Die Einleitung verdeutlicht das Vorhandensein unterschiedlicher Forschungsansätze und Interpretationen, ohne konkrete Ergebnisse vorwegzunehmen.
Schlüsselwörter
Nibelungenlied, Kudrun, Heldenepik, Mittelalter, Antitypus, intertextuelle Beziehungen, Überlieferung, ideale Ehefrau, Gattung, formaler Aufbau, Figurenkonstellation.
Häufig gestellte Fragen zum Vergleich von Nibelungenlied und Kudrun
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit vergleicht das Nibelungenlied und das Kudrun-Epos. Das zentrale Thema ist die Untersuchung des Verhältnisses beider Werke zueinander: Ist die Kudrun ein bewusster Gegenentwurf (Antitypus), eine Nachahmung oder ein eigenständiges Epos?
Welche Aspekte werden im Vergleich untersucht?
Der Vergleich umfasst formale Aspekte (Aufbau, Strophen), intertextuelle Bezüge, Figurenkonstellationen, die Darstellung sozialer Rollen und den Inhalt beider Epen. Ein besonderer Fokus liegt auf dem Einfluss des mittelalterlichen Diskurses über die ideale Ehefrau auf die Kudrun.
Wie ist die Arbeit aufgebaut?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, Kapitel zur Überlieferung beider Epen, zur Einordnung der Kudrun in die Heldenepik, zum formalen Aufbau und zu den Figurenkonstellationen. Ein weiteres Kapitel widmet sich dem Einfluss des mittelalterlichen Diskurses über die ideale Ehefrau auf die Kudrun. Die Arbeit schließt mit einem Fazit.
Wie unterscheiden sich die Überlieferungsgeschichten von Nibelungenlied und Kudrun?
Das Nibelungenlied ist in zahlreichen Handschriften überliefert, was auf seine große Popularität hinweist. Die Kudrun hingegen ist nur in einer einzigen Handschrift (Ambraser Heldenbuch) erhalten, was ihre Rezeption und Verbreitung im Vergleich einschränkt und den Vergleich erschwert.
Wie wird die Kudrun gattungsspezifisch eingeordnet?
Im Gegensatz zum eindeutig der Heldendichtung zugeordneten Nibelungenlied, ist die Einordnung der Kudrun schwieriger. Sie zeigt eine Vermischung verschiedener Gattungen (Heldendichtung, Spielmannsdichtung, höfischer Roman). Die Arbeit diskutiert die unterschiedlichen Interpretationen dieser gattungstechnischen Unschärfe.
Wie werden der formale Aufbau und die Figurenkonstellationen verglichen?
Das Kapitel zum formalen Aufbau vergleicht den Aufbau beider Epen und beleuchtet verschiedene Forschungsansätze zur Frage der Orientierung des Kudrun-Autors am Nibelungenlied. Der Vergleich der Figurenkonstellationen analysiert die Darstellung sozialer Rollen in beiden Epen.
Welche Rolle spielt der mittelalterliche Diskurs über die ideale Ehefrau?
Der mittelalterliche Diskurs über die ideale Ehefrau spielt eine wichtige Rolle im Verständnis der Kudrun. Die Arbeit untersucht, wie dieser Diskurs die Gestaltung der Figur der Kudrun und die Handlung des Epos beeinflusst hat.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Nibelungenlied, Kudrun, Heldenepik, Mittelalter, Antitypus, intertextuelle Beziehungen, Überlieferung, ideale Ehefrau, Gattung, formaler Aufbau, Figurenkonstellation.
Welche Schlussfolgerung zieht die Arbeit?
Die Arbeit kommt zu dem Schluss, dass die Kudrun kein einfacher Abklatsch des Nibelungenliedes ist, sondern ein eigenständiges Epos mit spezifischen Merkmalen. Die genaue Natur des Verhältnisses (Antitypus, bewusste Abgrenzung, etc.) wird differenziert diskutiert, wobei die Komplexität der Fragestellung betont wird.
- Quote paper
- Thorsten Klasen (Author), 2005, Kudrun - bewusster "Antitypus" zum Nibelungenlied, "epigonaler Abklatsch" oder eigenständiges Epos?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/44403