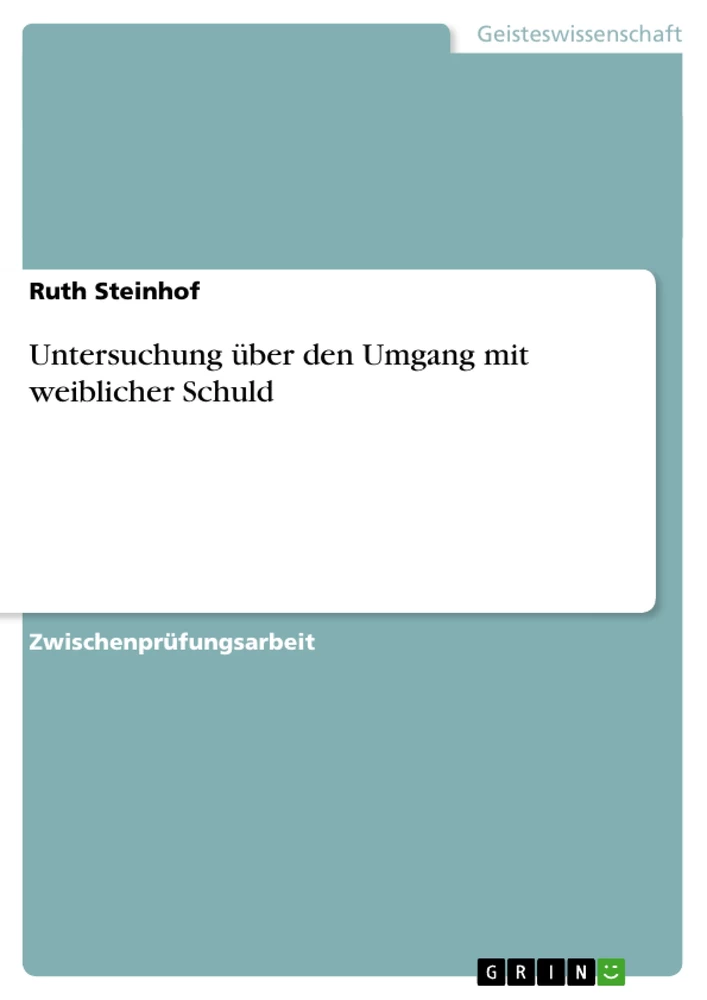Am 28. April 2004 wurden erstmals Fotos im US-Fernsehen veröffentlicht, die die Folterungen und Misshandlungen im irakischen Gefängnis Abu Ghraib dokumentieren. Auf vielen dieser Fotos ist die Soldatin Lynndie England deutlich zu erkennen. Offenbar hatte Lynndie England sich an den Misshandlungen irakischer Gefangener beteiligt.
Darin kann man den Anstoß für die weltweite Debatte über die Folterszenen im Irak begründet sehen. Der Empörung konnte kaum Einhalt geboten werden. Interessant scheint der Grund für das Unverständnis. Ist es eine Empörung aufgrund der generell erfolgten Misshandlungen, wie sie von mehreren US-Soldaten im Irak begangen wurden? Oder ist es eine Empörung, die sich in großem Maße der Abbildung einer Frau, die foltert widmet? Noch immer stößt die Vorstellung von gewaltfähigen und gewaltbereiten Frauen auf Unverständnis und Widerspruch. Durch Lynndie England wurde eine bereits sehr lang andauernde Debatte in der deutschen Frauenforschung wieder zu neuem Leben erweckt. Die Frage nach der Schuldhaftigkeit von Frauen.
Der Ursprung dieser Debatte ist schon in der frühen NS-Forschung begründet, die den Frauen im Nationalsozialismus keine für diesen bedeutende Rolle beimaßen und Frauen dementsprechend in ihre Betrachtungen nicht miteinbezogen. In den siebziger Jahren, nachdem man sich zunehmend der Rolle der Frauen bewusst wurde, suchte man lediglich nach Widerstandskämpferinnen und versuchte ausnahmslos das Bild der leidtragenden Frau als eine Art Überlebensarbeiterin zu prägen. Erst seit Mitte der achtziger Jahre sind Zweifel an dieser Freisprechung der Frauen von jeglicher Schuld deutlich geworden. Berechtigte Zweifel an einer möglichen „Gnade der weiblichen Geburt“. Stück für Stück versuchten Historikerinnen seither zu beweisen, dass es sich bei der Rolle der Frauen um eine zweidimensionale Rolle handelt. Sie waren nicht nur Opfer der nationalsozialistischen Politik, sondern machten auch andere zu Opfern. Es galt und gilt zu beweisen, dass die Täterrolle der Frauen keine Ausnahmeerscheinung war und ist. Diese Frage über die Täterschaft der Frauen während des Nationalsozialismus ging als „Historikerinnenstreit“ in die Literatur ein. Dabei geht der Historikerinnenstreit in seinen Konsequenzen bei weitem über den Nationalsozialismus hinaus. Seine tragenden Motive sind Klärungen bezüglich der Fragen nach Trennschärfe und noch vorhandener Tragfähigkeit der Geschlechterdifferenz.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Heide Oestreich schreibt über Lynndie England in der taz
- Die Opfer- Täter-Betrachtungen in der Frauenforschung
- Margarete Mitscherlich und ihre Theorie der weiblichen Täterschaft
- Karin Windaus-Walsers These der Täterschaft von Frauen
- allgemeine Kritik am Diskurs über die Täterschaft von Frauen
- Kritik an Margarete Mitscherlich
- Karin Windaus-Walsers These der weiblichen Täterschaft
- Resümee
- Das Milgram- Experiment
- Das Stanford-Prison-Experiment
- Anwendung der psychologischen Experimente
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit untersucht den Umgang mit weiblicher Schuld anhand des Falles Lynndie England, einer US-Soldatin, die an den Misshandlungen irakischer Gefangener in Abu Ghraib beteiligt war. Dabei wird der Artikel von Heide Oestreich in der taz über Lynndie England analysiert und in den Kontext der Opfer-Täter-Debatte in der Frauenforschung im Nationalsozialismus eingeordnet. Die Arbeit befasst sich mit den Theorien von Margarete Mitscherlich und Karin Windaus-Walser zur weiblichen Täterschaft und untersucht, ob diese Theorien mit der Darstellung Lynndie Englands in den Medien übereinstimmen. Abschließend werden die Theorien der Autorinnen mit psychologischen Experimenten, wie dem Milgram-Experiment und dem Stanford-Prison-Experiment, konfrontiert, um die Rolle der weiblichen Täterschaft im Kontext von Macht und Gehorsam empirisch zu beleuchten.
- Die Darstellung der weiblichen Täterschaft in den Medien
- Die Opfer-Täter-Debatte in der Frauenforschung im Nationalsozialismus
- Die Theorien von Margarete Mitscherlich und Karin Windaus-Walser zur weiblichen Täterschaft
- Die Anwendung psychologischer Experimente zur Erklärung weiblicher Täterschaft
- Die Rolle von Macht und Gehorsam in der Entstehung weiblicher Schuld
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt den Kontext der Arbeit vor und führt den Fall Lynndie England ein. Sie beleuchtet die Debatte um die Schuldhaftigkeit von Frauen, die durch die Veröffentlichung von Folterbildern aus Abu Ghraib wieder aufgeflammt ist. Kapitel 2 analysiert den Artikel von Heide Oestreich in der taz, der Lynndie England als Täterin, Instrument und Opfer darstellt. Kapitel 3 geht auf die Opfer-Täter-Betrachtungen in der Frauenforschung ein und stellt die Theorien von Margarete Mitscherlich und Karin Windaus-Walser zur weiblichen Täterschaft vor. Schließlich untersucht Kapitel 4 die Theorien der Autorinnen im Lichte psychologischer Experimente, um die Rolle der weiblichen Täterschaft im Kontext von Macht und Gehorsam zu beleuchten.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit den zentralen Themen der weiblichen Schuld, der Täterschaft von Frauen, der Opfer-Täter-Debatte in der Frauenforschung, den Theorien von Margarete Mitscherlich und Karin Windaus-Walser, dem Milgram-Experiment und dem Stanford-Prison-Experiment, Macht und Gehorsam sowie dem Einfluss der Medien auf die öffentliche Wahrnehmung von Frauen in der Rolle der Täterin.
Häufig gestellte Fragen
Wer ist Lynndie England und warum ist sie für die Forschung relevant?
Lynndie England ist eine US-Soldatin, die durch Folterbilder aus dem Abu-Ghraib-Gefängnis bekannt wurde. Ihr Fall entfachte die Debatte über weibliche Gewaltbereitschaft und Täterschaft neu.
Was war der „Historikerinnenstreit“ in der Frauenforschung?
Dabei ging es um die Frage, ob Frauen im Nationalsozialismus lediglich Opfer waren oder ob sie als aktive Täterinnen und Unterstützerinnen eine Mitschuld trugen.
Welche Theorie vertritt Margarete Mitscherlich zur weiblichen Täterschaft?
Mitscherlich untersuchte die psychologischen Hintergründe, warum Frauen in Gewaltstrukturen zu Täterinnen werden können, und brach mit dem Bild der rein „friedfertigen“ Frau.
Können psychologische Experimente wie das Milgram-Experiment weibliche Schuld erklären?
Ja, die Arbeit nutzt das Milgram- und das Stanford-Prison-Experiment, um zu zeigen, wie Machtstrukturen und Gehorsam unabhängig vom Geschlecht zu grausamem Verhalten führen können.
Was bedeutet die „Gnade der weiblichen Geburt“?
Dieser Begriff kritisiert die frühere Annahme, Frauen seien aufgrund ihres Geschlechts moralisch besser oder grundsätzlich unfähig zu politisch motivierten Verbrechen.
- Arbeit zitieren
- Ruth Steinhof (Autor:in), 2005, Untersuchung über den Umgang mit weiblicher Schuld, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/44409