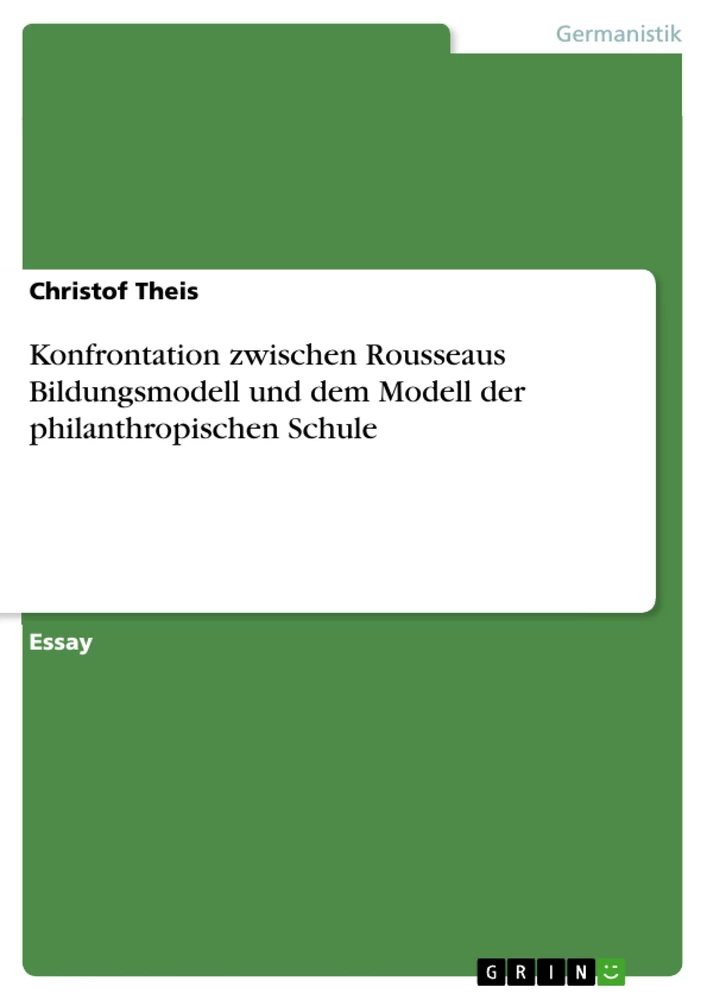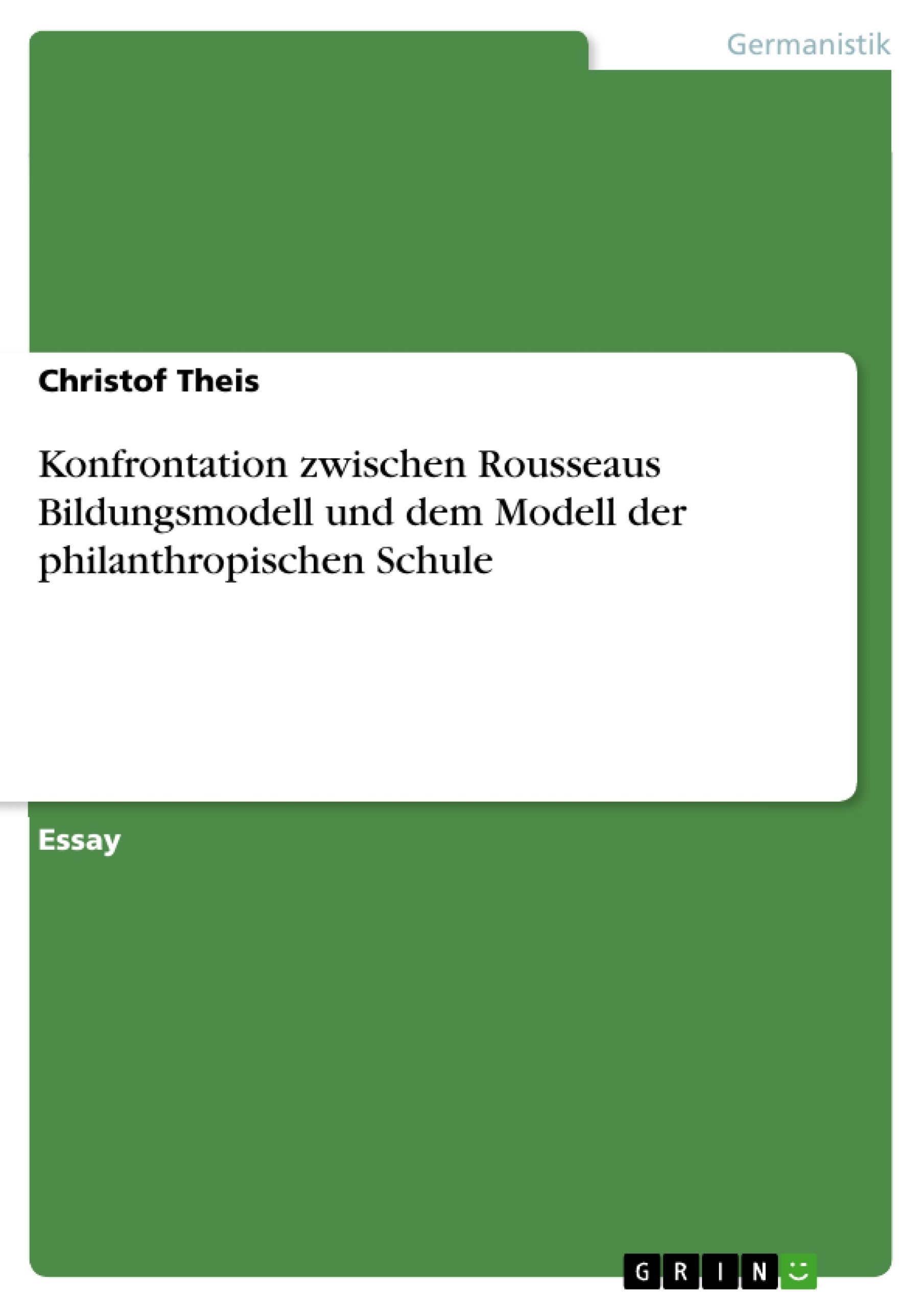Literarische Bildungsmodelle und Erziehungskonzepte sind keine Erfindung des 20. Jahrhunderts und der heutigen Schulreformen. Bereits im 18. Jahrhundert kommt es zur Etablierung verschiedener Konzeptionen, die sich mit dem Bereich des Zöglings und dessen Erziehung beschäftigen. Ein zentraler Aspekt, der sich in dieser Zeit herausspiegelt und oftmals für Debatten sorgt ist das Motiv der Phantasie und dessen Einfluss auf das zu erziehende Kind. Dieses Vermögen der Einbildungskraft wirkt nicht nur im Rahmen der Philosophie, sondern findet besonders Einzug in die Literatur. Dabei findet insbesondere die Pädagogik Interesse an der Einbildungskraft und deren Einwirkung auf dem Bereich der Psychologie und der Moral. Wie bereits erwähnt ist das Konzept Literatur-Phantasie, beziehungsweise Phantasie-Pädagogik, von besonderer Ambivalenz geprägt. Zum einen
Rousseaus Modell des naturgeprägten Individuums und der Verzicht auf das Kollektiv. Auf der anderen Seite die Schule der Philanthropen und das Konzept von kindlicher Erziehung als Spezialisierung und Ausrichtung auf gesellschaftliche Konventionen. Inwiefern kommt es zu einer Unterscheidung zwischen diesen beiden Konzepten und welche Parallelen zeigen sich auf? Ist dieses Modell effektiv oder ergibt sich ein Defizit?
Inhaltsverzeichnis
- Konfrontation zwischen Rousseaus Bildungsmodell und dem Modell der philanthropischen Schule
- Rousseaus Modell der natürlichen Erziehung
- Das Konzept der philanthropischen Schule
- Literarische Bildungsmodelle: Rousseau vs. Philanthropen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Dieser Essay analysiert und vergleicht die Bildungsmodelle von Jean-Jacques Rousseau und der philanthropischen Schule. Der Fokus liegt auf der Auseinandersetzung mit der Frage, wie diese beiden Konzepte die Rolle der Phantasie in der Erziehung verstehen und wie sie sich in ihrer Herangehensweise an die Bildung des Menschen unterscheiden.
- Die Rolle der Phantasie in der Erziehung
- Natur vs. Gesellschaft: Konzepte der kindlichen Entwicklung
- Autonomie vs. Spezialisierung: Ziele und Methoden der Erziehung
- Literarische Modelle und deren Einfluss auf die pädagogische Praxis
- Die Bedeutung von Arbeit und gesellschaftlicher Funktion
Zusammenfassung der Kapitel
Der Essay beginnt mit einer Einführung in die Konzepte der natürlichen Erziehung bei Rousseau und der philanthropischen Schule. Dabei werden die unterschiedlichen Sichtweisen auf die Rolle der Phantasie und die Bedeutung der Einbildungskraft in der Erziehung hervorgehoben. Rousseau plädiert für eine natürliche Erziehung, die das Kind von jeglicher gesellschaftlichen Korruption fernhält und die Entwicklung von Autonomie und Selbstständigkeit fördert. Im Gegensatz dazu setzt die philanthropische Schule auf eine Erziehung, die sich an den Anforderungen der Gesellschaft orientiert und den Weg zum Bürgerlichen Berufsleben ebnet.
Der Essay beleuchtet dann detailliert Rousseaus Bildungsmodell, das in seinem Werk "Émil oder über die Erziehung" veranschaulicht wird. Rousseau stellt dabei den jungen Émil in den Mittelpunkt, der in der Natur erzogen wird, fern von gesellschaftlichen Einflüssen. Im Mittelpunkt steht die Bildung von Tugenden und die Fähigkeit zur unabhängigen Lebensführung.
Im weiteren Verlauf des Essays wird die philanthropische Schule näher betrachtet. Es wird gezeigt, wie die Philanthropen, im Unterschied zu Rousseau, zwei Phasen in der Erziehung des Menschen unterscheiden: die kindliche Erfahrung und die Ausbildung auf eine spezialisierte Arbeitsfunktion. Der Essay beleuchtet auch die Rolle von literarischen Modellen in den beiden Bildungskonzepten. Während Rousseau der Phantasie kritisch gegenübersteht, sehen die Philanthropen sie als Mittel zur Einübung bürgerlicher Normen und Werte.
Schlüsselwörter
Natürliche Erziehung, Philanthropische Schule, Phantasie, Einbildungskraft, Autonomie, Spezialisierung, Gesellschaft, Bildung, Literatur, Moral, Tugenden, Arbeit, Berufsbildung, Rousseau, Basedow, Salzmann, Campe, Robinson Crusoe.
Häufig gestellte Fragen
Was ist der Hauptunterschied zwischen Rousseaus Erziehung und der philanthropischen Schule?
Rousseau setzt auf eine natürliche Erziehung fern der Gesellschaft zur Förderung von Autonomie, während die Philanthropen das Kind gezielt auf gesellschaftliche Konventionen und Berufe vorbereiten.
Welche Rolle spielt die Phantasie in diesen Modellen?
Rousseau steht der Phantasie kritisch gegenüber, da sie von der Natur wegführen kann, während Philanthropen sie als Mittel zur Einübung bürgerlicher Normen nutzen.
Wer ist "Émil" in Rousseaus Werk?
Émil ist der fiktive Zögling in Rousseaus Hauptwerk zur Pädagogik, der beispielhaft in der Natur und isoliert von schädlichen gesellschaftlichen Einflüssen erzogen wird.
Was ist das Ziel der philanthropischen Erziehung?
Das Ziel ist die Ausbildung einer spezialisierten Arbeitsfunktion und die erfolgreiche Integration in das bürgerliche Berufsleben.
Welche Autoren gehören zur Schule der Philanthropen?
Genannt werden unter anderem Basedow, Salzmann, Campe und deren Auseinandersetzung mit literarischen Vorbildern wie Robinson Crusoe.
- Quote paper
- Christof Theis (Author), 2014, Konfrontation zwischen Rousseaus Bildungsmodell und dem Modell der philanthropischen Schule, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/444710