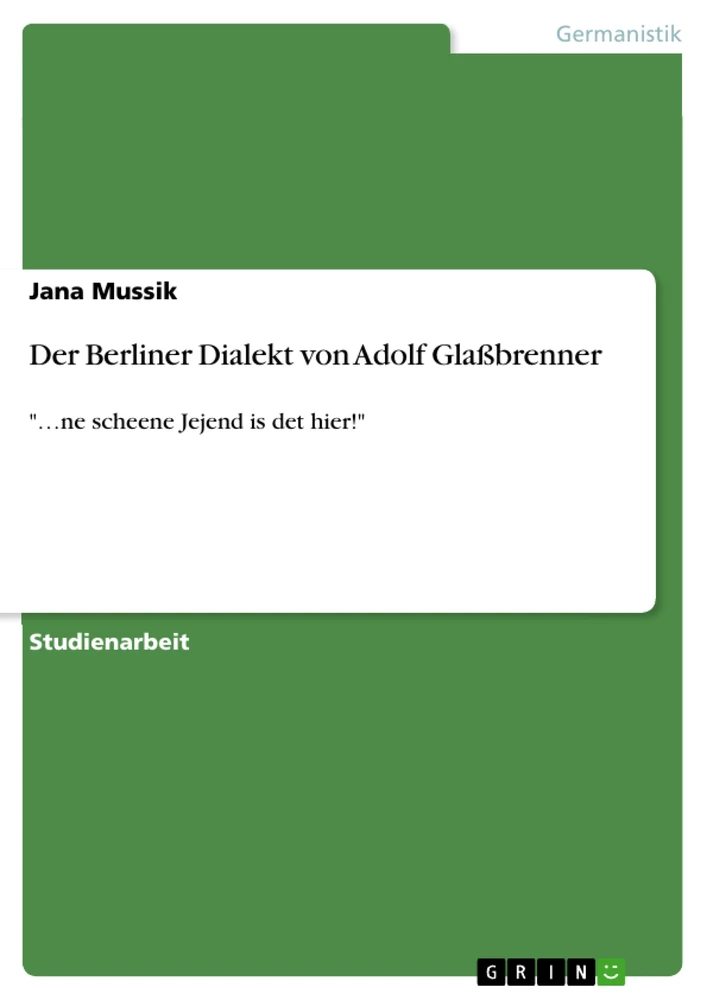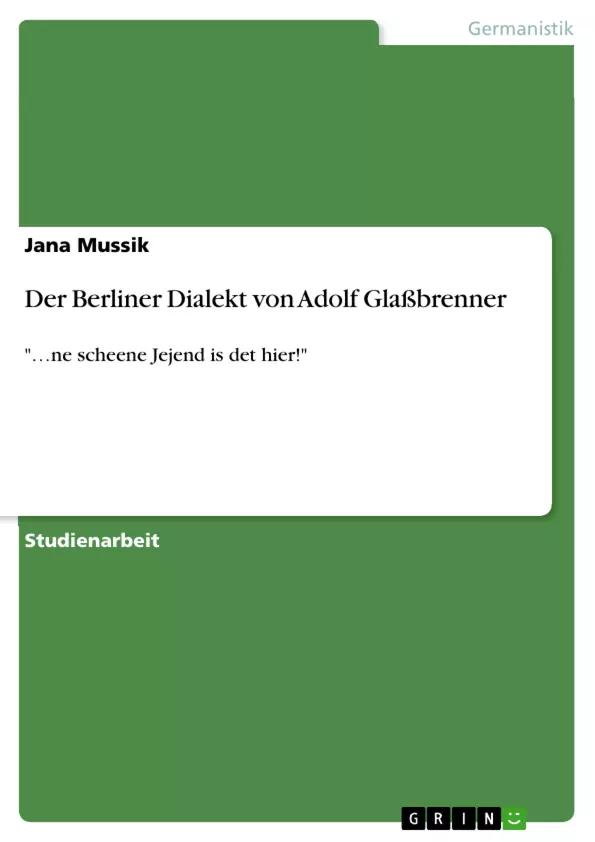Adolf Glaßbrenner gilt als ein Mann des Volkes und als dieser sprach er auch mit der Stimme des Volkes. Glaßbrenner stammte aus Berlin und verfasste beinahe alle seine Zeitschriften, Magazine und Theaterstücke in seiner Sprache.
Im Rahmen dieser Arbeit sollen die phonetisch-phonologischen Variationen der Sprache im Vergleich mit dem Hochdeutschen untersucht werden. Auch grammatikalische Varianten, wie die Kasusbildung und die Verwendung von Verben sollen einer genaueren Betrachtung unterzogen werden. Zuletzt sollen der Wortschatz selbst, die Umgangssprache und die Verwendung von Fremdwörtern eingeordnet werden. Da es sich bei dem ausgewählten Textbeispiel um ein Werk aus dem 19. Jahrhundert handelt, können die sprachlichen Auffälligkeiten nicht mit dem Standard der Gegenwart verglichen werden. Stattdessen musste als Vergleichswert eine Beschreibung des Berliner Dialektes aus eben jener Zeit herangezogen werden.
Derartige wissenschaftliche Untersuchungen sind jedoch sehr rar, weshalb nur sehr wenig Sekundärliteratur verwendet werden konnte. Diese Hausarbeit soll die Berliner Sprache nach Adolf Glaßbrenner untersuchen und die Frage beantworten, ob es sich dabei um den Originalton des Berlinischen handeln könnte oder ob es eher eine verzerrte, gar groteske Abbildung eines klischeebesetzten Dialektes wiedergibt.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- 1. Adolf Glaẞbrenner - Leben und Werk
- 2. Der Berliner Dialekt
- 3. Analyse Textbeispiel – Glaẞbrenners Brief eines Berliner Schustergesellen
- 3.1 Phonetisch-phonologische Variationen - Vokale
- 3.2 Phonetisch-phonologische Variationen - Konsonanten
- 3.3 Grammatikalische Variationen
- 3.4 Wortschatz
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht den Berliner Dialekt in den Werken von Adolf Glaßbrenner. Ziel ist es, die sprachlichen Besonderheiten seiner Texte zu analysieren und zu bewerten, inwieweit diese den Originalton des Berlinischen widerspiegeln oder eher eine stilisierte Darstellung darstellen. Die Analyse umfasst phonetisch-phonologische, grammatikalische und lexikalische Aspekte.
- Das Leben und Werk Adolf Glaßbrenners
- Charakteristika des Berliner Dialekts im 19. Jahrhundert
- Phonetisch-phonologische Variationen im Vergleich zum Hochdeutschen
- Grammatikalische Besonderheiten des Berliner Dialekts bei Glaßbrenner
- Lexikalische Analyse: Wortschatz, Umgangssprache und Fremdwörter
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema der Hausarbeit ein und beschreibt den Fokus auf die Werke Adolf Glaßbrenners und die Analyse seines Berliner Dialekts. Es werden die Forschungsfragen vorgestellt, die sich mit der Authentizität und der möglichen Stilisierung des Dialekts in Glaßbrenners Texten auseinandersetzen. Die methodischen Herausforderungen, insbesondere die Knappheit an vergleichbarer Sekundärliteratur aus der relevanten Zeitperiode, werden ebenfalls angesprochen.
1. Adolf Glaẞbrenner - Leben und Werk: Dieses Kapitel präsentiert eine Biografie Adolf Glaßbrenners, die seinen Werdegang von seiner Geburt in Berlin bis zu seinen ersten Veröffentlichungen beleuchtet. Es wird sein soziales Umfeld und seine gesellschaftliche Position im 19. Jahrhundert beschrieben, sowie sein Engagement als Schriftsteller und Publizist und seine Rolle als kritischer Beobachter der damaligen Zeit. Der Text betont seinen Status als „Mann des Volkes“ und dessen Reflexion in seinem literarischen Werk. Die Verwendung von Zitaten und Quellen aus dem Stapp Verlag unterstreicht die Bedeutung seiner Arbeit für die deutsche Literatur.
2. Der Berliner Dialekt: (Leider ist im vorliegenden Text kein Kapitel 2 vorhanden, deshalb kann hier keine Zusammenfassung erstellt werden.)
3. Analyse Textbeispiel – Glaẞbrenners Brief eines Berliner Schustergesellen: Dieses Kapitel analysiert ein konkretes Textbeispiel, einen Brief eines Berliner Schustergesellen, um die sprachlichen Besonderheiten von Glaßbrenners Berliner Dialekt zu untersuchen. Die Analyse umfasst phonetisch-phonologische Variationen von Vokalen und Konsonanten, grammatikalische Abweichungen vom Hochdeutschen (Kasusbildung und Verbgebrauch) sowie eine lexikalische Untersuchung des Wortschatzes, der Umgangssprache und der Verwendung von Fremdwörtern. Die Analyse wird im Kontext des Berliner Dialekts des 19. Jahrhunderts betrachtet und die Herausforderungen bei der Verwendung von vergleichenden Daten aus dieser Zeit erläutert.
Schlüsselwörter
Adolf Glaßbrenner, Berliner Dialekt, 19. Jahrhundert, Sprachvariation, Phonetik, Phonologie, Grammatik, Lexik, Hochdeutsch, Mundartliteratur, Gesellschaftliche Kritik.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Analyse des Berliner Dialekts bei Adolf Glaßbrenner
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit analysiert den Berliner Dialekt in den Werken von Adolf Glaßbrenner. Der Fokus liegt auf der Untersuchung der sprachlichen Besonderheiten in seinen Texten und der Frage, inwieweit diese den Originalton des Berlinischen widerspiegeln oder eine stilisierte Darstellung darstellen. Die Analyse umfasst phonetisch-phonologische, grammatikalische und lexikalische Aspekte.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt das Leben und Werk Adolf Glaßbrenners, die Charakteristika des Berliner Dialekts im 19. Jahrhundert, phonetisch-phonologische Variationen im Vergleich zum Hochdeutschen, grammatikalische Besonderheiten des Berliner Dialekts bei Glaßbrenner und eine lexikalische Analyse (Wortschatz, Umgangssprache, Fremdwörter).
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit beinhaltet eine Einleitung, ein Kapitel über das Leben und Werk Adolf Glaßbrenners, ein Kapitel zum Berliner Dialekt (leider unvollständig im vorliegenden Text), eine detaillierte Analyse eines Textbeispiels (Brief eines Berliner Schustergesellen) mit Unterkapiteln zu phonetisch-phonologischen Variationen (Vokale und Konsonanten), grammatikalischen Variationen und dem Wortschatz, sowie ein Fazit.
Wie wird der Berliner Dialekt in der Analyse untersucht?
Die Analyse des Berliner Dialekts erfolgt anhand eines konkreten Textbeispiels – einem Brief eines Berliner Schustergesellen. Die Untersuchung umfasst die phonetisch-phonologischen Variationen (Vergleich von Vokalen und Konsonanten mit dem Hochdeutschen), grammatikalische Abweichungen vom Hochdeutschen (z.B. Kasusbildung und Verbgebrauch) und eine lexikalische Analyse des verwendeten Wortschatzes, der Umgangssprache und Fremdwörter. Die Herausforderungen bei der Verwendung von vergleichenden Daten aus dem 19. Jahrhundert werden ebenfalls thematisiert.
Welche Methodik wird angewendet?
Die Arbeit verwendet eine textbasierte Analyse eines ausgewählten Textbeispiels von Adolf Glaßbrenner. Dabei werden phonetisch-phonologische, grammatikalische und lexikalische Merkmale des Berliner Dialekts im Vergleich zum Hochdeutschen untersucht. Die methodischen Herausforderungen, insbesondere die Knappheit an vergleichbarer Sekundärliteratur aus der relevanten Zeitperiode, werden in der Einleitung angesprochen.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Adolf Glaßbrenner, Berliner Dialekt, 19. Jahrhundert, Sprachvariation, Phonetik, Phonologie, Grammatik, Lexik, Hochdeutsch, Mundartliteratur, Gesellschaftliche Kritik.
Gibt es eine Zusammenfassung der einzelnen Kapitel?
Ja, die HTML-Datei enthält Zusammenfassungen der Einleitung, des Kapitels über das Leben und Werk Adolf Glaßbrenners und des Kapitels zur Analyse des Textbeispiels. Eine Zusammenfassung des Kapitels über den Berliner Dialekt fehlt aufgrund von unvollständigen Daten im vorliegenden Text.
Welches Ziel verfolgt die Arbeit?
Ziel der Arbeit ist es, die sprachlichen Besonderheiten in den Texten Adolf Glaßbrenners zu analysieren und zu bewerten, inwieweit diese den Originalton des Berlinischen widerspiegeln oder eher eine stilisierte Darstellung darstellen.
- Quote paper
- Jana Mussik (Author), 2014, Der Berliner Dialekt von Adolf Glaßbrenner, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/444913