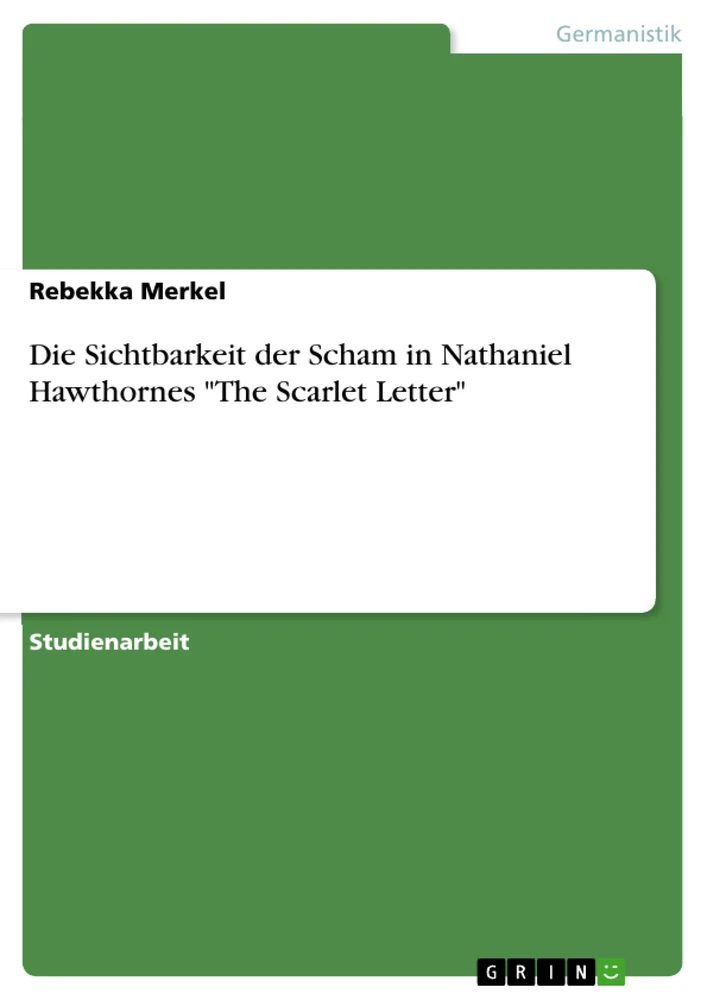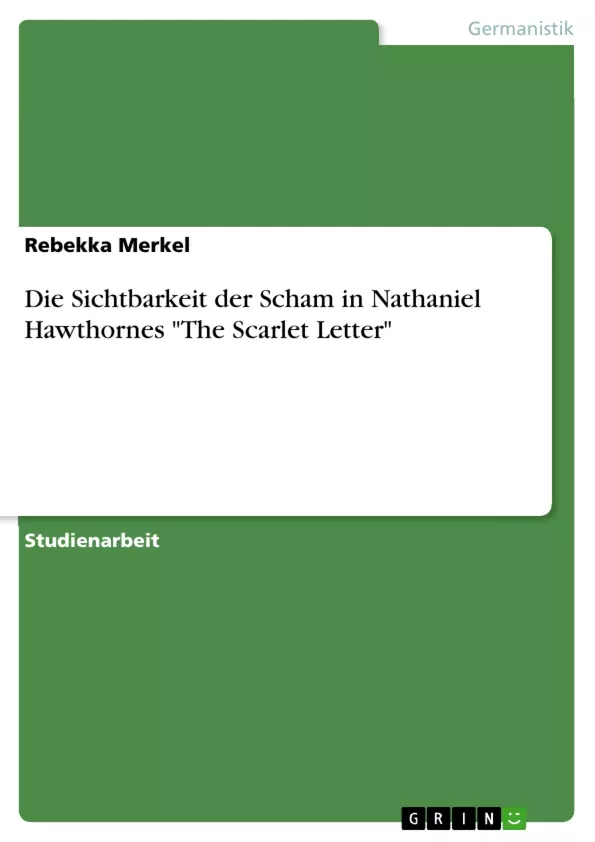Scham spielt in der literarischen Forschung nur eine untergeordnete Rolle, obwohl sie häufig Erwähnung findet. Doch die Scham bzw. der sich Schämende verbergen sich und sind somit schwer auszumachen. In dieser Arbeit zu "The Scarlet Letter" soll dies aber genauer untersucht werden.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Das Konzept der Scham
- Die Handlung in „The Scarlet Letter“
- Scham und ihre Sichtbarkeit im Roman
- Der scharlachrote Buchstabe als Zeichen der Scham
- Pearl, das Kind der Scham und die Abwesenheit des Schamgefühls
- Minister Dimmesdale und die verborgene Scham
- Scham und Religion
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Darstellung von Scham in Nathaniel Hawthornes „The Scarlet Letter“. Ziel ist es, die Sichtbarkeit von Scham im Roman herauszuarbeiten und die damit verbundenen Charakteristika zu analysieren. Dabei wird der Einfluss gesellschaftlicher Konventionen und religiöser Aspekte auf das Schamempfinden der Figuren beleuchtet.
- Das Konzept der Scham als Affekt und seine Bedeutung für die menschliche Psyche
- Die Darstellung von Scham im öffentlichen und privaten Raum in „The Scarlet Letter“
- Die Rolle von religiösen Überzeugungen im Kontext des Schamempfindens
- Die verschiedenen Ausdrucksformen von Scham bei den Romanfiguren
- Der Wandel gesellschaftlicher Konventionen im Umgang mit Scham
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema der Scham in der Literatur ein und hebt die bisherige Forschungslücke bezüglich dieses Affekts hervor. Sie erläutert die Zielsetzung der Arbeit, welche darin besteht, die Sichtbarkeit der Scham in Hawthornes „The Scarlet Letter“ zu analysieren und die verschiedenen Darstellungsformen zu untersuchen. Die besondere Rolle der Religion im Kontext des Schamempfindens wird ebenfalls als wichtiger Aspekt der Analyse genannt. Die Arbeit fokussiert auf die öffentliche Sichtbarkeit von Scham, ein Aspekt, der in literarischen Werken oft weniger prominent dargestellt wird.
Das Konzept der Scham: Dieses Kapitel befasst sich mit dem Konzept der Scham als essentiellem menschlichen Gefühl. Es werden verschiedene Perspektiven auf die Scham aus literaturwissenschaftlicher und psychoanalytischer Sicht präsentiert, wobei die Ambivalenz im Umgang mit Scham in verschiedenen Epochen und Kulturen hervorgehoben wird. Die Autoren Hilgers, Greiner und Pontzen werden zitiert, um die Bedeutung von Scham für die menschliche Moral und die Entwicklung des Selbstbewusstseins zu verdeutlichen. Der etymologische Ursprung des Wortes „Scham“ und dessen Verbindung zum Verbergen und Verstecken wird ebenfalls diskutiert. Die enge Beziehung zwischen Scham und Erkenntnis wird durch den Bezug auf die Genesis-Erzählung von Adam und Eva hergestellt.
Die Handlung in „The Scarlet Letter“: Diese Kapitel bietet eine kurze Zusammenfassung der Handlung von „The Scarlet Letter“, um den Kontext für die anschließende Analyse der Scham-Darstellung zu schaffen. Es liefert eine Übersicht über die wichtigsten Ereignisse und Charaktere des Romans, um das Verständnis der folgenden Kapitel zu erleichtern und die Grundlage für die detaillierte Betrachtung der Scham als zentrales Thema zu legen. Ohne ins Detail zu gehen, legt es die erzählerischen Grundlagen dar, die für die Interpretation der Scham-Darstellung unerlässlich sind.
Scham und ihre Sichtbarkeit im Roman: Dieses Kapitel analysiert die Darstellung von Scham in „The Scarlet Letter“ aus verschiedenen Perspektiven. Es untersucht den scharlachroten Buchstaben als sichtbares Zeichen der Scham, die Rolle von Pearl als Kind der Scham, den Umgang des Ministers Dimmesdale mit seiner verborgenen Scham und den Einfluss der Religion auf das Schamempfinden der Figuren. Die verschiedenen Kapitel (4.1-4.4) werden hier zusammenfassend behandelt, um die verschiedenen Facetten der Scham im Roman ganzheitlich zu präsentieren und deren Zusammenhänge darzulegen.
Schlüsselwörter
Scham, Nathaniel Hawthorne, The Scarlet Letter, Literaturwissenschaft, Affekt, Religion, Moral, Gesellschaft, Sichtbarkeit, Verborgenheit, Öffentlichkeit, Charakteranalyse.
Häufig gestellte Fragen zu „The Scarlet Letter“: Scham und ihre Sichtbarkeit
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit analysiert die Darstellung von Scham in Nathaniel Hawthornes Roman „The Scarlet Letter“. Der Fokus liegt auf der Sichtbarkeit von Scham und deren verschiedenen Ausdrucksformen bei den Romanfiguren im Kontext gesellschaftlicher Konventionen und religiöser Einflüsse.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt das Konzept der Scham als Affekt, die Darstellung von Scham im öffentlichen und privaten Raum, die Rolle religiöser Überzeugungen im Zusammenhang mit Scham, die verschiedenen Ausdrucksformen von Scham bei den Figuren (z.B. Hester Prynne mit dem scharlachroten Buchstaben, Pearl, Dimmesdale) und den Wandel gesellschaftlicher Konventionen im Umgang mit Scham.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, ein Kapitel zum Konzept der Scham, ein Kapitel zur Handlung von „The Scarlet Letter“, ein Kapitel zur Analyse der Scham-Darstellung im Roman (mit Unterkapiteln zum scharlachroten Buchstaben, Pearl, Dimmesdale und Scham und Religion) und ein Fazit.
Wie wird die Scham im Roman dargestellt?
Die Scham wird auf verschiedene Weisen dargestellt: Der scharlachrote Buchstabe ist ein sichtbares Zeichen der Scham für Hester Prynne. Pearl, als Tochter der Sünde, repräsentiert die Scham, aber auch deren Abwesenheit. Dimmesdales verborgene Scham wird durch seine innere Zerrissenheit und sein Leiden deutlich. Die Religion spielt eine zentrale Rolle im Umgang mit Scham und beeinflusst das Schamempfinden der Figuren stark.
Welche Quellen werden verwendet?
Die Arbeit bezieht sich auf literaturwissenschaftliche und psychoanalytische Perspektiven auf Scham. Die Autoren Hilgers, Greiner und Pontzen werden zitiert, um die Bedeutung von Scham für die menschliche Moral und die Entwicklung des Selbstbewusstseins zu verdeutlichen. Die Genesis-Erzählung von Adam und Eva wird als Bezugspunkt für die enge Beziehung zwischen Scham und Erkenntnis verwendet.
Was ist das Ziel der Arbeit?
Das Ziel der Arbeit ist es, die Sichtbarkeit von Scham in „The Scarlet Letter“ herauszuarbeiten und die damit verbundenen Charakteristika zu analysieren. Es soll der Einfluss gesellschaftlicher Konventionen und religiöser Aspekte auf das Schamempfinden der Figuren beleuchtet werden.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt?
Schlüsselwörter sind: Scham, Nathaniel Hawthorne, The Scarlet Letter, Literaturwissenschaft, Affekt, Religion, Moral, Gesellschaft, Sichtbarkeit, Verborgenheit, Öffentlichkeit, Charakteranalyse.
Welche Forschungslücke wird geschlossen?
Die Einleitung hebt eine Forschungslücke bezüglich der Sichtbarkeit von Scham in literarischen Werken hervor. Die Arbeit fokussiert sich auf die öffentliche Sichtbarkeit von Scham, ein Aspekt, der in der Literatur oft weniger prominent dargestellt wird.
- Citar trabajo
- B.A. of Arts Rebekka Merkel (Autor), 2016, Die Sichtbarkeit der Scham in Nathaniel Hawthornes "The Scarlet Letter", Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/446485