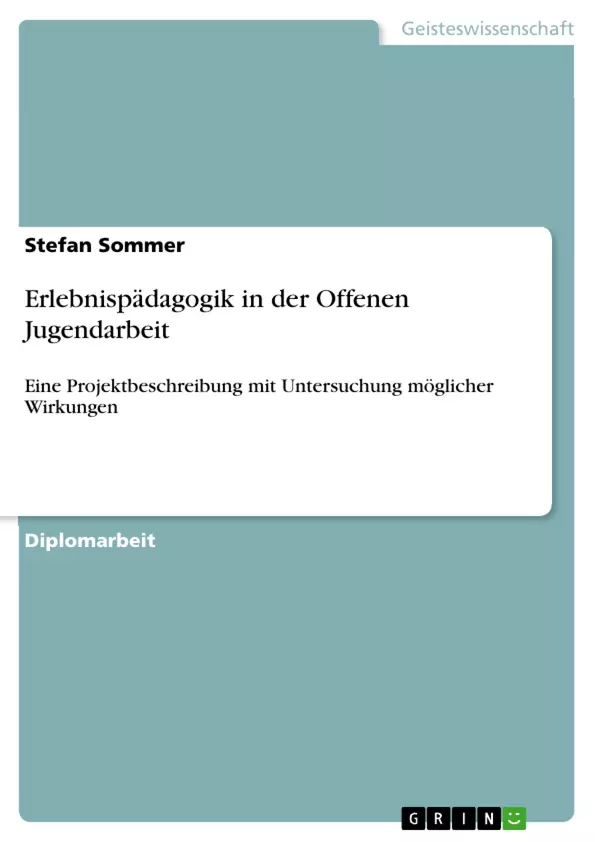„Auch die längste Reise beginnt mit dem ersten Schritt“
Chinesisches Sprichwort
Die inhaltliche Bedeutung dieser Worte erschließt sich mir in Bezug auf das Thema dieser Diplomarbeit auf zweierlei Weise.
Zum Einen ist eine Untersuchung von Erlebnispädagogik - Projekten im Rahmen der Offenen Jugendarbeit in der Vergangenheit kaum versucht worden, obwohl erlebnispädagogische Aktionen als neuartiger und moderner „Weg zur Jugend“ gerade in der Offenen Jugendarbeit in den letzten Jahren immer mehr an Raum gewonnen haben. Die wissenschaftliche Forschung und somit auch der Nachweis der Wirksamkeit und Sinnhaftigkeit solcher Projekte steht aber noch nahezu aus. Diese Arbeit soll nun ein kleiner Schritt auf dem Weg in diese Richtung sein.
Auf der anderen Seite erhält das obige Zitat Bedeutung für die Frage nach dem Sinn der Durchführung von Erlebnispädagogik - Projekten in der Offenen Jugendarbeit: Kann durch diese handlungsorientierte Methode in diesem Bereich etwas bewirkt werden und wenn ja, wie groß ist dann das Ausmaß der festgestellten Veränderungen? Sind nicht auch kleine, unbedeutend wirkende Schritte in der Entwicklung eines Jugendlichen ein Teil des Weges oder vielleicht sogar der Anstoß zu größeren Veränderungen?
Die Gesamtheit dieser Überlegungen war für mich ein wichtiges Entscheidungskriterium für den Entschluß, mich im Rahmen dieser Arbeit mit der Frage nach den Wirkungen der „Erlebnispädagogik in der Offenen Jugendarbeit“ zu beschäftigen.
In meiner Diplomarbeit versuche ich, die soeben beschriebene Fragestellung anhand der Beschreibung eines erlebnispädagogischen Projektes im Rahmen der Arbeit des offenen Jugendzentrums „Haus um die Ecke“ in Erfurt und einer anschließenden Untersuchung der dabei auftretenden Wirkungen zu ergründen. Bisher sind in diesem speziellen Gebiet nur wenige Forschungsversuche unternommen worden. Die gewählte Form dieser Projektuntersuchung kann durch die Beschränkung auf nur einen „Untersuchungsfall“ sicherlich nur bedingt allgemeingültige Ergebnisse erbringen. Sie könnte aber aufzeigen, ob Wirkungsmöglichkeiten für das Arbeitsfeld „Erlebnispädagogik in der Offenen Jugendarbeit“ existieren, welcher Art sie in diesem speziellen Fall sind und welche Form der Durchführung für ein praktisches Projekt in diesem Bereich sinnvoll sein kann. Des Weiteren könnte durch diese Arbeit vielleicht sogar ein Anstoß zu weiteren Beschäftigungen mit diesem wichtigen Thema gegeben werden!
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Überblick über die zentralen Arbeitsbegriffe
- 2.1. Was ist Erlebnispädagogik?
- 2.1.1. Vom Erleben zum Lernen
- 2.1.2. Versuch einer Definition des Begriffes „Erlebnispädagogik“
- 2.1.3. Geschichte der Erlebnispädagogik
- 2.1.4. Erlebnispädagogik als moderne pädagogische Konzeption
- 2.1.5. Anwendungsgebiete der Erlebnispädagogik
- 2.2. Was ist Offene Jugendarbeit?
- 2.2.1. Gesetzliche Grundlagen
- 2.2.2. Annäherung an den Begriff der Offenen Jugendarbeit
- 2.2.3. Geschichte der Offenen Jugendarbeit nach 1945
- 2.2.4. Formen und Methoden der Offenen Jugendarbeit
- 2.2.5. Verschiedene pädagogische Ansätze von 1945 bis heute
- 2.2.6. Perspektiven der Offenen Jugendarbeit
- 2.1. Was ist Erlebnispädagogik?
- 3. Zielstellungen
- 3.1. Ziele der Erlebnispädagogik
- 3.2. Ziele der Offenen Jugendarbeit
- 3.3. Vergleich der Ziele von Offener Jugendarbeit und Erlebnispädagogik
- 4. Erlebnispädagogik in der Offenen Jugendarbeit in Geschichte und Gegenwart
- 5. Das Erlebnispädagogik - Projekt im „Haus um die Ecke“
- 5.1. Die Situation im Vorfeld des Projektes
- 5.1.1. Das Wohnumfeld
- 5.1.2. Das „Haus um die Ecke“ als Angebot der Offenen Jugendarbeit
- 5.1.3. Die Besucherstruktur
- 5.1.4. Zusammensetzung und Situation der beteiligten Jugendgruppe
- 5.2. Konzeption und Verlauf des Projektes
- 5.2.1. Ziele
- 5.2.2. Planung der Projekteinheiten
- 5.2.3. Verlauf der Aktivitäten
- 5.2.3.1. Das Vorbereitungstreffen
- 5.2.3.2. Einzelaktionen des Projektes
- 5.2.3.3. Die Wochenendkurse
- 5.2.3.4. Das Nachbereitungstreffen
- 5.3. Weiterführende Aktivitäten
- 5.1. Die Situation im Vorfeld des Projektes
- 6. Untersuchung der Wirkungen im Rahmen des Projektes
- 6.1. Problemstellung und Strategie der Untersuchung
- 6.2. Warum eine qualitative Untersuchung?
- 6.3. Die Einzelfallstudie
- 6.4. Die teilnehmende Beobachtung
- 6.4.1. Inhaltliche Merkmale
- 6.4.2. Praktische Umsetzung im Projektverlauf
- 6.4.3. Protokollierung
- 6.4.4. Auswertung
- 6.4.5. Zusammenfassung der wichtigsten Erkenntnisse
- 6.4.6. Schlußfolgerungen
- 6.5. Das problemzentrierte Experteninterview
- 6.5.1. Die inhaltlichen Merkmale
- 6.5.2. Die Datenerhebung
- 6.5.3. Vorbereitung und Durchführung
- 6.5.4. Die Auswertung
- 6.5.5. Zusammenfassung der wichtigsten Aussagen und Ergebnisse
- 6.5.6. Schlußfolgerungen
- 6.6. Ergebnisse der Untersuchung
- 7. Darstellung der Ergebnisse anderer Untersuchungen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Wirkungen von Erlebnispädagogik-Projekten in der Offenen Jugendarbeit. Ziel ist es, einen Beitrag zur noch weitgehend fehlenden wissenschaftlichen Forschung in diesem Bereich zu leisten und die Wirksamkeit solcher Projekte zu belegen. Die Arbeit analysiert ein konkretes Projekt und untersucht dessen Auswirkungen auf die beteiligten Jugendlichen.
- Wirksamkeit von Erlebnispädagogik in der Offenen Jugendarbeit
- Methodische Ansätze zur Untersuchung der Projekt-Wirkungen
- Analyse eines konkreten Erlebnispädagogik-Projekts
- Vergleich der Ziele von Erlebnispädagogik und Offener Jugendarbeit
- Bedeutung von Erlebnispädagogik im Kontext veränderter Jugendwelten
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema der Diplomarbeit ein und begründet die Relevanz der Untersuchung von Erlebnispädagogik-Projekten in der Offenen Jugendarbeit. Sie verweist auf die bisher fehlende wissenschaftliche Auseinandersetzung mit diesem Thema und betont die Bedeutung kleiner Schritte im Entwicklungsprozess von Jugendlichen. Die Einleitung skizziert zudem den Wandel in der Definition von Jugend und den damit einhergehenden Herausforderungen für die Jugendarbeit.
2. Überblick über die zentralen Arbeitsbegriffe: Dieses Kapitel definiert die zentralen Begriffe „Erlebnispädagogik“ und „Offene Jugendarbeit“. Es beleuchtet die Geschichte, die pädagogischen Konzepte und die Anwendungsgebiete beider Bereiche. Der Fokus liegt auf der Darstellung der theoretischen Grundlagen und der jeweiligen Entwicklung im Laufe der Zeit, um den Kontext des Projekts im „Haus um die Ecke“ zu verdeutlichen.
3. Zielstellungen: Dieses Kapitel beschreibt die Ziele der Erlebnispädagogik und der Offenen Jugendarbeit und vergleicht diese miteinander. Es legt die Grundlage für die Bewertung der Wirksamkeit des im Fokus stehenden Projektes, indem es die angestrebten Ziele beider Bereiche gegenüberstellt und Gemeinsamkeiten sowie Unterschiede aufzeigt. Der Vergleich schafft ein klares Verständnis der Messlatte für den Erfolg des Projekts.
4. Erlebnispädagogik in der Offenen Jugendarbeit in Geschichte und Gegenwart: Dieses Kapitel beleuchtet den historischen Kontext und die aktuelle Bedeutung von Erlebnispädagogik in der Offenen Jugendarbeit. Es liefert einen Überblick über die Entwicklungen und den wechselseitigen Einfluss beider Bereiche, um das Projekt im „Haus um die Ecke“ in seinen zeitgeschichtlichen und pädagogischen Kontext einzuordnen und zu bewerten.
5. Das Erlebnispädagogik - Projekt im „Haus um die Ecke“: Dieses Kapitel beschreibt das konkrete Projekt im „Haus um die Ecke“, inklusive der Ausgangssituation, der Konzeption und des Projektverlaufs. Es erläutert die Ziele, die Planung, den Ablauf der einzelnen Aktivitäten (Vorbereitungstreffen, Einzelaktionen, Wochenendkurse, Nachbereitungstreffen) und die daran anschließenden Aktivitäten. Es gibt eine detaillierte Beschreibung des Settings und der beteiligten Jugendlichen.
Schlüsselwörter
Erlebnispädagogik, Offene Jugendarbeit, Jugendhilfe, qualitative Forschung, teilnehmende Beobachtung, problemzentriertes Interview, Projekt, Wirkung, Jugend, Entwicklung, Veränderung.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Diplomarbeit: Erlebnispädagogik in der Offenen Jugendarbeit
Was ist der Gegenstand dieser Diplomarbeit?
Die Arbeit untersucht die Wirksamkeit von Erlebnispädagogik-Projekten in der Offenen Jugendarbeit. Sie analysiert ein konkretes Projekt ("Haus um die Ecke") und dessen Auswirkungen auf die beteiligten Jugendlichen. Ein Schwerpunkt liegt auf der wissenschaftlichen Auseinandersetzung mit diesem bisher wenig erforschten Bereich.
Welche zentralen Begriffe werden in der Arbeit definiert?
Die Arbeit definiert die Begriffe "Erlebnispädagogik" und "Offene Jugendarbeit". Es werden deren Geschichte, pädagogische Konzepte und Anwendungsgebiete beleuchtet, um den theoretischen Rahmen des untersuchten Projekts zu schaffen.
Welche Ziele werden in der Arbeit verfolgt?
Die Arbeit zielt darauf ab, die Wirksamkeit von Erlebnispädagogik in der Offenen Jugendarbeit zu belegen und einen Beitrag zur wissenschaftlichen Forschung in diesem Bereich zu leisten. Sie untersucht die Ziele beider Bereiche (Erlebnispädagogik und Offene Jugendarbeit), vergleicht diese und bewertet den Erfolg des Projekts anhand dieser Ziele.
Welche Methoden wurden zur Untersuchung der Projekt-Wirkungen angewendet?
Die Arbeit nutzt qualitative Forschungsmethoden, insbesondere die teilnehmende Beobachtung und das problemzentrierte Experteninterview. Diese Methoden erlauben eine detaillierte Analyse der Projektwirkungen und der Erfahrungen der beteiligten Jugendlichen.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in sieben Kapitel: Einleitung, Überblick über zentrale Arbeitsbegriffe, Zielstellungen, Erlebnispädagogik in der Offenen Jugendarbeit, Beschreibung des Projekts "Haus um die Ecke", Untersuchung der Projektwirkungen (mit detaillierter Beschreibung der Methoden) und Darstellung der Ergebnisse anderer Untersuchungen.
Welches Projekt steht im Mittelpunkt der Untersuchung?
Im Zentrum steht ein konkretes Erlebnispädagogik-Projekt im "Haus um die Ecke", einer Einrichtung der Offenen Jugendarbeit. Die Arbeit beschreibt detailliert die Ausgangssituation, die Projektplanung, den Ablauf und die daran anschließenden Aktivitäten.
Welche Ergebnisse liefert die Untersuchung?
Die Arbeit präsentiert die Ergebnisse der durchgeführten qualitativen Untersuchung (teilnehmende Beobachtung und problemzentrierte Interviews). Sie fasst die wichtigsten Erkenntnisse zusammen und zieht Schlussfolgerungen zur Wirksamkeit von Erlebnispädagogik in der Offenen Jugendarbeit.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren den Inhalt der Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Erlebnispädagogik, Offene Jugendarbeit, Jugendhilfe, qualitative Forschung, teilnehmende Beobachtung, problemzentriertes Interview, Projekt, Wirkung, Jugend, Entwicklung, Veränderung.
Welche Bedeutung hat der historische Kontext für die Arbeit?
Die Arbeit beleuchtet den historischen Kontext von Erlebnispädagogik und Offener Jugendarbeit, um das Projekt im "Haus um die Ecke" in seinen zeitgeschichtlichen und pädagogischen Kontext einzuordnen.
Woran liegt der Fokus der Analyse des Projekts "Haus um die Ecke"?
Die Analyse des Projekts fokussiert auf die Beschreibung des Settings, der beteiligten Jugendlichen, der Ziele, der Planung und des Ablaufs der einzelnen Aktivitäten (Vorbereitungstreffen, Einzelaktionen, Wochenendkurse, Nachbereitungstreffen).
- Quote paper
- Stefan Sommer (Author), 2001, Erlebnispädagogik in der Offenen Jugendarbeit , Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/44808