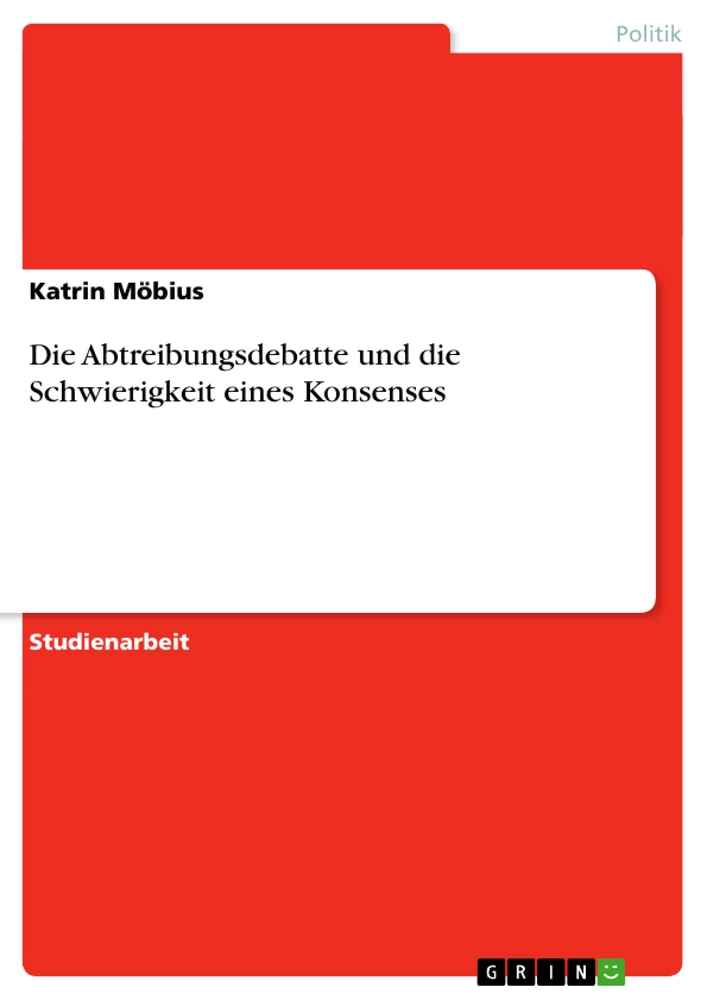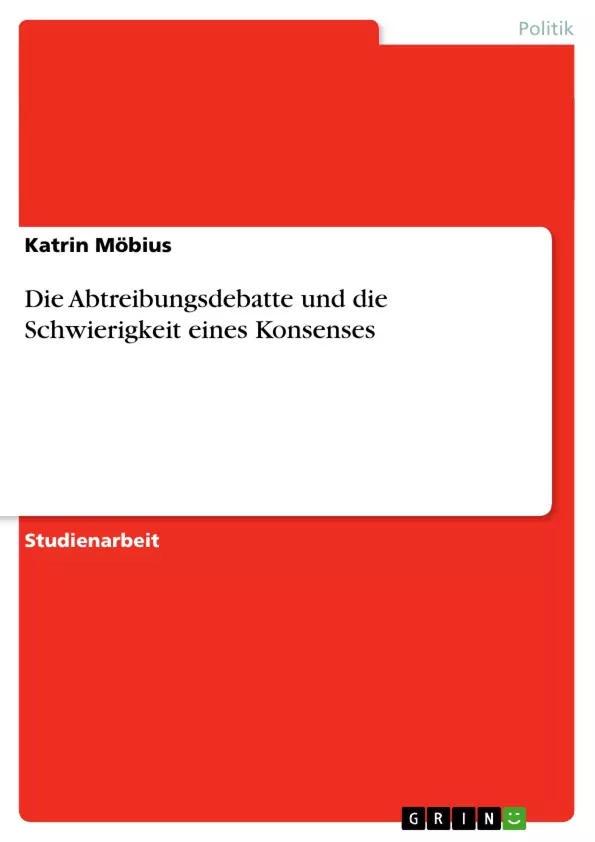Kaum eine Debatte wird so emotional geführt wie die Abtreibungsfrage, geht es dabei doch in erster Linie nicht um rein rationale Sachfragen, sondern um grundlegende Wertvorstellungen, Moral und die Frage einer Güterabwägung. Unter diesen Vorzeichen einen Konsens zu finden, eine Lösung, die allen Positionen gerecht wird, erscheint äußerst schwierig, wenn nicht gar unmöglich. Zwar hat sich die Diskussion hierzulande nach der Neuregelung des § 218 beruhigt und andere Themen haben die Frage, ob und wenn ja, wann Abtreibung erlaubt sein soll, von der politischen Tagesagenda verdrängt.
Die Frage scheint trotzdem nach wie vor interessant, warum es ausgerechnet bei der Abtreibungsdebatte so schwierig ist, einen „gemeinsamen Nenner“ zu finden. Dabei sollen hier nicht nur die verschiedenen gängigen Positionen vorgestellt und diskutiert werden.
Die Fragestellung soll vielmehr von einem interessanten Ansatz ausgehen, den die deutsche Professorin Monika Frommel in einem Aufsatz zur Frage nach einer
„geschlechtsspezifischen Moral“ verwendet: Sie unterscheidet darin die Struktur der Argumente. So kann ein Argument entweder in einer deduktiv-abstrakten, oder aber in einer induktiv-situationsspezifischen Herangehensweise aufgebaut werden.
Beide Herangehensweisen implizieren eine eigene Logik, wodurch im Prinzip eine schlüssige Argumentationskette entsteht.
Untersucht man die gängigen Argumente in der Abtreibungsdebatte nach ihrer Struktur, erkennt man, dass die Argumente jeweils nach dem einen oder anderen Prinzip aufgebaut sind. Es geht dabei in dieser Arbeitnichtum die Frage, ob diese oder jene Argumentstruktur geschlechtsspezifisch ist.
Vielmehr soll analysiert werden, warum in den verschiedenen Herangehensweisen an die Argumentation ein Grund für die schwierige Konsensfindung zu sehen ist. Zu Beginn sollen deshalb die beiden verschiedenen Argumentationsstrukturen und ihre wesentlichen Merkmale vorgestellt werden. Dabei soll auch die Problematik angesprochen werden, dass zwar beide Ansätze für sich alleine logisch erscheinen, jedoch immer einen Bereich ausklammern, der zu einer ganzheitlichen Betrachtungsweise fehlt. Andererseits heben sich die beiden konträren Betrachtungsweisen bei einem Zusammenführen teilweise gegenseitig auf und es kommt zwangsläufig zu einem Konflikt.
Nach der Erarbeitung und Erklärung der beiden
Argumentationsansätze folgt eine Analyse der gängigen Positionen in der Abtreibungsdebatte unter strukturellen Gesichtspunkten.
Inhaltsverzeichnis
- A. Einleitung
- B. Ausführung
- I. Die verschiedenen Betrachtungsweisen für eine Argumentation
- 1. Der deduktiv-abstrakte Ansatz
- 2. Der induktiv-situationsspezifische Ansatz
- 3. Die Problematik einer ganzheitlichen Betrachtungsweise
- II. Die verschiedenen Positionen zur Abtreibung und ihre Argumentationsstruktur
- 1. Die konservative Position
- 2. Die feministische Position
- 3. Die liberale Position
- III. Die wesentlichen Reibungspunkte
- I. Die verschiedenen Betrachtungsweisen für eine Argumentation
- C Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Ziel dieser Arbeit ist es, die Argumentationsstrukturen in der Abtreibungsdebatte zu analysieren und aufzuzeigen, warum ein Konsens in dieser Frage so schwierig zu erreichen ist. Die Arbeit untersucht, wie verschiedene Standpunkte – die konservative, die feministische und die liberale Position – in der Abtreibungsdebatte vertreten werden.
- Die Analyse der Argumentationsstrukturen in der Abtreibungsdebatte
- Die Darstellung der verschiedenen Positionen zur Abtreibung
- Die Herausarbeitung der Schwierigkeiten bei der Konsensfindung in dieser Frage
- Die Untersuchung der deduktiv-abstrakten und induktiv-situationsspezifischen Argumentationsansätze
- Die Bedeutung von Wertvorstellungen, Moral und Güterabwägung in der Abtreibungsdebatte
Zusammenfassung der Kapitel
A. Einleitung:
Die Einleitung stellt die emotionale und komplexe Natur der Abtreibungsdebatte heraus. Sie betont die Schwierigkeiten, einen Konsens zu finden, da die Debatte grundlegende Wertvorstellungen, Moral und Güterabwägungen betrifft. Trotz der Beruhigung der Diskussion nach der Neuregelung des § 218, bleibt die Frage nach der Zulässigkeit von Abtreibung relevant. Die Arbeit fokussiert auf die Struktur der Argumente, die von Monika Frommel in ihrem Aufsatz zur „geschlechtsspezifischen Moral“ eingeführt wurde.
B. Ausführung:
I. Die verschiedenen Betrachtungsweisen für eine Argumentation:
- 1. Der deduktiv-abstrakte Ansatz: Dieser Ansatz basiert auf allgemeinen, normativen Werten und Handlungsmaximen mit universeller Gültigkeit. Die Situation wird anhand dieser Normen beurteilt, um festzulegen, ob sie richtig oder falsch ist. Die universellen Normen dienen der Ordnung und Orientierung. Am Beispiel der roten Ampel wird die Funktion und der Nachteil dieses Ansatzes erläutert.
- 2. Der induktiv-situationsspezifische Ansatz: Dieser Ansatz berücksichtigt die jeweilige Situation und kontextuelle Faktoren. Es wird argumentiert, dass allgemeine Normen nicht immer ausreichen, um komplexe Situationen zu beurteilen. Der Ansatz ermöglicht eine flexiblere und situationsangepasste Betrachtungsweise.
- 3. Die Problematik einer ganzheitlichen Betrachtungsweise: Die Arbeit stellt die Problematik heraus, dass beide Ansätze, obwohl für sich genommen logisch, jeweils einen Aspekt ausblenden. Eine ganzheitliche Betrachtung, die sowohl abstrakte Prinzipien als auch konkrete Situationen berücksichtigt, erscheint notwendig, um die Komplexität der Abtreibungsfrage zu erfassen.
II. Die verschiedenen Positionen zur Abtreibung und ihre Argumentationsstruktur:
- 1. Die konservative Position: Die konservative Position basiert auf dem Schutz des ungeborenen Lebens und argumentiert gegen die Zulässigkeit von Abtreibung. Sie vertritt einen deduktiv-abstrakten Ansatz, der auf einem absoluten Schutz des Lebens von der Empfängnis an basiert.
- 2. Die feministische Position: Die feministische Position setzt sich für die Selbstbestimmung der Frau ein und argumentiert für das Recht auf Abtreibung. Sie verwendet einen induktiv-situationsspezifischen Ansatz, der die individuellen Lebensumstände der Frau und ihre Entscheidungsfreiheit in den Vordergrund stellt.
- 3. Die liberale Position: Die liberale Position argumentiert für ein Recht auf Selbstbestimmung, das sowohl das Recht der Frau auf körperliche Integrität als auch das Recht des ungeborenen Lebens berücksichtigt. Sie sucht nach einem Kompromiss zwischen den beiden Positionen und strebt nach einer pragmatischen Lösung, die die jeweiligen Interessen berücksichtigt.
III. Die wesentlichen Reibungspunkte:
Das Kapitel behandelt die Schwierigkeiten, die sich aus den unterschiedlichen Argumentationsstrukturen ergeben. Es werden die zentralen Punkte herausgearbeitet, die einer Konsensfindung im Wege stehen und die Komplexität der Abtreibungsdebatte verdeutlichen.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit den zentralen Themen Abtreibung, Reproduktionsmedizin, Verfassungsrecht, Geschlechterpolitik, Argumentationsstrukturen, Konsensfindung, deduktiv-abstrakter Ansatz, induktiv-situationsspezifischer Ansatz, konservative Position, feministische Position, liberale Position, ethische und moralische Aspekte, Wertvorstellungen und Güterabwägung.
Häufig gestellte Fragen
Warum ist ein Konsens in der Abtreibungsdebatte so schwierig?
Weil es nicht um rationale Sachfragen geht, sondern um fundamentale Wertvorstellungen, Moral und die Abwägung existentieller Güter.
Was unterscheidet deduktive von induktiven Argumenten?
Deduktive Argumente gehen von universellen Normen aus, während induktive Argumente die spezifische Lebenssituation und den Kontext berücksichtigen.
Welche Position vertritt die konservative Seite?
Die konservative Position basiert meist auf einem deduktiv-abstrakten Ansatz, der den absoluten Schutz des Lebens ab der Empfängnis fordert.
Wie argumentiert die feministische Position?
Sie nutzt oft einen induktiv-situationsspezifischen Ansatz, der die Selbstbestimmung der Frau und ihre individuellen Lebensumstände ins Zentrum stellt.
Was ist das Ziel der liberalen Position?
Die liberale Position sucht nach einem pragmatischen Kompromiss zwischen dem Lebensschutz und dem Recht auf körperliche Integrität der Frau.
- Quote paper
- Katrin Möbius (Author), 2004, Die Abtreibungsdebatte und die Schwierigkeit eines Konsenses, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/44924