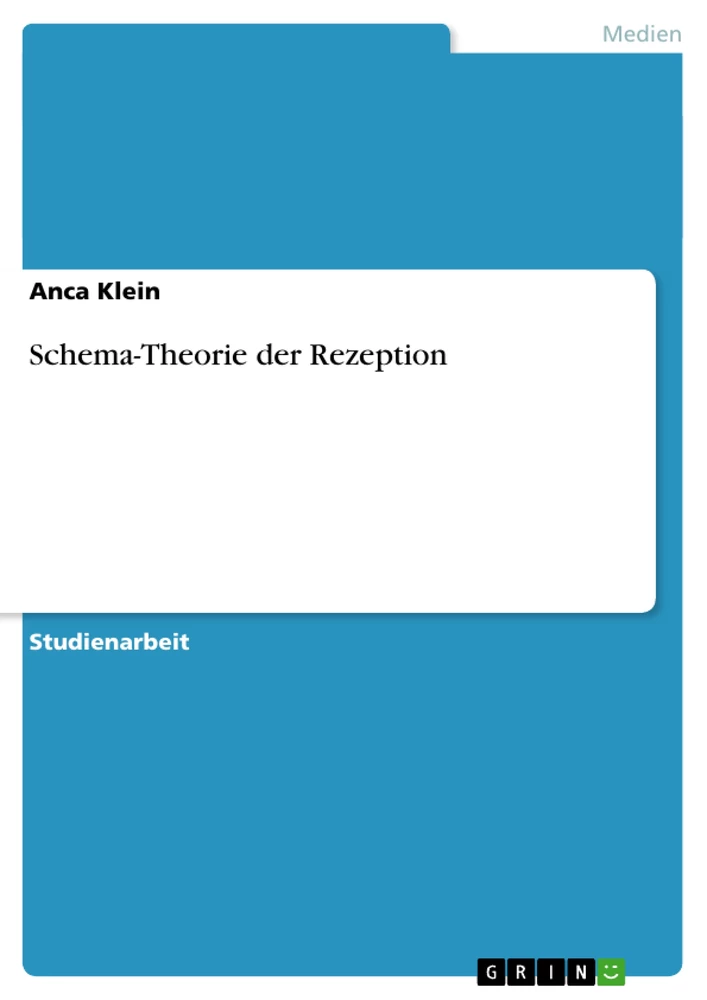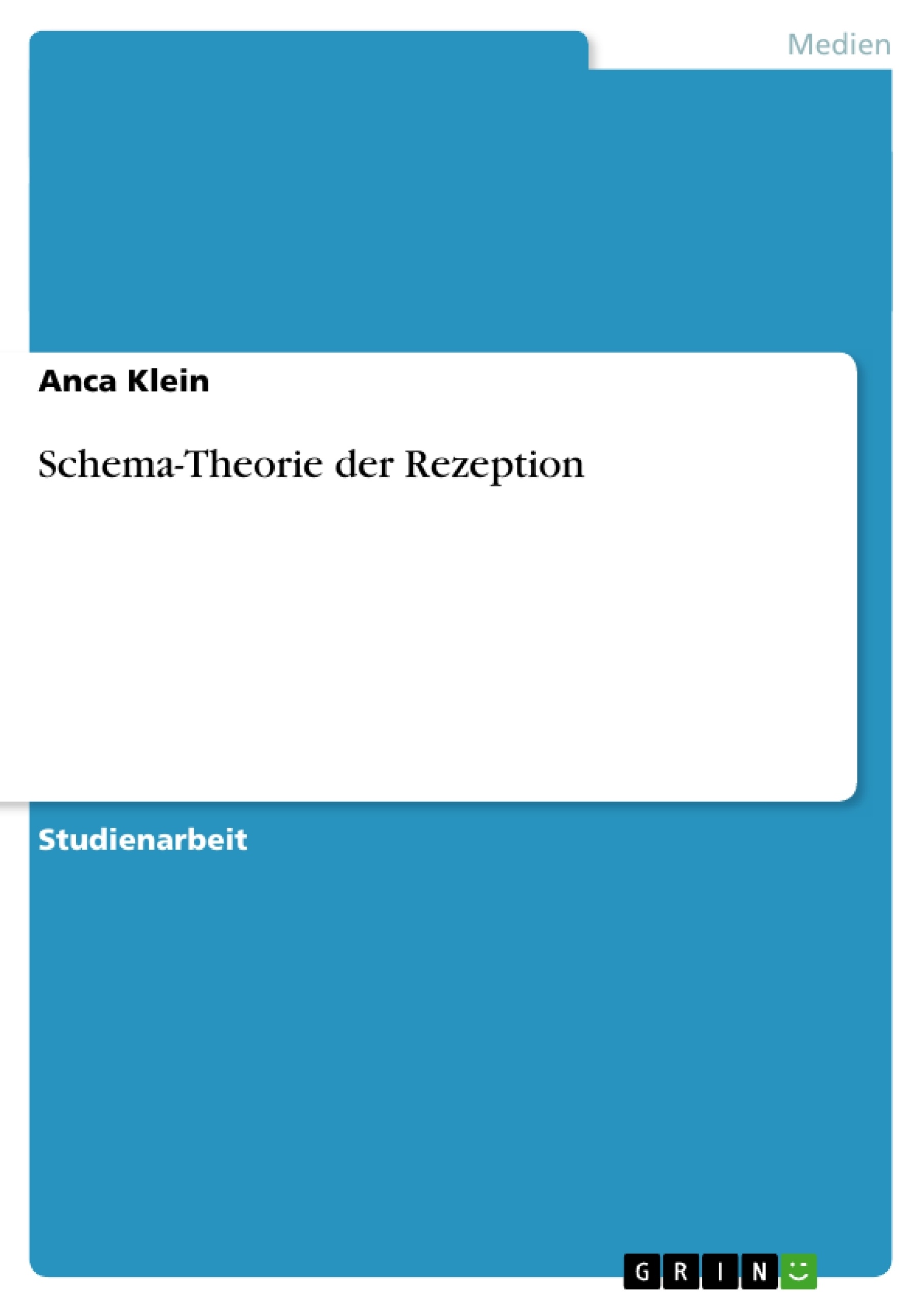Die Frage, wie Massenmedien auf das Publikum wirken und wie oder ob sie Einstellungen und dann schließlich Verhalten beeinflussen und nach den eigenen Zielen verändern können, stellt sich, seit dem es Massenkommunikationsmittel gibt. Die Laswell Formel kann man den Anhängern der starken Medienwirkung zuordnen. Laut dieser Theorie spielt nur die eigentliche Information, die vermittelt wird, eine Rolle, „Rezipientenvariablen und die Frage, wie Informationen aufgenommen und verarbeitet werden, waren (...) kaum von Bedeutung." Die Opinionleaders Theorie von Lazarsfeld, Berelson und Gauder bildet den entgegengesetzten Pol und meint, Medien „könnten keineswegs die Meinungen der Bevölkerung beeinflussen, sondern lediglich bereits bestehende Einstellungen verstärken." Laut dieser Auffassung können die Medien die Rezipienten gar nicht direkt erreichen und eine zweischichtige Kommunikation fände statt: direkt zwischen dem Medium und den Opinionleaders und dann eine face-to-face Kommunikation zwischen den Opinionleaders und dem Publikum. Die Medieninhalte und die Art ihrer Präsentation „verloren an Bedeutung, Rezipientenvariablen rückten in den Vordergrund." Die Theorie der Rezeption Schema ist unter der Kategorie der „selektiven Medienwirkungen" zu unterbringen.
Inhaltsverzeichnis
- Einführung
- Ansätze
- Definition und Funktion von Schemata
- Schema und verwandte Begriffe
- Aktivierung von Schemata
- Schemata und Stereotype
- Forschungen auf dem Gebiet und Kritiken
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Der Text befasst sich mit der Schema-Theorie der Rezeption und untersucht, wie Menschen Informationen aus Massenmedien verarbeiten. Die Theorie besagt, dass Menschen keine "Tabula rasa" sind, sondern bereits vorhandene Erfahrungen und Wissen nutzen, um neue Informationen zu interpretieren.
- Aktive Rolle des Rezipienten bei der Informationsverarbeitung
- Bedeutung von Schemata als kognitiven Strukturen
- Einfluss von Schemata auf die Interpretation von Medieninhalten
- Kritik an der Schema-Theorie und deren Grenzen
- Verknüpfung von Schema-Theorie mit anderen Ansätzen der Medienwirkung
Zusammenfassung der Kapitel
Einführung
Der Text beginnt mit einer Einführung in die Frage der Medienwirkung und stellt die Laswell-Formel sowie die Opinionleader-Theorie als gegensätzliche Ansätze vor. Die Schema-Theorie wird als Theorie der selektiven Medienwirkungen positioniert, die den aktiven Rezipienten in den Vordergrund stellt.
Ansätze
Im zweiten Kapitel werden die Ansätze der Schema-Theorie beleuchtet. Der Mensch wird nicht als passives Objekt der Medien betrachtet, sondern als aktives Individuum, das Informationen im Kontext seiner bestehenden Erfahrungen und Schemata verarbeitet.
Definition und Funktion von Schemata
Dieses Kapitel definiert Schemata als kognitive Strukturen, die helfen, neue Informationen zu verarbeiten und zu speichern. Der Text beleuchtet die verschiedenen Begriffe, die mit Schemata verwandt sind, und erklärt, wie Schemata aktiviert werden und welche Rolle sie bei der Bildung von Stereotypen spielen.
Schlüsselwörter
Schema-Theorie, Medienwirkung, Rezeption, Informationverarbeitung, kognitive Strukturen, Schemata, Stereotype, Selektive Medienwirkung, Laswell-Formel, Opinionleader-Theorie, Prototypen, Aktiver Rezipient, Informationsverarbeitung.
Häufig gestellte Fragen
Was besagt die Schema-Theorie der Rezeption?
Sie besagt, dass Rezipienten Medieninhalte aktiv auf Basis bereits vorhandener Wissensstrukturen (Schemata) interpretieren.
Was unterscheidet aktive von passiven Rezipienten?
Aktive Rezipienten nutzen ihr Vorwissen zur Selektion und Interpretation, während passive Modelle (wie die Laswell-Formel) von einer direkten Medienwirkung ausgehen.
Welche Funktion haben Schemata?
Schemata dienen als kognitive Strukturen, die helfen, neue Informationen effizient zu verarbeiten, zu speichern und einzuordnen.
Wie hängen Schemata und Stereotype zusammen?
Stereotype sind eine Form von Schemata, die vereinfachte, oft voreingenommene Erwartungen an soziale Gruppen oder Situationen festlegen.
Was ist die Opinionleader-Theorie?
Eine Theorie von Lazarsfeld, nach der Medienwirkungen oft indirekt über Meinungsführer (Opinionleaders) in einer Face-to-Face-Kommunikation vermittelt werden.
- Citar trabajo
- Anca Klein (Autor), 2003, Schema-Theorie der Rezeption, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/44981