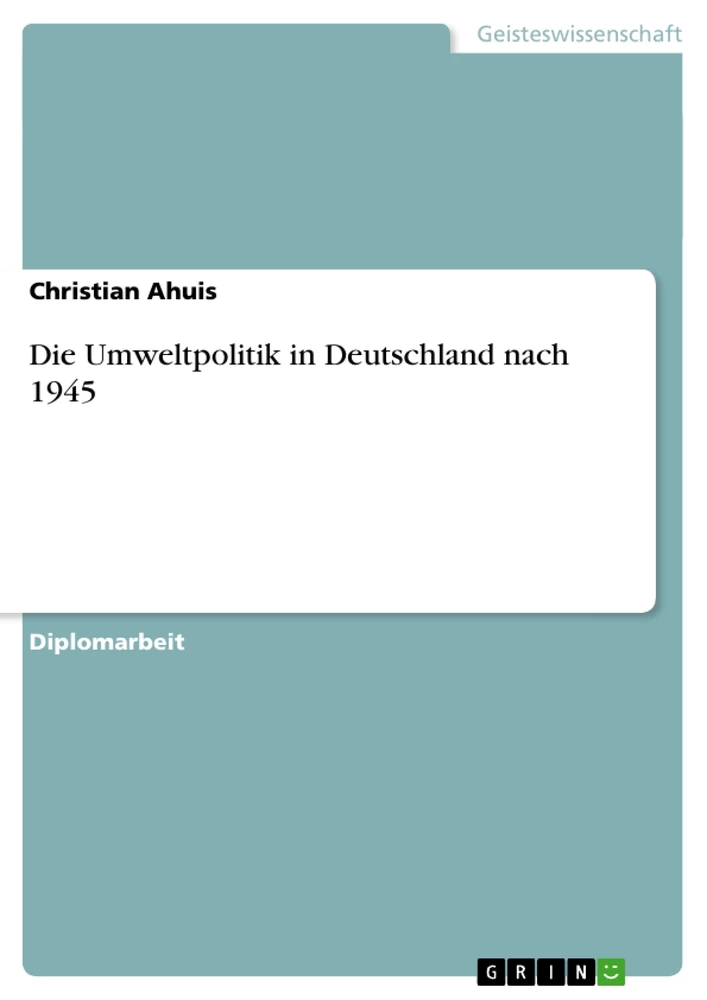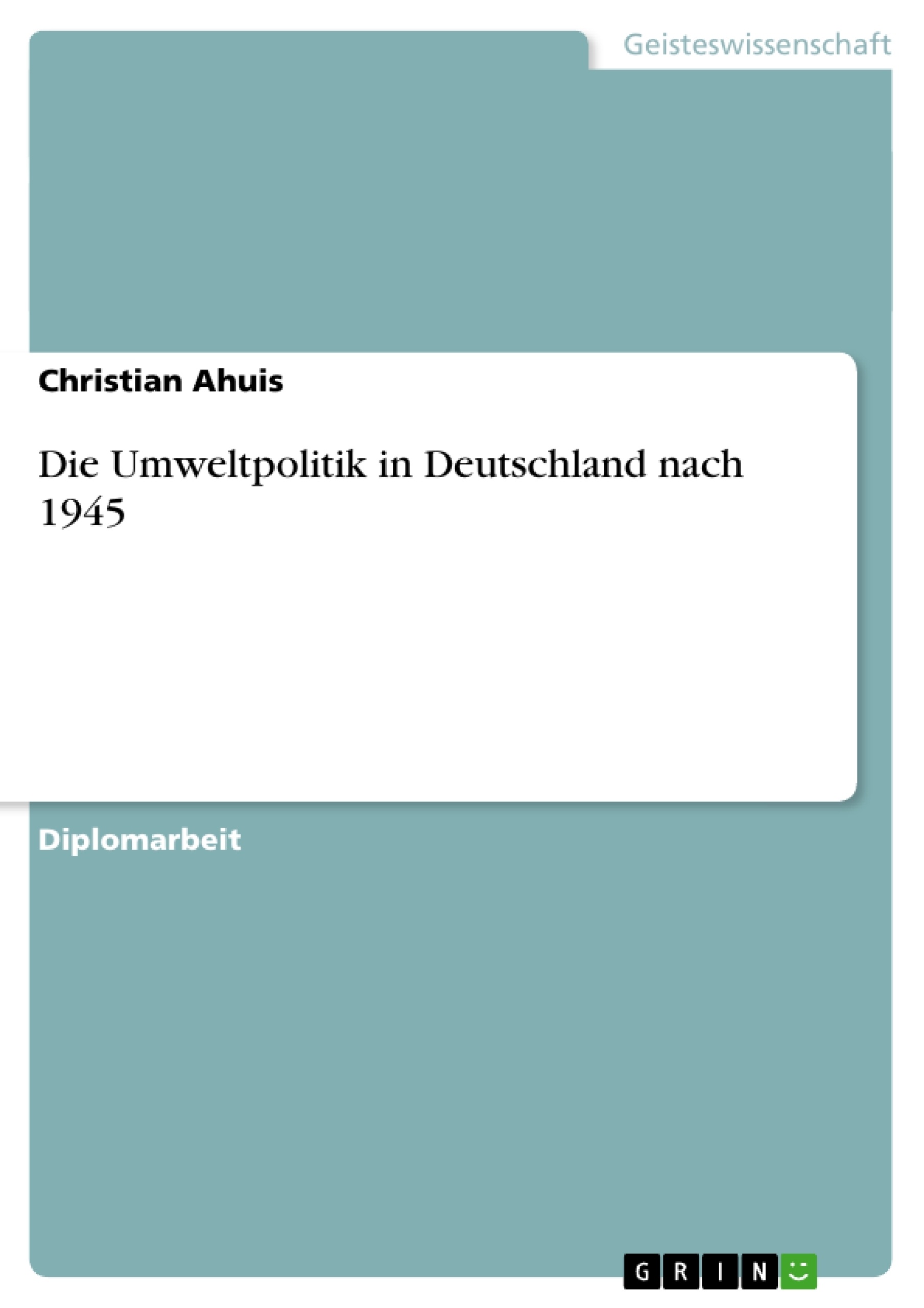Natur- und Umweltschutz haben gemeinsame geschichtliche Wurzeln und lassen sich, zumindest was die deutsche Entwicklung betrifft, nicht isoliert betrachten. Zugleich jedoch wurde ihre historische Entwicklung von verschiedenen Fachdisziplinen Geschichtswissenschaft, Erziehungswissenschaft, Politikwissenschaft, Soziologie, Umweltwissenschaft, Kulturwissenschaften) mit zumeist unterschiedlichen Fragestellungen untersucht.
Wer heute von Umwelt- oder Naturschutz spricht, verkennt häufig den Unterschied zwischen Natur- und Umweltschutz. Wenn gleich beide Bereiche nur ungern miteinander in Verbindung gebracht werden wollen, verdankt der Naturschutz dem in den 70er Jahren populär gewordenen Umweltschutz, dass er bis heute überleben konnte. Während die Debatten um die Bewahrung der Umwelt / Natur in den letzten 30 Jahren neue Dimensionen angenommen haben, darf aber nicht vergessen werden, dass auch in den Jahren vor 1945 wichtige Schritte getätigt worden sind. Die Schaffung von Kanalisationen sowie die Einrichtung von zentralisierten Wasserversorgungen in Dörfern und Städten war eine frühe Entwicklung von Umweltpolitik. Erste Naturschutzgebiete wurden bereits 1836 mit dem Drachenfels im Siebengebirge geschaffen, 1898 erfolgte die Gründung des Deutschen Bundes für Vogelschutz (DBV) und 1913 des Bund Naturschutz Bayern. Neben den Bestrebungen der 1906 in Preußen begründeten Staatlichen Stelle für Naturdenkmalpflege kümmerte sich der 1909 in Stuttgart gegründete Verein Naturschutzpark um die Ausweisung von Naturschutzflächen in der Lüneburger Heide. Vorreiter des Immissionsschutzes wurden bereits 1845 in der Allgemeinen Preußischen Gewerbeordnung, in der Gewerbeordnung des Norddeutschen Bundes von 1869 und in der Gewerbeordnung für das Deutsche Reich von 1900 geschaffen.
Die zentralen Fragen dieser Arbeit lauten: Inwiefern lässt sich in der Entwicklung der Bundesrepublik von einer Politisierung des Umweltschutzes und schließlich von einem neuen Politikmodus sprechen? Lässt sich Umweltpolitik mit Udo E. Simonis bestimmen als eine „gesellschaftliche Reaktion auf ökologische Krisenerscheinungen“? Welche historische Rolle kommt dabei den verschiedenen Umweltverbänden in dem skizzierten umweltpolitischen Spannungsfeld zu?
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Ziele und Fragestellungen der Untersuchung
- Forschungsstand zum Thema
- Aufbau der Arbeit
- Akteure und Strukturen in der Umweltpolitik
- Begriffserläuterungen und Hintergründe
- Umweltpolitische Instrumente und Qualitätsziele
- Umweltpolitische Innovationswirkungen
- Die Akteure umweltpolitischen Handelns
- Zur Politisierung des Umweltschutzes
- Umweltrechtliche Chronologie
- Die Entwicklung nach 1945
- Ein neuer Politikmodus entsteht (1969 – 1975)
- Umweltpolitik als Teil der Regierungserklärung
- Umweltpolitik als Aufgabe des Innenministers
- Defensive Umweltpolitik (1974 – 1978)
- Konsolidierende Umweltpolitik (1979 – 1989)
- Die instrumentalen Handlungsprinzipien der Umweltpolitik
- Die CDU Regierung (1982 – 1998)
- Die Ära Töpfer
- Die Umweltpolitik nach der Wende, Rückschritt für den Fortschritt?
- Institutionen und Gruppierungen
- Die Verbände
- Bürgerinitiativen
- Der BUND
- Umweltpolitische Wahrnehmungs- und Politisierungsprozesse im Kontext der globalen Krisenentwicklung
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit befasst sich mit der Geschichte der Umweltpolitik in Deutschland nach 1945. Sie untersucht, wie sich der Umweltschutz in den verschiedenen Phasen der deutschen Nachkriegsgeschichte politisch entwickelte und welche Rolle dabei verschiedene Akteure, wie der Staat, die Industrie und Umweltverbände, spielten. Die Arbeit fragt nach den historischen Wurzeln des Umweltschutzes und den verschiedenen Stufen der Politisierung dieses Themas. Sie analysiert auch die Innovationswirkungen und die Rolle von Umweltverbänden im umweltpolitischen Spannungsfeld.
- Die Politisierung des Umweltschutzes in Deutschland nach 1945
- Die Rolle des Staates, der Industrie und Umweltverbände in der Umweltpolitik
- Die verschiedenen Stufen der Umweltpolitik von der Reparatur von Umweltschäden hin zur ökologischen Modernisierung
- Die historische Entwicklung von Naturschutz und Umweltschutz
- Die Auswirkungen der globalen Krisenentwicklung auf die Umweltpolitik
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in das Thema ein, indem sie die Ziele und Fragestellungen der Untersuchung darlegt und den Forschungsstand zum Thema erläutert. Im zweiten Kapitel werden die Akteure und Strukturen in der Umweltpolitik genauer betrachtet. Hierbei werden Begriffserläuterungen und Hintergründe sowie die Umweltpolitischen Instrumente und Qualitätsziele beschrieben. Auch die Innovationswirkungen und die Rolle der Akteure umweltpolitischen Handelns werden beleuchtet. Das dritte Kapitel widmet sich der Politisierung des Umweltschutzes und umfasst die umweltrechtliche Chronologie sowie die Entwicklung der Umweltpolitik nach 1945. Es beleuchtet die verschiedenen Phasen der Umweltpolitik, angefangen vom Entstehen eines neuen Politikmodus bis hin zur Konsolidierenden Umweltpolitik. Das vierte Kapitel befasst sich mit den Institutionen und Gruppierungen, die in der Umweltpolitik eine wichtige Rolle spielen. Hierbei werden die Verbände, Bürgerinitiativen und der BUND näher betrachtet.
Schlüsselwörter
Die Arbeit beschäftigt sich mit wichtigen Themen wie Umweltpolitik, Umweltschutz, Naturschutz, Politisierung, Akteure, Strukturen, Innovationswirkungen, Umweltverbände, globale Krisenentwicklung und Umweltrecht. Sie analysiert die historische Entwicklung der Umweltpolitik in Deutschland und die verschiedenen Phasen und Strategien, die in diesem Kontext Anwendung fanden. Die Arbeit befasst sich mit den verschiedenen Akteuren der Umweltpolitik und deren Einfluss auf die politische Entwicklung. Darüber hinaus untersucht sie den Zusammenhang zwischen Umweltpolitik und globalen Krisenentwicklungen.
Häufig gestellte Fragen
Wann begann die moderne Umweltpolitik in Deutschland?
Ein entscheidender Wendepunkt war der Zeitraum 1969–1975, als Umweltpolitik Teil der Regierungserklärung wurde und dem Innenminister unterstellt wurde.
Was ist der Unterschied zwischen Naturschutz und Umweltschutz?
Naturschutz fokussiert auf die Bewahrung von Flora und Fauna (historisch älter), während Umweltschutz technische und politische Maßnahmen gegen Krisenerscheinungen (Abfall, Emissionen) umfasst.
Welche Rolle spielen Umweltverbände wie der BUND?
Verbände und Bürgerinitiativen fungierten als Motoren der Politisierung, indem sie ökologische Krisen öffentlich machten und Druck auf die Gesetzgebung ausübten.
Was war die "Ära Töpfer"?
Unter Bundesumweltminister Klaus Töpfer (CDU) in den 80er und 90er Jahren wurde die Umweltpolitik konsolidiert und internationaler ausgerichtet.
Gab es vor 1945 bereits Ansätze von Umweltpolitik?
Ja, frühe Ansätze waren die Kanalisation, Wasserversorgung und erste Immissionsschutzgesetze in der Preußischen Gewerbeordnung von 1845.
- Quote paper
- Christian Ahuis (Author), 2004, Die Umweltpolitik in Deutschland nach 1945, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/45406