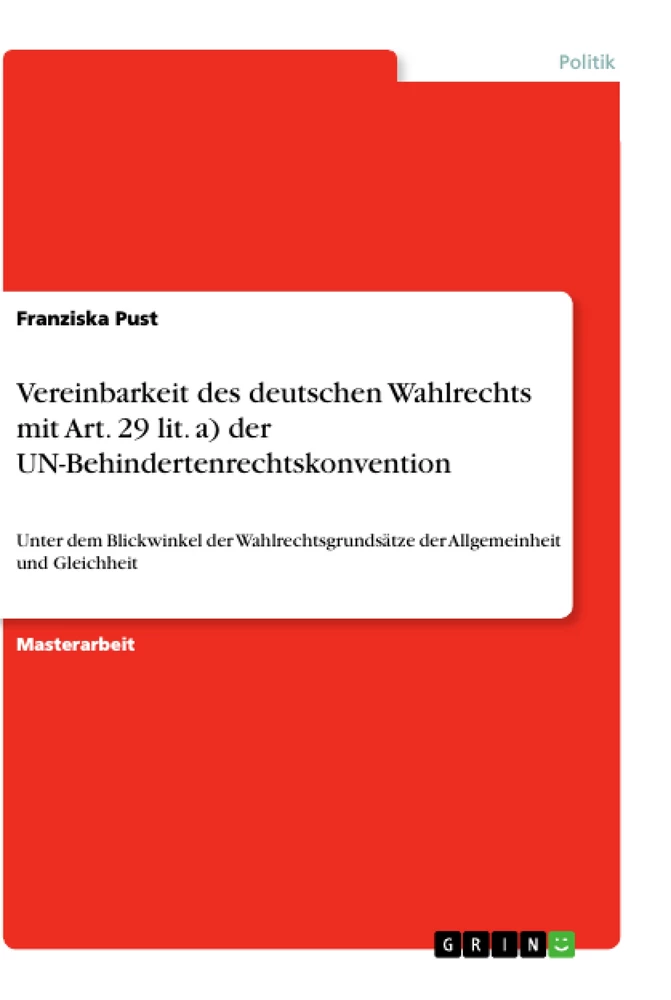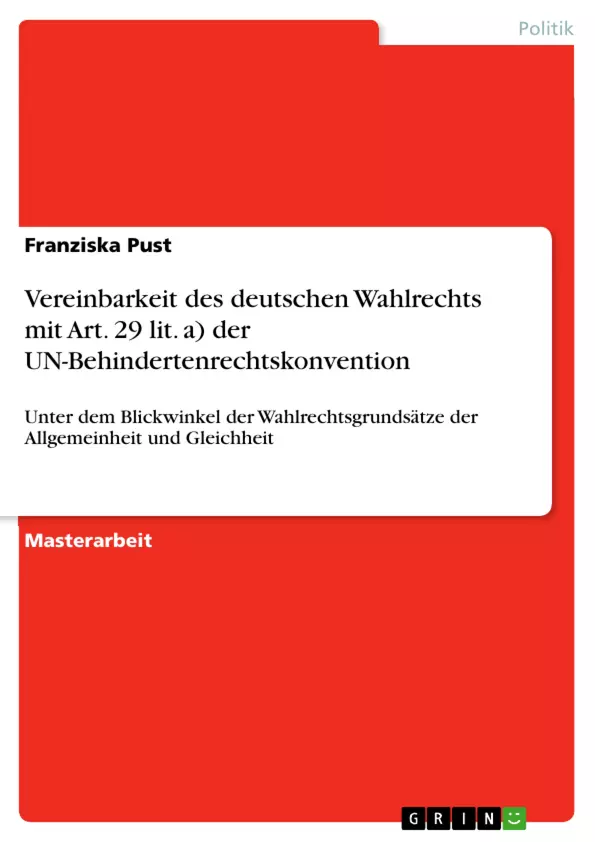Menschen mit Behinderungen gelten im Rechtsgefüge als eine besonders schutzbedürftige Gruppe. Mit der Unterzeichnung des Übereinkommens über die Rechte von Menschen mit Behinderungen im Jahr 2006 hat sich die Bundesrepublik Deutschland an eines der modernsten speziellen Menschenrechtsabkommen gebunden. Der Menschenrechtsschutz für Menschen mit Behinderungen hat mit der UN-Behindertenrechtskonvention eine neue Qualität erlangt, da Menschen mit Behinderungen erstmals in einer auf ihre spezielle Schutzbedürftigkeit bezogene Menschenrechtskonvention bedacht wurden.
Mit der Behindertenrechtskonvention, dem darin verbürgten Recht auf politische Teilhabe und dem Grundgedanken der Inklusion behinderter Menschen, entwickelte sich eine immer lauter werdende Kritik zum Wahlrechtssauschluss behinderter Menschen nach § 13 Nr. 2 und 3 des deutschen Bundeswahlgesetzes. In Deutschland sind von diesem Wahlrechtsausschluss in etwa 10.000 Menschen unter Totalbetreuung betroffen. Die Ausschlussnormen sehen vor, dass Menschen unter einer gesetzlichen Totalbetreuung oder jene, die Aufgrund von Schuldunfähigkeit nach einer Straftat in einer psychiatrischen Einrichtung untergebracht sind, vom aktiven und passiven Wahlrecht ausgeschlossen werden. Die Behindertenrechtskonvention enthält in Art. 29 lit. a) eine Norm zur politischen Teilhabe behinderter Menschen, die ein inklusives Wahlrecht suggeriert.
Ein inklusives Wahlrecht für alle Bürgerinnen und Bürger, auch jene mit schweren Behinderungen, welche möglicherweise keine Wahlentscheidung ohne eine Assistenz oder gar keine Wahlentscheidung treffen können, weil sie sich beispielsweise in einem komatösen Zustand befinden, wird immer wieder stark diskutiert. Die mögliche Einflussnahme Dritter ist ein Einwand, der häufig im Zusammenhang mit dem Wahlrecht für Menschen mit Behinderungen genannt wird. Ein häufig genanntes Gegenargument in der Literatur ist, dass die staatliche Fürsorge verantwortlich ist, Beeinflussungen oder Betrug bei der Stimmabgabe zu verhindern. Danach wird einerseits der Mensch gesehen, der nicht in der Lage scheint, seine Meinung frei zu äußern und in weiten Teilen als nicht politisches Wesen wahrgenommen wird. Andererseits verpflichten sich Staaten dazu, den Grundsatz der Inklusion in ihren Hoheitsgebieten umzusetzen und Menschen mit Behinderungen in ihre Gesellschaft einzubinden beziehungsweise sie nicht aus dieser zu exkludieren.
Inhaltsverzeichnis
- I. Abstract
- II. Inhaltsverzeichnis
- III. Abkürzungsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Forschungsstand
- 3. Menschen mit Behinderungen und das Recht auf politische Teilhabe aus Art. 29 lit. a) der UN-Behindertenrechtskonvention
- 3.1. Internationaler Schutz der Rechte von Menschen mit Behinderung vor der Behindertenrechtskonvention
- 3.2. Die UN-Behindertenrechtskonvention
- 3.3. Der Behinderungsbegriff der UN-Behindertenrechtskonvention
- 3.4. Das Recht auf politische Teilhabe nach Artikel 29 lit. a) der UN-Behindertenrechtskonvention
- 3.4.1. Berechtigte
- 3.4.2. Verpflichtete
- 3.4.3. Diskriminierung aus Gründen der Behinderung
- 3.4.3.1. Verbotene Gründe
- 3.4.3.2. Andere Gründe
- 3.4.4. Rechtfertigung
- 3.4.4.1. Geschriebene Rechtfertigung
- 3.4.4.2. Ungeschriebene Rechtfertigung
- 3.4.5. Zwischenfazit
- 4. Die Wahlrechtsprinzipien des deutschen Grundgesetzes und ihre Schranken
- 4.1. Die Wahlrechtsprinzipien des Art. 38 Abs. 2 GG
- 4.2. Schranken der Allgemeinheit und Gleichheit als Begründung für einen Wahlrechtsausschluss
- 5. Der Wahlrechtsausschluss nach § 13 Nr. 2 des Bundeswahlgesetzes
- 5.1. Einschränkung des Wahlrechts für Menschen mit Behinderungen unter gesetzlicher Betreuung nach § 13 Nr. 2 BWahlG
- 5.2. Der Behinderungsbegriff des deutschen Rechts
- 5.3. Ausschlusskriterium der Vorsorgevollmacht
- 6. Die Wahlrechtsprinzipien der Allgemeinheit und Gleichheit in ihrer historischen Entwicklung
- 7. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Masterarbeit befasst sich mit der Vereinbarkeit des deutschen Wahlrechts mit dem Recht auf politische Teilhabe gemäß Artikel 29 lit. a) der UN-Behindertenrechtskonvention. Im Zentrum steht die Frage, ob der im Bundeswahlgesetz geregelte Wahlrechtsausschluss für Personen unter gesetzlicher Betreuung mit dem internationalen Recht vereinbar ist.
- Analyse des Rechts auf politische Teilhabe nach Artikel 29 lit. a) der UN-Behindertenrechtskonvention
- Begutachtung der Wahlrechtsgrundsätze der Allgemeinheit und Gleichheit im deutschen Grundgesetz
- Bewertung des Wahlrechtsausschlusses für Menschen mit Behinderungen unter gesetzlicher Betreuung gemäß § 13 Nr. 2 des Bundeswahlgesetzes
- Rekonstruktion der historischen Entwicklung der Wahlrechtsprinzipien im deutschen Recht
- Bewertung der Vereinbarkeit des deutschen Wahlrechts mit dem internationalen Recht
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit beginnt mit einer Einleitung, die die Relevanz des Themas und die Forschungsfrage erläutert. Im Anschluss wird der aktuelle Forschungsstand zum Thema Wahlrecht und Menschen mit Behinderungen dargestellt. Kapitel 3 behandelt das Recht auf politische Teilhabe aus Artikel 29 lit. a) der UN-Behindertenrechtskonvention. Es werden der internationale Schutz der Rechte von Menschen mit Behinderungen, der Behinderungsbegriff der UN-Behindertenrechtskonvention sowie das Recht auf politische Teilhabe im Detail analysiert. Kapitel 4 befasst sich mit den Wahlrechtsprinzipien des deutschen Grundgesetzes und ihren Schranken. Hier werden die Grundsätze der Allgemeinheit und Gleichheit sowie ihre Bedeutung für das Wahlrecht untersucht. Kapitel 5 widmet sich dem Wahlrechtsausschluss nach § 13 Nr. 2 des Bundeswahlgesetzes. Es werden die Einschränkung des Wahlrechts für Menschen mit Behinderungen unter gesetzlicher Betreuung, der Behinderungsbegriff des deutschen Rechts sowie das Ausschlusskriterium der Vorsorgevollmacht analysiert. Kapitel 6 befasst sich mit der historischen Entwicklung der Wahlrechtsprinzipien der Allgemeinheit und Gleichheit. Abschließend wird in einem Fazit die Vereinbarkeit des deutschen Wahlrechts mit Artikel 29 lit. a) der UN-Behindertenrechtskonvention bewertet.
Schlüsselwörter
Die Arbeit beschäftigt sich mit den zentralen Themen des Wahlrechts, der Menschenrechte, der UN-Behindertenrechtskonvention, des Rechts auf politische Teilhabe, der Diskriminierung, der Gleichheit, der Allgemeinheit und der Rechtsvereinbarkeit.
Häufig gestellte Fragen
Was besagt Art. 29 lit. a) der UN-Behindertenrechtskonvention?
Dieser Artikel garantiert Menschen mit Behinderungen das Recht auf volle politische Teilhabe, insbesondere das aktive und passive Wahlrecht auf gleichberechtigter Basis.
Warum steht das deutsche Wahlrecht in der Kritik?
Kritisiert wird der Wahlrechtsausschluss gemäß § 13 BWahlG für Menschen, die unter Totalbetreuung stehen oder in psychiatrischen Einrichtungen untergebracht sind.
Was sind die Wahlrechtsprinzipien des Grundgesetzes?
Dazu gehören die Allgemeinheit, Unmittelbarkeit, Freiheit, Gleichheit und Geheimhaltung der Wahl (Art. 38 GG).
Was wird unter einem "inklusiven Wahlrecht" verstanden?
Ein Wahlrecht, das niemanden aufgrund einer Behinderung ausschließt und bei Bedarf Assistenzmöglichkeiten bietet, um die Stimmabgabe zu ermöglichen.
Gibt es Rechtfertigungen für den Ausschluss vom Wahlrecht?
Die Arbeit untersucht, ob ungeschriebene Rechtfertigungen (wie die Fähigkeit zur Wahlentscheidung) mit dem Diskriminierungsverbot der UN-Konvention vereinbar sind.
- Citar trabajo
- Franziska Pust (Autor), 2016, Vereinbarkeit des deutschen Wahlrechts mit Art. 29 lit. a) der UN-Behindertenrechtskonvention, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/456819