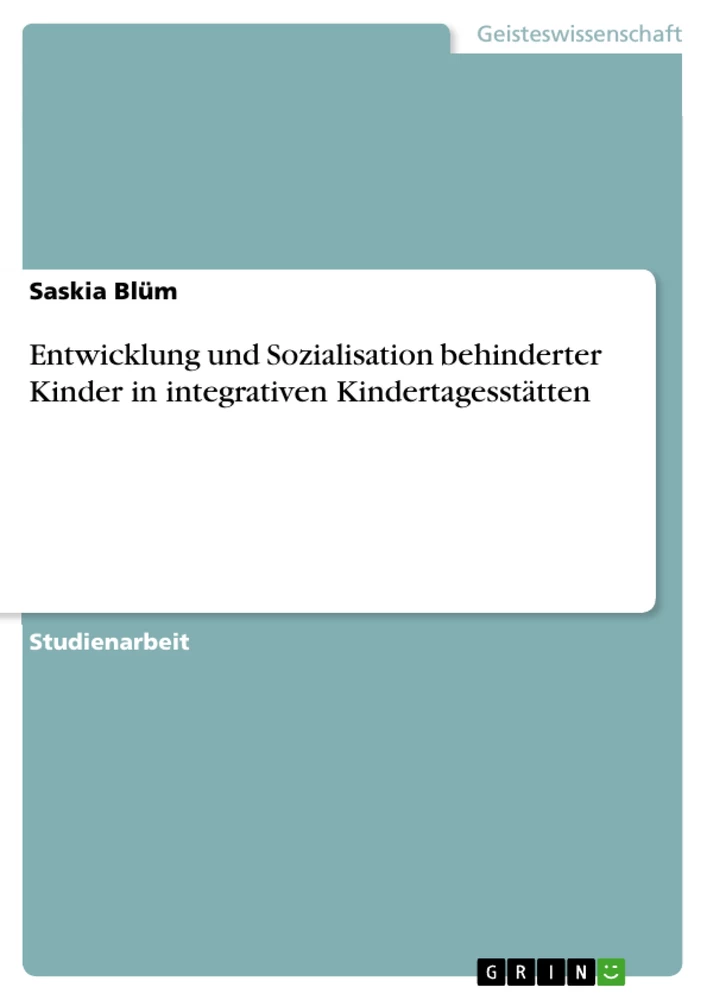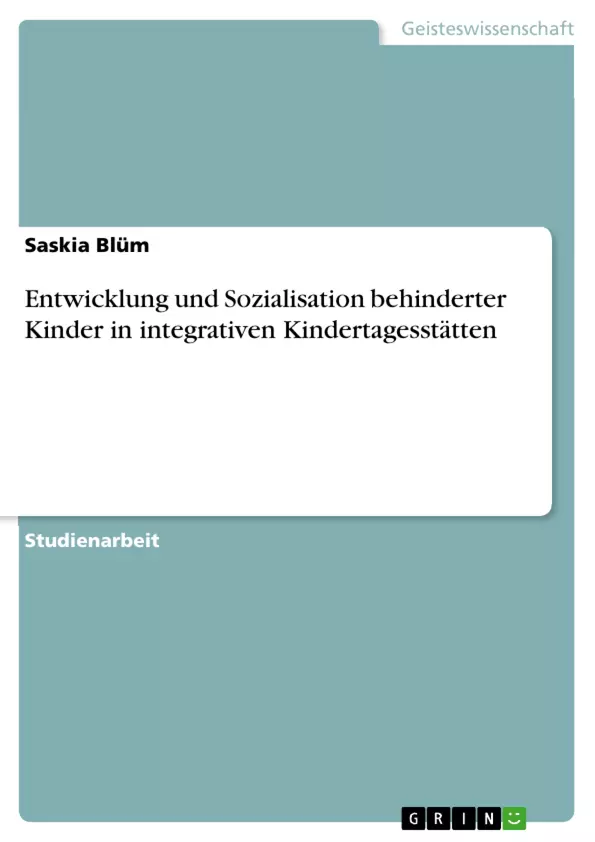In dieser Ausarbeitung geht es um die Möglichkeiten der Entwicklung und Sozialisation von Kindern mit einer körperlichen und oder geistigen Behinderung in integrativen Kindertagesstätten.
Zu Beginn meiner Recherche bin Ich auf dieses Zitat eines unbekannten Autors gestoßen: „Children with disabilities, are like butterflies with broken wings, they're just as beautiful as other children,but they just need a little help to spread their wings.“(o.V.) Kinder mit einer körperlichen und oder geistigen Einschränkung werden hier als Schmetterlinge mit einem gebrochenen Flügel bezeichnet. Diese Kinder sind genau so wunderbar wie andere Kinder, benötigen lediglich etwas mehr Hilfe und Unterstützung.
Das Wort Integration hat in den letzten Jahren viel an Bedeutung gewonnen, immer mehr Einrichtungen wie Kindergärten bieten Integrativplätze für Kinder mit geistiger und oder körperlicher Behinderung an.
Die Zahl der behinderten oder förderungsbedürftigen Kinder nimmt immer mehr zu und
eine integrative Einrichtung, wie zum Beispiel ein integrativer Kindergarten bietet Kindern mit geistiger und oder körperlicher Behinderung verschiedenste Förderungsmöglichkeiten und eine individuelle Betreuung.
Kinder ohne Behinderung lernen den Umgang und Alltag mit Kindern die an einer Behinderung leiden, so erfahren die Relevanz von Toleranz und Rücksichtname. In integrativen Kindertagestätten kann jedes Kind nach dem aktuellen Entwicklungsstand gefördert aber auch gefordert werden. Durch die zahlreichen therapeutischen Angebote, werden sowohl Sprachentwicklung, Motorik und die Sozialen Kompetenzen gestärkt und ausgebaut.
Inhaltsverzeichnis
- Einführung
- Definitionen
- Definition Behinderung
- Definition Integration
- Problematiken bei Behinderungen
- Institutionelle Rahmenbedingungen und Gruppenstrukturen innerhalb integrativer Kindergärten
- Verteilung der Kindergartenplätze für Kinder mit und ohne Behinderung in einem Tortendiagramm
- Fallstudie in einem integrativen Kindergarten in Norwegen
- Interaktionsregeln
- Interaktion und Zusammenarbeit mit den Eltern
- Prinzipien in der Zusammenarbeit mit Eltern
- Qualität der sozialen Integration behinderter Kinder in integrativen Kindertagesstätten
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Ausarbeitung beleuchtet die Möglichkeiten der Entwicklung und Sozialisation von Kindern mit körperlichen und/oder geistigen Behinderungen in integrativen Kindertagesstätten. Im Fokus stehen die Herausforderungen und Chancen, die mit der Integration von Kindern mit besonderen Bedürfnissen verbunden sind, sowie die Bedeutung von Inklusion in der frühen Kindheit.
- Definitionen von Behinderung und Integration im pädagogischen Kontext
- Problematiken, die mit einer Behinderung im Alltag von Kindern einhergehen
- Institutionelle Rahmenbedingungen und Gruppenstrukturen in integrativen Kindergärten
- Verteilung von Kindergartenplätzen für Kinder mit und ohne Behinderung
- Fallstudie über Interaktion und Integration von Kindern mit und ohne Behinderung in einem norwegischen Kindergarten
Zusammenfassung der Kapitel
- Einführung: Die Einleitung präsentiert das Thema der Integration von Kindern mit Behinderungen in Kindertagesstätten und verdeutlicht die Relevanz der Inklusion für alle Kinder.
- Definitionen: Dieses Kapitel definiert die Begriffe Behinderung und Integration im pädagogischen Kontext und setzt sie in Bezug zur aktuellen Gesetzgebung und pädagogischen Praxis.
- Problematiken bei Behinderungen: Hier werden die häufigsten Herausforderungen und Sorgen von Eltern von Kindern mit Behinderungen beleuchtet, wie die Notwendigkeit erhöhter Unterstützung und die potenzielle Ablehnung durch andere Kinder.
- Institutionelle Rahmenbedingungen und Gruppenstrukturen: Dieser Abschnitt beschreibt die notwendigen Ressourcen und Strukturen in integrativen Kindergärten, wie multiprofessionelle Teams, barrierefreie Einrichtungen und die Bedeutung von Snoozle-Räumen für Kinder mit besonderen Bedürfnissen.
- Verteilung der Kindergartenplätze: Dieses Kapitel analysiert die Verteilung von Kindergartenplätzen für Kinder mit und ohne Behinderung anhand von Tortendiagrammen und zeigt die unterschiedlichen Modelle von Integration auf.
- Fallstudie in einem integrativen Kindergarten in Norwegen: Die Fallstudie aus einem norwegischen Kindergarten bietet Einblicke in die Interaktion von Kindern mit und ohne Behinderung und verdeutlicht die unterschiedlichen Herausforderungen, die mit geistigen und körperlichen Behinderungen einhergehen.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit den zentralen Themen der Integration und Inklusion von Kindern mit körperlichen und/oder geistigen Behinderungen in Kindertagesstätten. Die wichtigsten Schlüsselbegriffe sind: Behinderung, Integration, Inklusion, integrative Kindertagesstätten, multiprofessionelle Teams, Snoozle-Räume, Interaktion, soziale Kompetenzen, Fallstudie, Norwegen.
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Hauptthema dieser Ausarbeitung zur Integration?
Die Arbeit untersucht die Möglichkeiten der Entwicklung und Sozialisation von Kindern mit körperlichen oder geistigen Behinderungen in integrativen Kindertagesstätten.
Welche Vorteile bietet ein integrativer Kindergarten für Kinder ohne Behinderung?
Kinder ohne Behinderung lernen im Alltag den Umgang mit beeinträchtigten Gleichaltrigen und erfahren so die Relevanz von Toleranz, Rücksichtnahme und sozialer Kompetenz.
Was sind die institutionellen Rahmenbedingungen für integrative Kitas?
Dazu gehören multiprofessionelle Teams, barrierefreie Einrichtungen und spezielle Angebote wie Snoozle-Räume zur individuellen Förderung und Entspannung.
Worum geht es in der Fallstudie aus Norwegen?
Die Fallstudie gibt Einblicke in die Interaktion zwischen Kindern mit und ohne Behinderung in einem norwegischen Kindergarten und verdeutlicht die Herausforderungen bei verschiedenen Behinderungsarten.
Wie wichtig ist die Zusammenarbeit mit den Eltern?
Die Zusammenarbeit ist zentral; die Arbeit beleuchtet Interaktionsregeln und Prinzipien, um die soziale Integration der Kinder gemeinsam mit den Eltern bestmöglich zu gestalten.
- Citar trabajo
- Saskia Blüm (Autor), 2017, Entwicklung und Sozialisation behinderter Kinder in integrativen Kindertagesstätten, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/458004