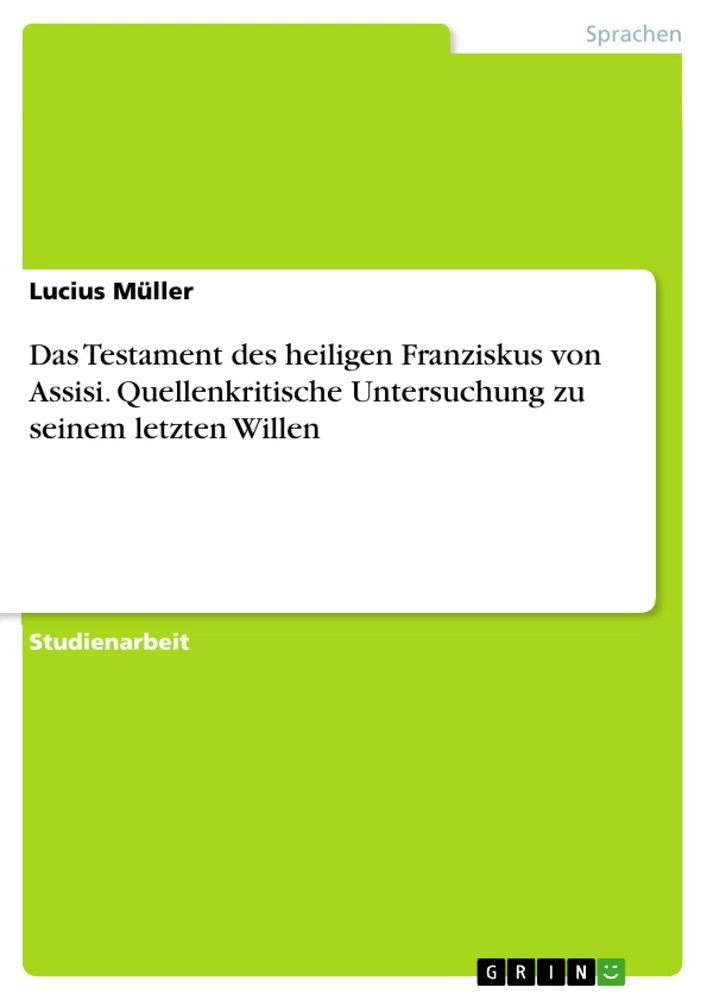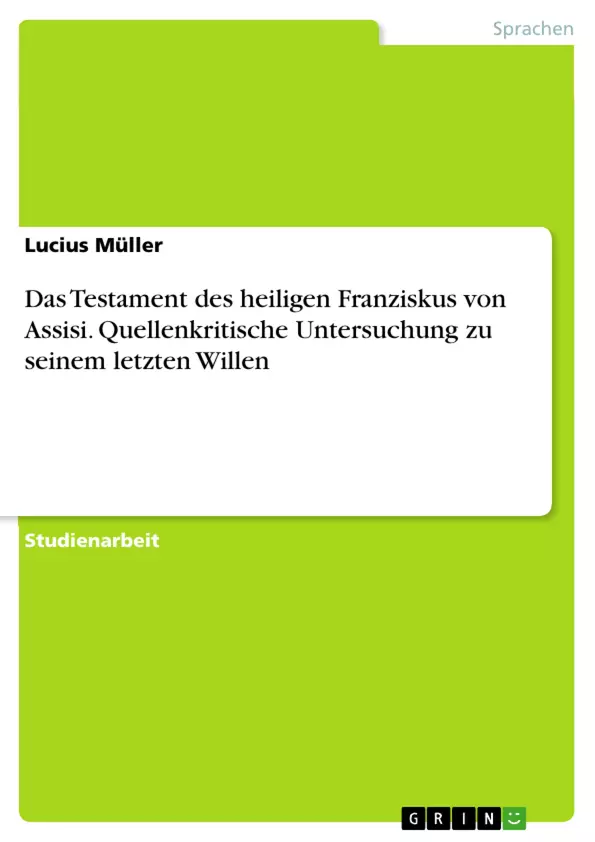Es sind vor allem sein vorbehaltsloses Gelübde zur Armut und Christusnachfolge und die tiefe Überzeugung mit welcher er für seine Gesinnung einstand, die Franziskus von Assisi als Ordensbegründer auszeichneten. In seinen letzten Lebensjahren fand jedoch eine Abkehr der Bruderschaft von ihren radikalen Anfängen statt. Die immens angewachsene Gemeinschaft der Minderbrüder entwickelte sich mehr und mehr zu einem gemäßigten, kirchlich-regulierten Orden. Vor dem Hintergrund dieser Entwicklungen ließ der totkranke Franziskus von Assisi vermutlich seinen letzten Willen festhalten, welcher uns heute durch Überlieferungen als sein Testament bekannt ist. Ausgehend davon richtet sich die Leitfrage der vorliegenden Arbeit nach der Bedeutung, die dem Testament im Rahmen der von Franziskus begründeten Glaubensbewegung zugeschrieben werde kann.
Den ersten Schwerpunkt der Arbeit bildet der historische Kontext unter welchem das Testament zu betrachten ist. Es werden zu diesem Zweck die Grundzüge der hochmittelalterlichen Bettelorden dargelegt. Hierbei liegt unser Fokus insbesondere auf den Fragen inwiefern sich die Bettelorden von vorrangegangenen Armutsbewegungen unterscheiden und inwiefern Franziskus mit deren Idealen konform war. Anschließend folgt eine Betrachtung zum Lebensweg des heiligen Franziskus, um darin Bezüge zu seinem Testament herauszuarbeiten.
Den zweiten Schwerpunkt bildet eine quellenkritische Betrachtung des Testaments Hierzu werden die Quelle und ihre Überlieferung vorgestellt. Zudem wird die Frage nach der Echtheit des Testaments thematisiert. Anschließend werden die inhaltlichen Aspekte des Testaments skizziert, sowie die wesentlichen Bezüge zu Franziskus Leben und seinem letzten Willen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Fragestellung
- Quellen- und Literaturbericht
- Methode und Aufbau der Arbeit
- Historischer Kontext
- Grundzüge der Bettelorden
- Der Lebensweg des heiligen Franziskus
- Problematik einer objektiven Lebensbeschreibung
- Schlüsselereignisse im Leben des Franziskus
- Ordensentwicklung während der letzten Lebensjahre
- Quellenkritische Betrachtung des Testaments
- Quellenbeschreibung und äußere Kritik
- Inhaltliche Aspekte des Testaments
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit befasst sich mit dem Testament des Heiligen Franziskus von Assisi und untersucht dessen Bedeutung im Rahmen der von ihm gegründeten Glaubensbewegung.
- Die Entstehung des Testaments im Kontext der Abkehr von den radikalen Anfängen der Franziskanerbrüder.
- Die Quellenkritik und Echtheitsdiskussion des Testaments.
- Die Analyse der Kernaussagen des Testaments und deren Bezüge zu Franziskus' Leben und seinem letzten Willen.
- Die Intentionen Franziskus' bei der Erstellung des Testaments.
- Die Bedeutung des Testaments für die Franziskanische Bewegung.
Zusammenfassung der Kapitel
- Die Einleitung führt in die Fragestellung der Arbeit ein und beleuchtet die historische Entwicklung der Franziskanerbrüder. Dabei wird insbesondere die Abkehr von den ursprünglichen Armuts- und Christusnachfolge-Idealen im Kontext der wachsenden Gemeinschaft und des Einflusses der neuen Ordensleitung und des Papstes thematisiert.
- Das zweite Kapitel beleuchtet den historischen Kontext des Testaments und erläutert die Grundzüge der Bettelorden im Hochmittelalter, die sich von vorangegangenen Armutsbewegungen abgrenzen und eine aktive Verbreitung des Evangeliums durch Seelsorge, Lehre und Predigt anstreben. Die Kapitel behandelt zudem das Leben des Heiligen Franziskus, inklusive der Problematik einer objektiven Lebensbeschreibung, Schlüsselereignisse und die Entwicklung des Ordens in seinen letzten Lebensjahren.
- Das dritte Kapitel konzentriert sich auf die quellenkritische Betrachtung des Testaments. Neben der Beschreibung der Quelle und ihrer Überlieferung werden die Echtheitsdebatte und die wichtigsten Forschungsergebnisse dazu beleuchtet. Anschließend werden die inhaltlichen Aspekte des Testaments anhand eines Schemas von Kajetan Esser analysiert.
Schlüsselwörter
Das Testament des Heiligen Franziskus von Assisi, Bettelorden, Franziskaner, Armutsideal, Christusnachfolge, Quellenkritik, Echtheit, Lebensweg, Ordensentwicklung, Vita apostolica.
- Citation du texte
- Lucius Müller (Auteur), 2013, Das Testament des heiligen Franziskus von Assisi. Quellenkritische Untersuchung zu seinem letzten Willen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/458086