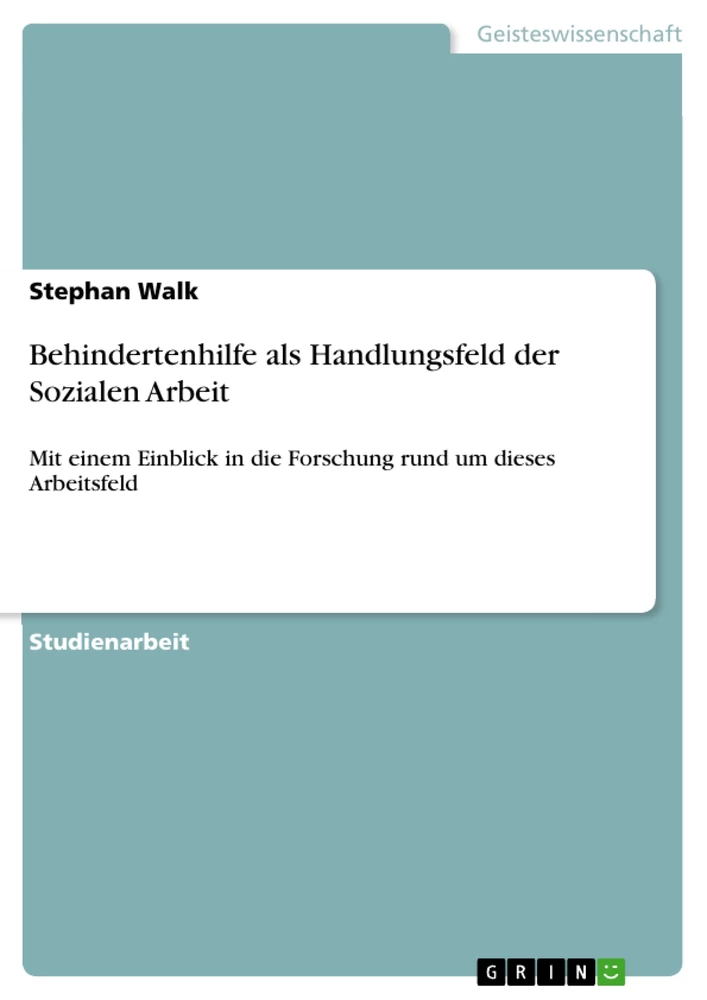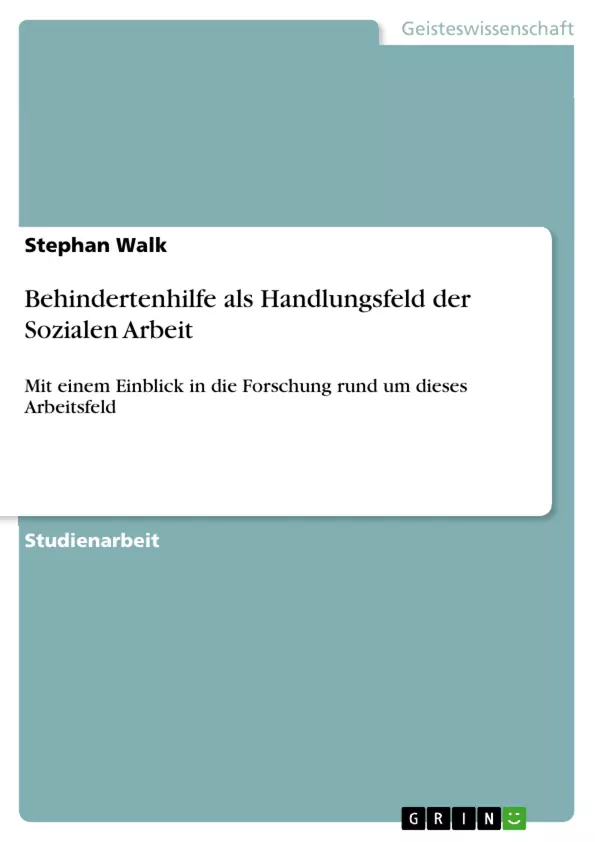Die vorliegende Arbeit widmet sich einem Handlungsfeld der Sozialen Arbeit- der Behindertenhilfe und gibt dabei einen tieferen Einblick in die professionelle Arbeit mit den Betroffenen, aber auch in die Forschung rund um dieses Arbeitsfeld. Dabei wird insbesondere folgenden Leitfragen nachgegangen:
Was wird in beziehungsweise zu diesem Arbeitsfeld geforscht?
Welche Professionen forschen in diesem Feld?
Lassen sich die Forschungsergebnisse auf bestimmte Art und Weise clustern?
Finden sich Spuren von Theorien der Sozialen Arbeit in der Forschung zu diesem Handlungsfeld?
Inhaltsverzeichnis
- 1.0 Einleitung und thematische Hinführung
- 2.0 Zum Umgang mit verkörpertem Anders-Sein in der Geschichte
- 3.0 Professionelles sozialarbeiterisches Handeln im Feld der Behindertenhilfe und seine inhaltliche Beschreibung
- 4.0 Wer die Forschenden im Feld der Behindertenhilfe sind und wofür sie sich interessieren
- 5.0 Spuren von Theorien der Sozialen Arbeit in der Forschung zum Handlungsfeld der Behindertenhilfe
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht das Handlungsfeld der Behindertenhilfe in der Sozialen Arbeit und beleuchtet exemplarisch die dazugehörige Forschung. Ziel ist es, das Handlungsfeld anhand historischer Perspektiven auf den Umgang mit „verkörpertem Anders-Sein“, der professionellen Praxis Sozialer Arbeit in der Behindertenhilfe, der beteiligten Forschenden und ihren Forschungsfragen sowie dem Einfluss sozialarbeitswissenschaftlicher Theorien zu beschreiben.
- Historischer Umgang mit Behinderung
- Professionelles sozialarbeiterisches Handeln in der Behindertenhilfe
- Forschungsfragen und -akteure im Feld der Behindertenhilfe
- Einfluss sozialarbeitswissenschaftlicher Theorien auf die Forschung
Zusammenfassung der Kapitel
1.0 Einleitung und thematische Hinführung: Die Einleitung skizziert den Forschungsgegenstand: die Erforschung des Handlungsfeldes Behindertenhilfe in der Sozialen Arbeit. Sie kündigt die methodische Vorgehensweise an, die einen historischen Überblick über den Umgang mit Behinderung, eine Beschreibung professionellen sozialarbeiterischen Handelns, die Vorstellung der Forschenden und ihrer Interessen sowie die Analyse des Einflusses sozialarbeitswissenschaftlicher Theorien umfasst. Das Gender Mainstreaming wird als Konzept genannt, das die Arbeit leitet.
2.0 Zum Umgang mit verkörpertem Anders-Sein in der Geschichte: Dieses Kapitel bietet einen geschichtlichen Überblick über den Umgang mit Behinderung, beginnend mit dem Mittelalter. Es zeigt, wie Menschen mit Behinderung von Almosen abhängig waren und wie sich ihre soziale Stellung im Kontext von Verstädterung, Industrialisierung und der Reformation veränderte. Die Entwicklung von Armenhäusern, Arbeitshäusern und später spezialisierten Einrichtungen wird beschrieben, ebenso wie der Wandel des Menschenbildes von der göttlichen Bestrafung hin zum medizinischen Problem. Die Kapitel beschreibt die Rolle des aufkommenden Sozialstaates und die Entstehung eugenischer Ideen, die im Nationalsozialismus ihren grausamen Höhepunkt fanden.
3.0 Professionelles sozialarbeiterisches Handeln im Feld der Behindertenhilfe und seine inhaltliche Beschreibung: Dieses Kapitel würde die professionelle Praxis Sozialer Arbeit im Feld der Behindertenhilfe detailliert beschreiben. Es würde die spezifischen Arbeitsweisen, Interventionen, ethischen Herausforderungen und den rechtlichen Rahmen der Sozialarbeit in diesem Kontext beleuchten. Es könnte auch auf die Zusammenarbeit mit anderen Berufsgruppen und die Bedeutung von Inklusion eingehen.
4.0 Wer die Forschenden im Feld der Behindertenhilfe sind und wofür sie sich interessieren: Dieses Kapitel würde die Forschenden im Feld der Behindertenhilfe vorstellen, ihre Forschungsinteressen und Methoden beleuchten. Es könnte verschiedene Forschungsansätze und Perspektiven beschreiben und die Bedeutung interdisziplinärer Zusammenarbeit hervorheben.
5.0 Spuren von Theorien der Sozialen Arbeit in der Forschung zum Handlungsfeld der Behindertenhilfe: Dieses Kapitel würde untersuchen, wie sozialarbeitswissenschaftliche Theorien die Forschung im Bereich der Behindertenhilfe beeinflussen. Es könnte verschiedene Theorien und ihre Relevanz für die Praxis analysieren und zeigen, wie diese Theorien in empirischen Studien angewendet werden.
Schlüsselwörter
Behinderung, Soziale Arbeit, Behindertenhilfe, Geschichte der Behinderung, Professionelles Handeln, Inklusion, Forschung, Sozialarbeitswissenschaftliche Theorien, Gender Mainstreaming.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zum Dokument: Forschung im Handlungsfeld Behindertenhilfe
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht das Handlungsfeld der Behindertenhilfe in der Sozialen Arbeit und beleuchtet exemplarisch die dazugehörige Forschung. Sie beschreibt das Handlungsfeld anhand historischer Perspektiven auf den Umgang mit „verkörpertem Anders-Sein“, der professionellen Praxis Sozialer Arbeit in der Behindertenhilfe, der beteiligten Forschenden und ihren Forschungsfragen sowie dem Einfluss sozialarbeitswissenschaftlicher Theorien.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Themen: den historischen Umgang mit Behinderung, professionelles sozialarbeiterisches Handeln in der Behindertenhilfe, Forschungsfragen und -akteure im Feld der Behindertenhilfe sowie den Einfluss sozialarbeitswissenschaftlicher Theorien auf die Forschung. Das Gender Mainstreaming dient als leitendes Konzept.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in fünf Kapitel: Eine Einleitung mit thematischer Hinführung, ein Kapitel zum historischen Umgang mit "verkörpertem Anders-Sein", ein Kapitel zur professionellen Praxis Sozialer Arbeit in der Behindertenhilfe, ein Kapitel zu den Forschenden im Feld der Behindertenhilfe und ihren Forschungsinteressen, und ein Kapitel zum Einfluss sozialarbeitswissenschaftlicher Theorien auf die Forschung in diesem Feld.
Wie wird der historische Umgang mit Behinderung dargestellt?
Das Kapitel zum historischen Umgang mit Behinderung bietet einen Überblick vom Mittelalter bis in die Gegenwart. Es beleuchtet die Abhängigkeit von Almosen, den Wandel der sozialen Stellung im Kontext von Verstädterung, Industrialisierung und Reformation, die Entwicklung von Armenhäusern und spezialisierten Einrichtungen, den Wandel des Menschenbildes und die Rolle des Sozialstaates sowie die Entstehung eugenischer Ideen und deren Höhepunkt im Nationalsozialismus.
Wie wird professionelles sozialarbeiterisches Handeln beschrieben?
Das Kapitel zum professionellen sozialarbeiterischen Handeln beschreibt detailliert die Praxis Sozialer Arbeit in der Behindertenhilfe. Es beleuchtet Arbeitsweisen, Interventionen, ethische Herausforderungen, den rechtlichen Rahmen, die Zusammenarbeit mit anderen Berufsgruppen und die Bedeutung von Inklusion.
Wer sind die Forschenden im Feld der Behindertenhilfe?
Das Kapitel zu den Forschenden stellt die Akteure im Feld der Behindertenhilfe vor, beleuchtet ihre Forschungsinteressen und -methoden, beschreibt verschiedene Forschungsansätze und Perspektiven und hebt die Bedeutung interdisziplinärer Zusammenarbeit hervor.
Welchen Einfluss haben sozialarbeitswissenschaftliche Theorien?
Das Kapitel zum Einfluss sozialarbeitswissenschaftlicher Theorien analysiert, wie diese Theorien die Forschung im Bereich der Behindertenhilfe beeinflussen. Es untersucht verschiedene Theorien und ihre Relevanz für die Praxis und zeigt deren Anwendung in empirischen Studien.
Welche Schlüsselwörter sind relevant?
Wichtige Schlüsselwörter sind: Behinderung, Soziale Arbeit, Behindertenhilfe, Geschichte der Behinderung, Professionelles Handeln, Inklusion, Forschung, Sozialarbeitswissenschaftliche Theorien, Gender Mainstreaming.
- Arbeit zitieren
- Stephan Walk (Autor:in), 2018, Behindertenhilfe als Handlungsfeld der Sozialen Arbeit, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/459442