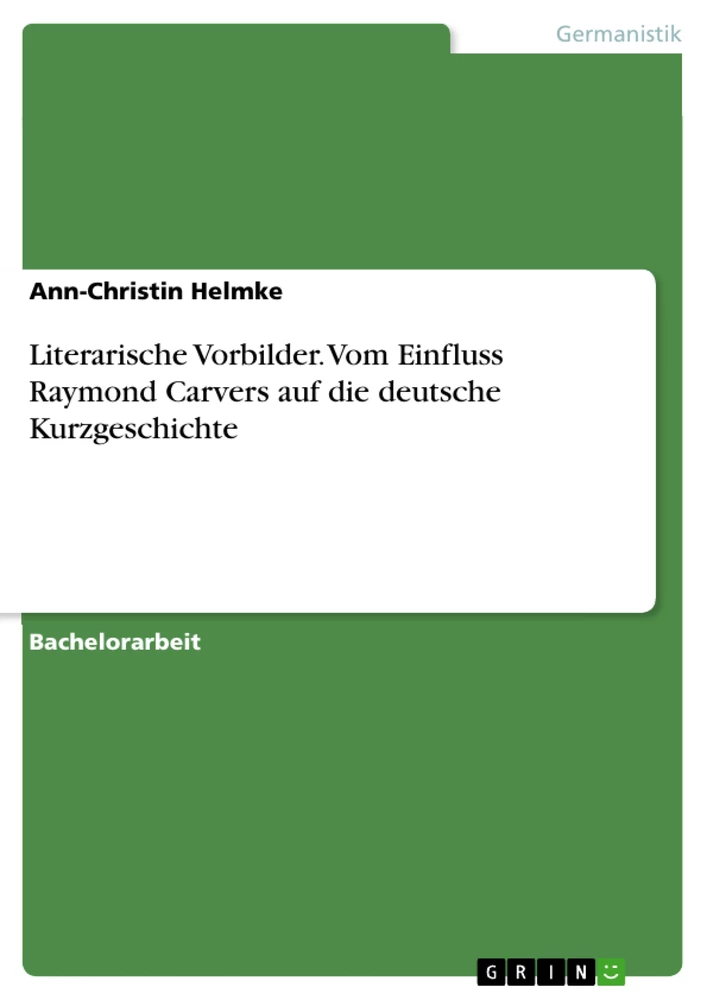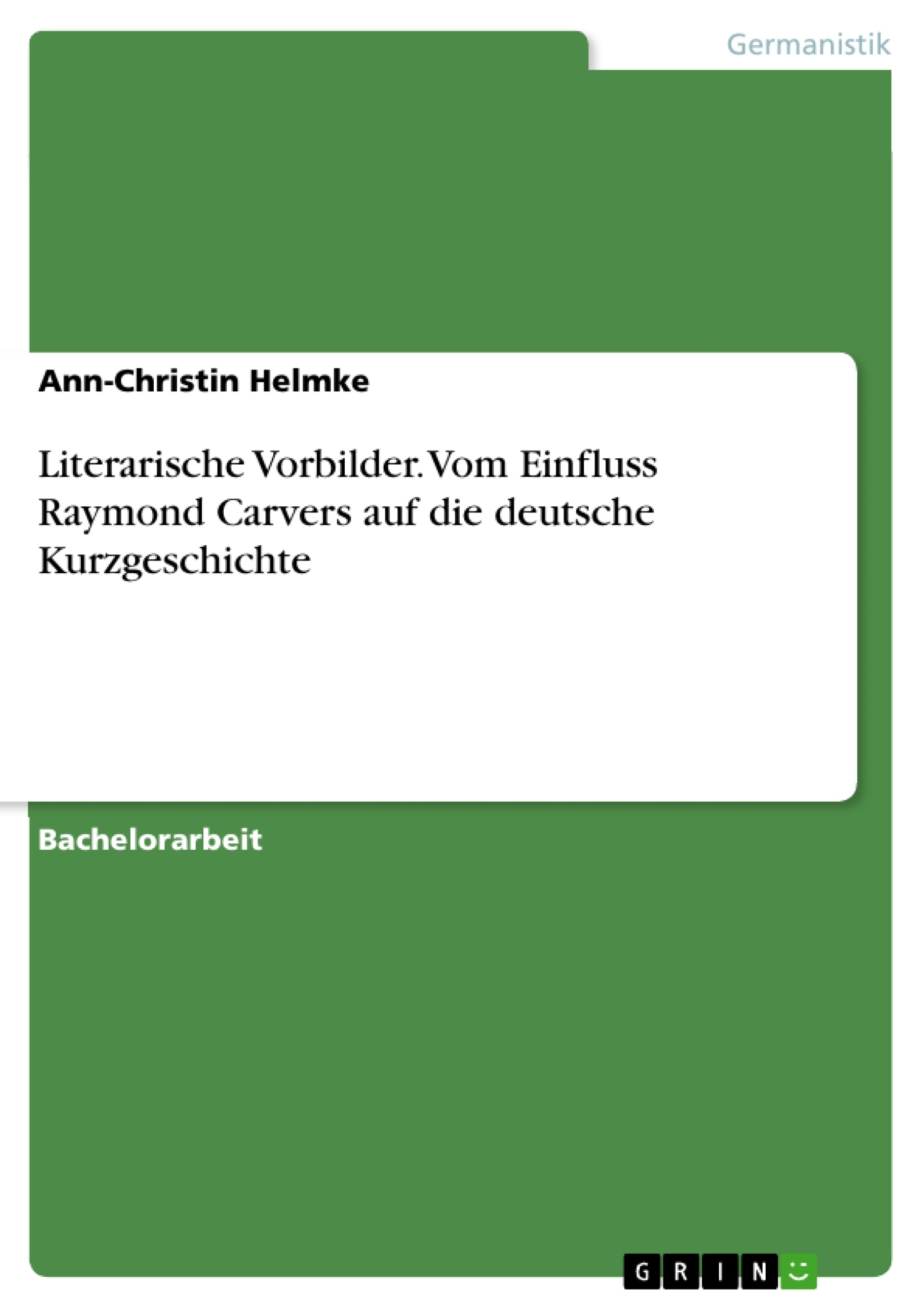Diese Bachelor-Thesis untersucht den Einfluss, den Carver auf Ingo Schulze, Judith Hermann und Peter Stamm hat, und geht der Frage nach, ob dieser Einfluss in den Texten nachgewiesen werden kann, oder ob er ein Konstrukt des Feuilletons ist. Hierfür wird zunächst das Genre der American Short Story mit dem der deutschen Kurzgeschichten gegenübergestellt.
Für diese Grundlagen wird sich hauptsächlich auf Anne-Rose Meyers Einführung Die deutschsprachige Kurzgeschichte (2014) gestützt, da sie die Forschung damit nicht nur auf den neuesten Stand bringt, sondern eine Lücke zwischen 1990er-Jahren und der Gegenwart schließt. Gleichzeitig lehnt sich die Struktur dieser Arbeit an ihrer Vorgehensweise an. Meyer verfolgt einen kombinierten Ansatz aus deduktiver und induktiver Methode: Sie generiert zunächst ein grundlegendes Gattungsverständnis und überprüft dieses mittels exemplarischen Analysen.
Der darauffolgende Teil konzentriert sich auf die Selbstauskünfte der Autoren, in Form von Paratexten wie Interviews und Vorworten. Demgegenüber stehen die Einordnung und Konstruktion der Medien, insbesondere ausgewählte Rezensionen und Etikettierungen des Feuilletons und der Sendung Das literarische Quartett, in der die Texte der vier Autoren besprochen worden sind.
Daran schließt sich eine vergleichende Text- und Stilanalyse an. Ausgehend von Carvers Short Story Was ist denn? wird ein Profil erstellt, das exemplarisch für seine Prosa steht. In gleicher Weise werden Hermanns Sonja, Stamms Passion und Schulzes Simple Storys analysiert und zu Carvers Profil in Beziehung gesetzt.
Im Fazit wird das Verhältnis der Paratexte zu den Primärtexten betrachtet und abschließend diskutiert, ob die Verbindung der Autoren zueinander stilistischer und inhaltlicher Natur ist, oder von den Akteuren des Feuilletons konstruiert wurde.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung.
- 2. Definitionen und Merkmale der Kurzgeschichte und Short Story.
- 2.1 Short Story vs. Kurzgeschichte
- 2.2 Die Short Story der 1970er-Jahre.......
- 2.3 Die Kurzgeschichte der 1990er-Jahre....
- 3. Die Autoren und ihre Zeit: Fremd- und Selbstbild
- 3.1 Selbstauskünfte der Autoren.
- 3.2 Stimmen aus dem Literarischen Quartett...
- 3.3 Echo aus dem Feuilleton...
- 4. Text- und Stilanalyse...
- 4.1 Raymond Carver: Was ist denn?.
- 4.2 Judith Hermann: Sonja...
- 4.3 Peter Stamm: Passion
- 4.4 Ingo Schulze: Simple Storys....
- 4.5 Ergebnisse.......
- 5. Fazit.........
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Bachelor-Thesis untersucht den Einfluss, den Carver auf die drei erwähnten Autoren hat, und geht der Frage nach, ob dieser Einfluss in den Texten nachgewiesen werden kann, oder ob er ein Konstrukt des Feuilletons ist. Hierfür wird zunächst das Genre der American Short Story mit dem der deutschen Kurzgeschichten gegenübergestellt.
- Gegenüberstellung der Gattungen American Short Story und deutsche Kurzgeschichte
- Analyse der Selbstauskünfte der Autoren in Form von Paratexten
- Einordnung und Konstruktion der Medien, insbesondere ausgewählte Rezensionen und Etikettierungen des Feuilletons und der Sendung Das literarische Quartett
- Vergleichende Text- und Stilanalyse der Werke von Carver, Hermann, Stamm und Schulze
- Beziehung zwischen Paratexten und Primärtexten sowie die Frage, ob die Verbindung der Autoren zueinander stilistischer und inhaltlicher Natur ist, oder von den Akteuren des Feuilletons konstruiert wurde
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel führt in die Thematik ein und stellt die Forschungsfrage nach dem Einfluss von Raymond Carver auf drei deutsche Autoren. Kapitel 2 beschäftigt sich mit den gattungstypischen Merkmalen der Kurzgeschichte und der American Short Story, um ein gemeinsames Fundament für die spätere Text- und Stilanalyse zu legen. In Kapitel 3 werden Selbstauskünfte der Autoren, Einordnungen des Feuilletons und Stimmen aus dem Literarischen Quartett analysiert, um ein differenziertes Bild der Rezeption von Carvers Werk in Deutschland zu zeichnen. Kapitel 4 widmet sich einer vergleichenden Text- und Stilanalyse, wobei die Werke von Carver, Hermann, Stamm und Schulze exemplarisch untersucht werden. Das Kapitel 5 fasst die Ergebnisse zusammen und diskutiert die Beziehung zwischen Paratexten und Primärtexten, um die Frage zu beantworten, ob die Verbindung der Autoren zueinander von den Akteuren des Feuilletons konstruiert wurde oder tatsächlich stilistische und inhaltliche Gemeinsamkeiten aufweist.
Schlüsselwörter
Die Arbeit beschäftigt sich mit den Themen Short Story, deutsche Kurzgeschichte, Raymond Carver, Judith Hermann, Ingo Schulze, Peter Stamm, Text- und Stilanalyse, Feuilleton, Literaturkritik, Einfluss, Genre, Vergleichende Literaturwissenschaft, Paratexte, Primärtexte.
Häufig gestellte Fragen
Wie beeinflusste Raymond Carver die deutsche Kurzgeschichte?
Carver gilt als Vorbild für viele deutsche Autoren der 90er Jahre, insbesondere durch seinen minimalistischen Stil und die Darstellung des Alltagslebens.
Welche deutschen Autoren werden mit Carver in Verbindung gebracht?
Die Arbeit analysiert den Einfluss auf Judith Hermann, Peter Stamm und Ingo Schulze und prüft, ob dieser Einfluss stilistisch nachweisbar ist.
Ist der Einfluss von Carver real oder ein Konstrukt des Feuilletons?
Die Thesis untersucht, ob die stilistischen Ähnlichkeiten tatsächlich in den Texten existieren oder ob Medien wie „Das literarische Quartett“ diese Verbindung erst geschaffen haben.
Was unterscheidet die American Short Story von der deutschen Kurzgeschichte?
Die Arbeit vergleicht die Gattungsmerkmale beider Formen, insbesondere im Hinblick auf Erzähltechnik, Kürze und die Tradition der 1970er (USA) vs. 1990er Jahre (Deutschland).
Welche Werke werden in der Stilanalyse verglichen?
Untersucht werden unter anderem Carvers „Was ist denn?“, Hermanns „Sonja“, Stamms „Passion“ und Schulzes „Simple Storys“.
- Citation du texte
- Bachelor of Arts Ann-Christin Helmke (Auteur), 2014, Literarische Vorbilder. Vom Einfluss Raymond Carvers auf die deutsche Kurzgeschichte, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/459644