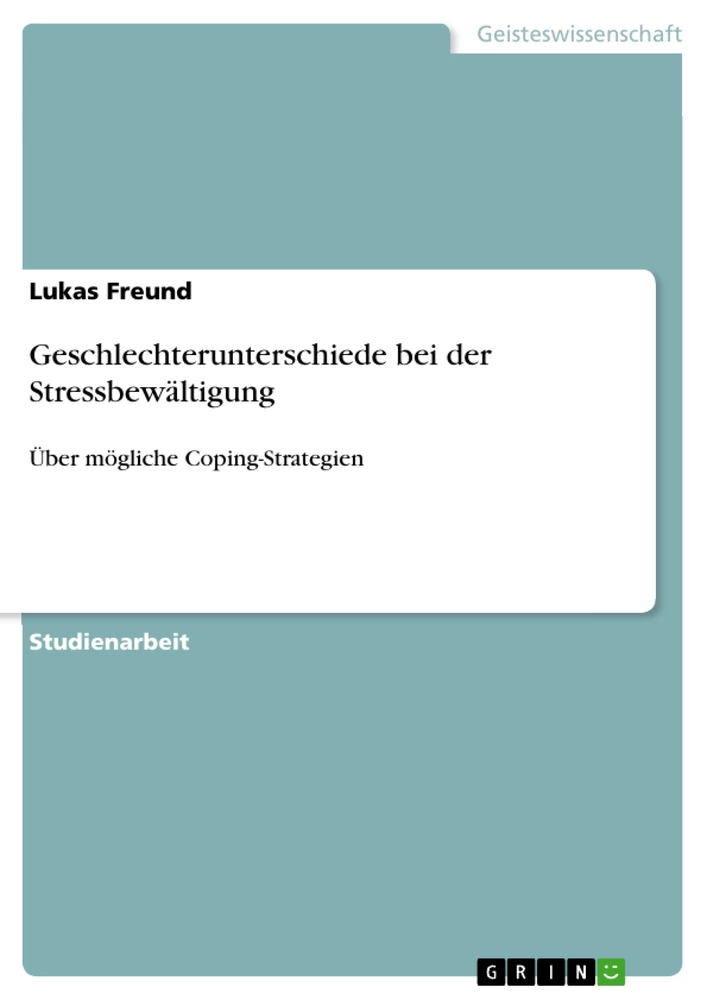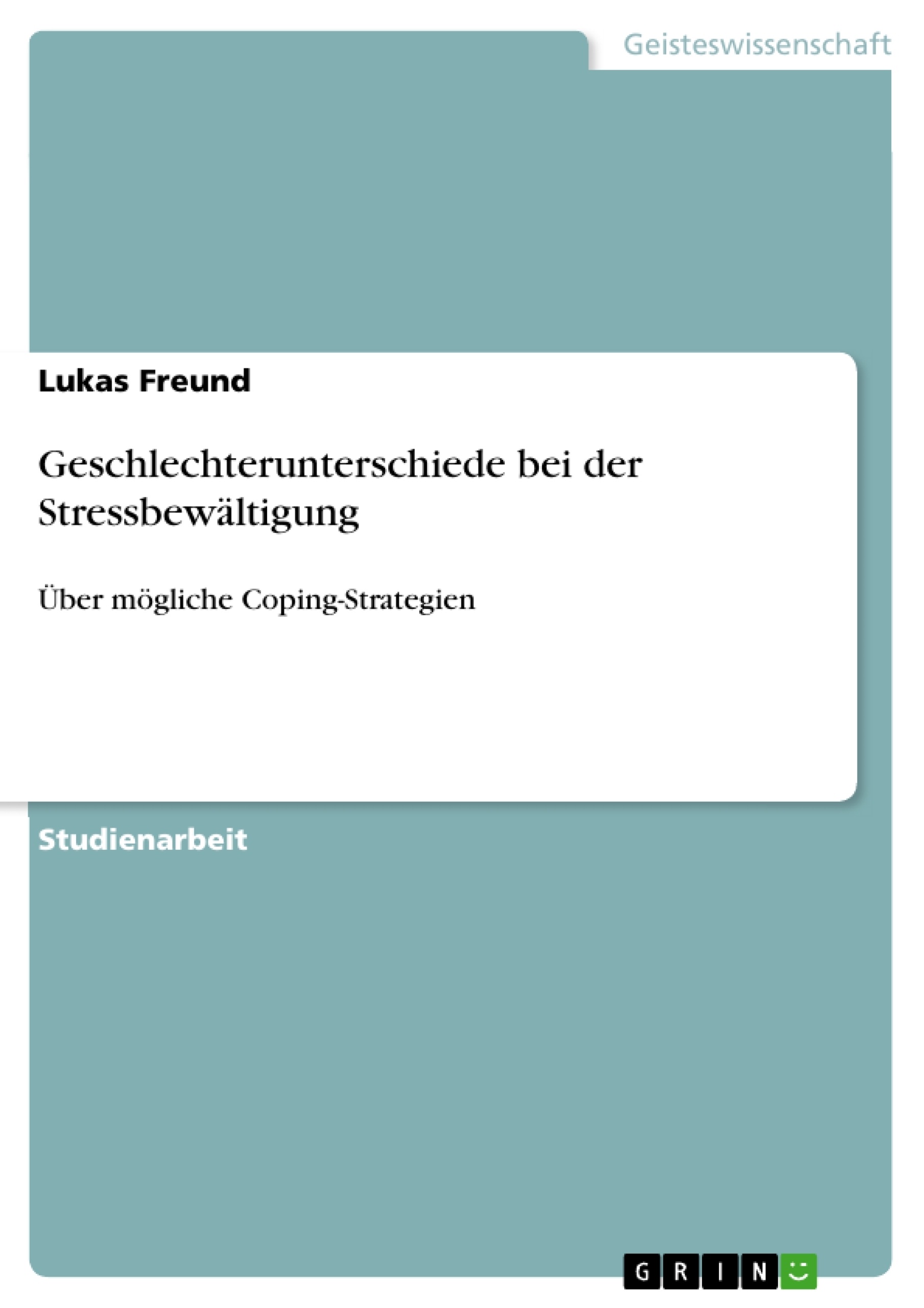Diese Arbeit untersucht die Geschlechterunterschiede bei der Stressbewältigung. Es geht dabei um die Strategien zur Bewältigung von Stress und wie diese von Männern und Frauen, unterschiedlich oder gleichwertig, genutzt werden. Betrachtet man die Forschungen der letzten 30 Jahre, so stellt man fest, dass die Erforschung und Vermeidung von Stress als solche im Vordergrund zu stehen scheint. Doch was wäre, wenn die Vermeidung von Stress, gerade in der heutigen Gesellschaft gar nicht, oder nur durch sehr große Mühen, bewerkstelligt werden könnte? In Folge dessen würde der Umgang mit Stress, also Bewältigungsstrategien, das sogenannte Coping, immer mehr an Relevanz gewinnen. Sicherlich lassen sich viele Gründe für ein unterschiedliches Coping-Verhalten finden, wobei doch der elementarste aller Unterschiede gewiss deutlich signifikante Ergebnisse hervorbringen sollte.
Die Fragestellung lautet: Gibt es Geschlechterunterschiede bei der Art (zum Beispiel Aktives Coping oder sozial-/emotionales Coping) und Ausprägung von Stressbewältigung? Mithilfe einer Fragebogenstudie zu Stress, Coping und psychologischem Wohlbefinden werden 180 Oberstufenschüler bezüglich des erlebten Schulstresses befragt. Es lässt sich eine klare Tendenz zu Geschlechterunterschieden bei der Stressbewältigung ableiten. Zwar sind die Unterschiede dieser Versuchsgruppe nicht sehr hoch, doch lassen sich diese durchweg bei allen berechneten Subskalen feststellen.
Auch in Zukunft wird das Thema Stress und Stressbewältigung nicht an Relevanz für Alltag und für die Wissenschaft verlieren. Leistungsdruck an Schulen und im Berufsleben, der immer stressiger werdende Alltag in Zeiten von Smartphones und Internet, sowie die durch Emanzipation hervorgerufene geschlechterspezifische Veränderung im Rollenverhalten von Mann und Frau, sorgen für eine weiterhin rasant wachsende Anzahl von Stressoren im Lebens jedes einzelnen. Deshalb wird auch immer entscheidender, wie am besten mit Stress umgegangen werden kann, um gesundheitliche Problemen vorbeugen zu können. Mit dem Burnout-Syndrom als Vorbild, muss in Zukunft wesentlich ernster und sensibler mit dem Thema "Stress und Stressbewältigung" umgegangen werden. Sei es im Alltag oder im Berufsleben, Stress bleibt ein an Brisanz zunehmender Begleitfaktor, auf den man schon frühzeitig und vorbeugend reagieren muss.
Inhaltsverzeichnis
- Zusammenfassung
- Einleitung
- Theorie und Herleitung der Fragestellung
- Methoden
- Stichprobe
- Vorgehen
- Statistische Analyse
- Diskussion
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit untersucht Geschlechterunterschiede in der Stressbewältigung von Oberstufenschülern. Basierend auf den Theorien von Lazarus und Folkman, sowie Cannon, wird analysiert, ob sich die Stressbewältigungsstrategien von männlichen und weiblichen Schülern signifikant unterscheiden.
- Stress als Reaktion und Transaktion
- Genderunterschiede in der Stressbewältigung
- Einfluss von Stressoren und Bewältigungsstrategien
- Empirische Untersuchung von Geschlechterunterschieden
Zusammenfassung der Kapitel
- Zusammenfassung: Die Zusammenfassung der Arbeit fasst die zentralen Ergebnisse und Schlussfolgerungen zusammen.
- Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema Stressbewältigung und Geschlechterunterschiede ein und erläutert die Relevanz der Forschungsfrage.
- Theorie und Herleitung der Fragestellung: Dieses Kapitel beleuchtet verschiedene Ansätze in der Psychologie zur Erforschung von Stress, darunter den Situationsansatz, den Output-Ansatz und den Transaktionalen Ansatz.
- Methoden: Hier werden die Methodik und die angewandten Verfahren der Studie, wie z.B. die Stichprobenziehung und die Fragebogenstudie, detailliert dargestellt.
- Statistische Analyse: Dieses Kapitel präsentiert die statistischen Auswertungen der erhobenen Daten und liefert relevante Ergebnisse zur Stressbewältigung.
- Diskussion: Die Diskussion der Ergebnisse setzt die Studienergebnisse in Bezug zu bestehenden Theorien und stellt die Bedeutung der Ergebnisse für die Forschung und Praxis heraus.
Schlüsselwörter
Stress, Coping, Geschlechterunterschiede, Stressbewältigung, Oberstufenschüler, Transaktionaler Ansatz, Lazarus, Folkman, Cannon, Empirische Forschung, Fragebogenstudie
Häufig gestellte Fragen
Gibt es signifikante Geschlechterunterschiede bei der Stressbewältigung?
Ja, die Studie an 180 Oberstufenschülern zeigt eine klare Tendenz zu Unterschieden in der Art (z.B. aktives vs. emotionales Coping) und Ausprägung der Bewältigungsstrategien.
Was versteht man unter "Coping"?
Coping bezeichnet die Strategien und Verhaltensweisen, die Menschen einsetzen, um mit belastenden Situationen und Stressoren umzugehen.
Was ist der transaktionale Ansatz nach Lazarus?
Dieser Ansatz sieht Stress nicht nur als Reaktion, sondern als Wechselwirkung (Transaktion) zwischen der Person und der Umwelt, wobei die individuelle Bewertung der Situation entscheidend ist.
Warum nimmt Stress in der modernen Gesellschaft zu?
Faktoren wie Leistungsdruck, ständige Erreichbarkeit durch Smartphones und Internet sowie sich wandelnde Geschlechterrollen erhöhen die Anzahl der täglichen Stressoren.
Welche Rolle spielt Stressbewältigung für die Gesundheit?
Ein gesunder Umgang mit Stress ist entscheidend, um psychischen Problemen wie dem Burnout-Syndrom vorzubeugen.
- Citation du texte
- Lukas Freund (Auteur), 2014, Geschlechterunterschiede bei der Stressbewältigung, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/462088