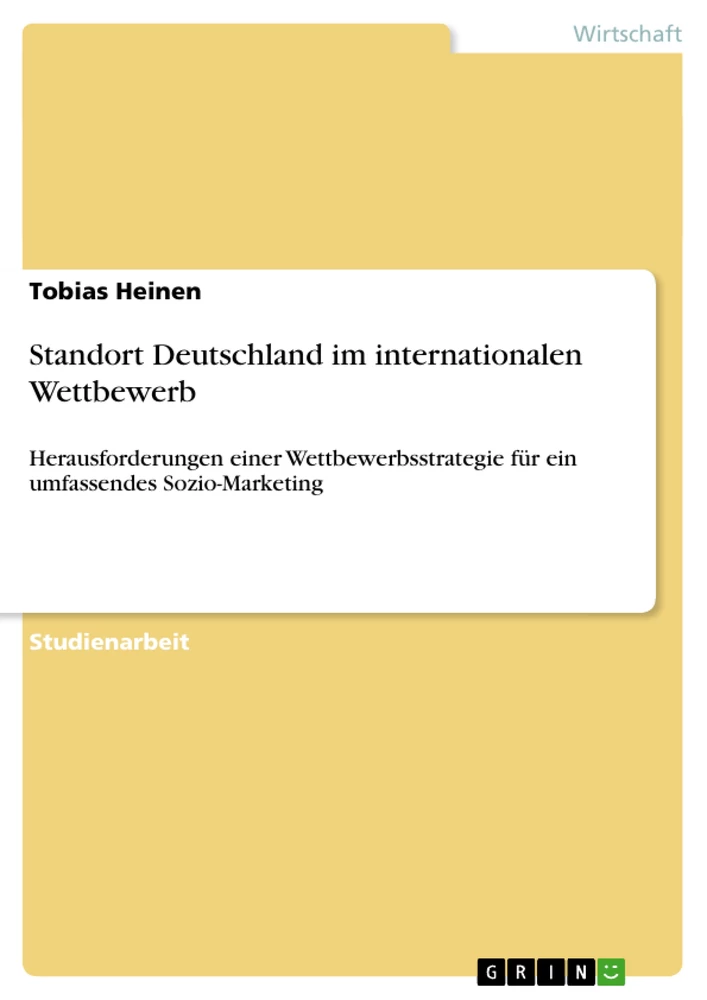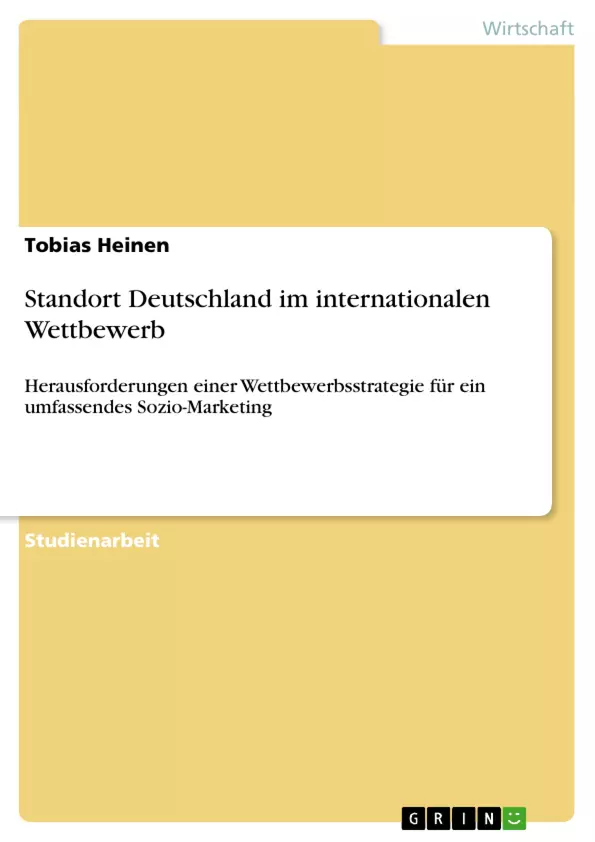Die Bedeutung der internationalen Wirtschaftstätigkeit und der Globalisierung ist für Unternehmen, Branchen und ganze Volkswirtschaften im Zeitverlauf gestiegen (vgl. Perlitz 1994, S. 9). Unternehmen, die heute und in Zukunft ihre Marktchancen sichern oder erweitern wollen, müssen im internationalen Geschäft agieren. Wie aktuelle Beispiele zeigen, kann das Wohl ganzer Volkswirtschaften durch das internationale Umfeld bestimmt werden. Immer mehr ehemalige Entwicklungsländer und Schwellenländer treten in den Markt und verdrängen etablierte Industrieländer (vgl. Perlitz 2004, S. 2-3). Auch innerhalb der Europäischen Union kommt es zu Veränderungen zwischen den Ländern. Das globale Wettbewerbsgefüge ist im Umbruch und stellt sich neu auf.
Ziel dieser Arbeit ist, vor diesem Hintergrund aufzuzeigen, unter welchen Bedingungen ein Land als wettbewerbsfähig gilt und wie sich die Wettbewerbsfähigkeit von Nationen systematisieren und theoretisch fundieren lässt. Des Weiteren soll erarbeitet werden, wie sie sich nachhaltig von Institutionen wie dem Staat, den Unternehmen oder den Mitarbeitern der Unternehmen verbessern und stärken lässt.
Dafür werden im Anschluss an diese Einleitung zunächst definitorische Grundlagen gelegt, was einen Standort allgemein kennzeichnet und was bei der Wahl eines solchen Standortes aus betriebswirtschaftlicher Sicht – besonders im internationalen Kontext – zu beachten ist (vgl. Kap. 2). Darauf aufbauend soll gezeigt werden, wie sich systematisch die Qualität eines Standortes bestimmen lässt und wo Deutschland unter Beachtung dieser Bestimmung steht (vgl. Kap. 3). Dies geschieht zunächst auf der Grundlage der empirischen Studie „Perspektive Deutschland“, dann mit wettbewerbstheoretischen Modellen wie dem nach Porter. Abschließend sollen Maßnahmen abgeleitet werden, wie der Standort Deutschland nachhaltig gestärkt werden kann und welche Aufgaben welche Institutionen konkret übernehmen sollten (vgl. Kap. 4). Dort ist auch der Versuch einer eigenen empirischen Studie unter den zehn umsatzstärksten Unternehmen Deutschlands und den bedeutendsten politischen Institutionen angesiedelt. Im Schlusskapitel werden die zentralen Ergebnisse der Arbeit zusammengestellt und ein Ausblick auf die Herausforderungen der Zukunft gewagt (vgl. Kap. 5).
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Einführung in die Standorttheorie
- Definition des Standortes
- Betriebliche Standortwahl
- Deutschland als Bestandteil des internationalen Wettbewerbsgefüges
- Empirische Untersuchung im Rahmen der Studie „Perspektive Deutschland“
- Allgemeine Arbeitsweise der Studie
- Die Situation Deutschlands aus Sicht der Studie
- Lösungsansätze
- Kritische Würdigung
- Theoretische Modelle
- Grundlegende Modelle und klassische Standortfaktoren
- Modell nach Porter
- Modell nach Reich
- Empirische Untersuchung im Rahmen der Studie „Perspektive Deutschland“
- Maßnahmen für bessere Wettbewerbschancen der BRD durch Sozio-Marketing
- Definition des Sozio-Marketings und Einordnung in das GOM-Konzept
- Maßnahmenableitung für alternative Institutionen
- Der Staat
- Die Unternehmen
- Das Humankapital
- Zusammenwirken der Maßnahmen im Sozio-Marketing
- Ergebnisse einer eigenen empirischen Studie
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Ziel dieser Arbeit ist es, die Wettbewerbsfähigkeit Deutschlands im internationalen Kontext zu analysieren und Maßnahmen zur nachhaltigen Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit abzuleiten. Die Arbeit untersucht, unter welchen Bedingungen ein Land als wettbewerbsfähig gilt und wie sich die Wettbewerbsfähigkeit von Nationen systematisieren und theoretisch fundieren lässt.
- Definition und Bedeutung von Standortfaktoren
- Analyse der Wettbewerbsfähigkeit Deutschlands anhand empirischer Studien und theoretischer Modelle
- Entwicklung und Bewertung von Maßnahmen zur Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit Deutschlands durch Sozio-Marketing
- Die Rolle des Staates, der Unternehmen und des Humankapitals im Rahmen der Wettbewerbsfähigkeit
- Empirische Untersuchungen zur Wettbewerbsfähigkeit Deutschlands
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Diese Einleitung beleuchtet die steigende Bedeutung der internationalen Wirtschaftstätigkeit und Globalisierung. Die Arbeit zielt darauf ab, die Wettbewerbsfähigkeit Deutschlands im globalen Kontext zu untersuchen und nachhaltige Maßnahmen zur Stärkung des Standortes zu entwickeln.
- Einführung in die Standorttheorie: Dieses Kapitel definiert den Begriff „Standort“ und betrachtet die betriebswirtschaftlichen Aspekte der Standortwahl, insbesondere im internationalen Kontext.
- Deutschland als Bestandteil des internationalen Wettbewerbsgefüges: Dieses Kapitel untersucht die Wettbewerbsfähigkeit Deutschlands anhand der empirischen Studie „Perspektive Deutschland“ und analysiert verschiedene theoretische Modelle der Wettbewerbsfähigkeit, wie beispielsweise das Modell nach Porter.
- Maßnahmen für bessere Wettbewerbschancen der BRD durch Sozio-Marketing: Dieses Kapitel definiert das Sozio-Marketing und leitet Maßnahmen zur Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit Deutschlands ab, die von unterschiedlichen Institutionen wie dem Staat, den Unternehmen und dem Humankapital umgesetzt werden können.
Schlüsselwörter
Die Arbeit beschäftigt sich mit der Wettbewerbsfähigkeit Deutschlands im internationalen Kontext. Zu den zentralen Themen und Schlüsselbegriffen gehören: Standortfaktoren, empirische Forschung, Wettbewerbsstrategie, Sozio-Marketing, staatliche Maßnahmen, Unternehmen und Humankapital.
Häufig gestellte Fragen
Was kennzeichnet einen wettbewerbsfähigen Standort?
Ein wettbewerbsfähiger Standort bietet Bedingungen, die Unternehmen Marktchancen sichern und Wohlstand für die Volkswirtschaft generieren, oft gemessen an Infrastruktur, Humankapital und politischer Stabilität.
Wie beurteilt die Studie „Perspektive Deutschland“ den Standort?
Die Studie liefert eine empirische Analyse der Situation Deutschlands aus Sicht der Bürger und Unternehmen und zeigt spezifische Lösungsansätze zur Verbesserung auf.
Welche Rolle spielt das Modell nach Porter für die Standortwahl?
Porters Modell hilft dabei, die Qualität eines Standortes systematisch anhand von Faktoren wie Wettbewerbsstrategie und Branchenstrukturen zu bestimmen.
Was versteht man unter Sozio-Marketing zur Stärkung der BRD?
Sozio-Marketing ist ein Konzept zur Ableitung von Maßnahmen für Institutionen wie den Staat und Unternehmen, um die gesellschaftliche und wirtschaftliche Attraktivität des Landes nachhaltig zu steigern.
Wie können Unternehmen zur Wettbewerbsfähigkeit Deutschlands beitragen?
Durch Investitionen in Innovationen, die Entwicklung des Humankapitals und eine proaktive Beteiligung am globalen Wettbewerbsgefüge.
Welche Herausforderungen bringt die Globalisierung für Industrieländer?
Ehemalige Schwellenländer treten verstärkt in den Markt und verdrängen etablierte Industrieländer, was eine Neupositionierung im internationalen Wettbewerb erfordert.
- Quote paper
- Tobias Heinen (Author), 2005, Standort Deutschland im internationalen Wettbewerb, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/46252