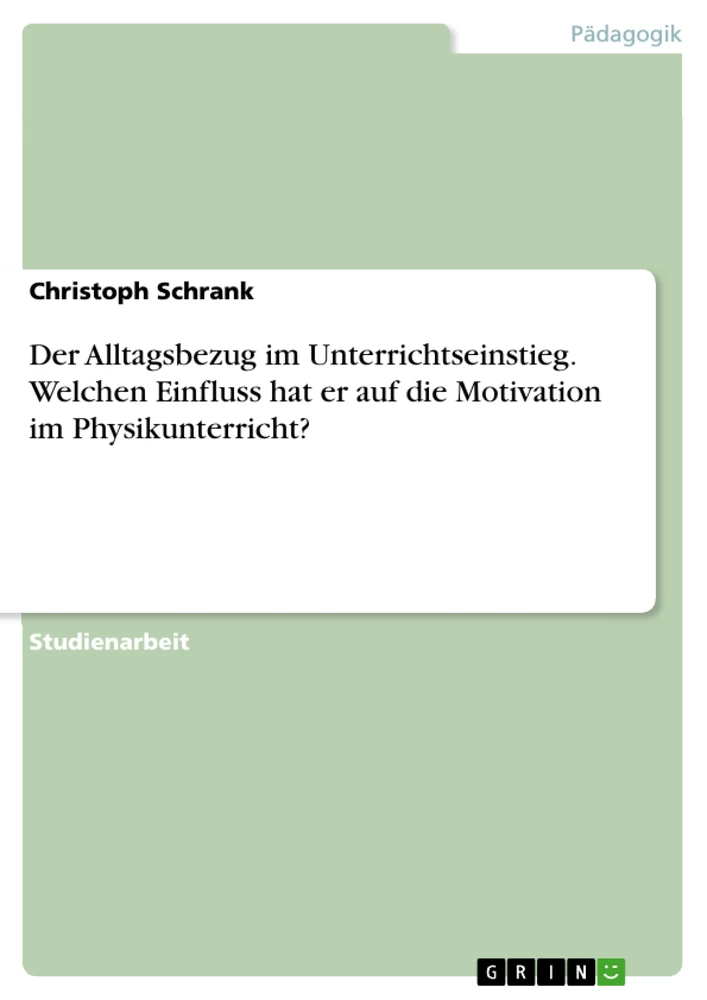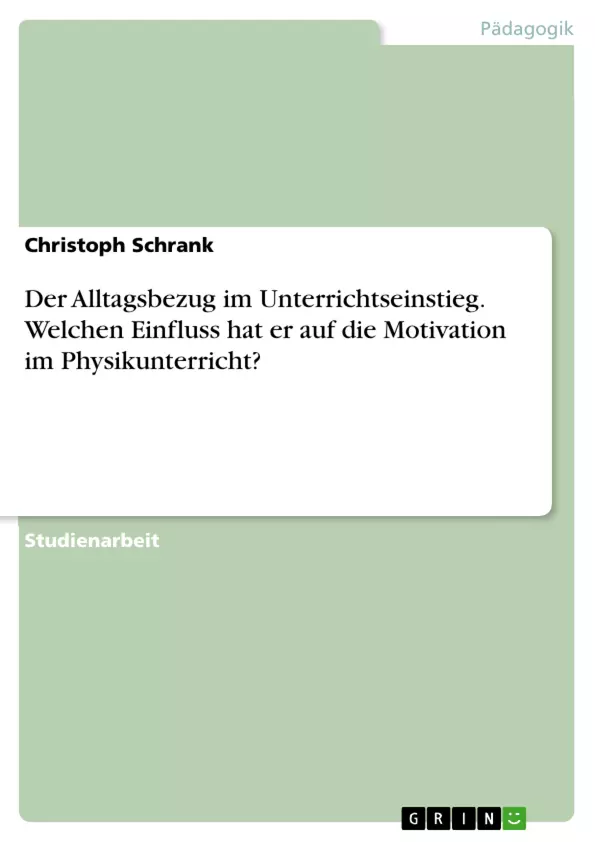In dieser Arbeit wird, basieren auf empirischen Erkenntnissen aus einem Praxissemester an einem Gymnasium, der Einfluss von alltagsbezogenen Unterrichtseinstiegen auf die Motivation im Physikunterricht untersucht. Das Schulfach Physik ist oftmals negativ konnotiert, da die Inhalte als schwierig und abstrakt wahrgenommen werden. Dabei lassen sich mit Physik Phänomene des alltäglichen Lebens erklären, somit ist sie eine anwendbare Wissenschaft, die dabei hilft, Grundlagen und Ursachen von eben diesen Phänomenen nachzuvollziehen und zu einem tieferen Verständnis zu gelangen.
Ein Unterrichtseinstieg kann entweder für die Stundeneröffnung oder für den Einstieg in ein neues Unterrichtsthema stehen. Für die Stundeneröffnung sind besonders Rituale von Bedeutung, die die SuS (Schülerinnen und Schüler) auf die bevorstehende Schulstunde vorbereiten und signalisieren, dass der Unterricht beginnt. Des Weiteren sollen die Rituale den SuS dabei helfen, im Thema und Fach anzukommen. Der Einstieg in ein neues Unterrichtsthema ist ein thematischer Einstieg, der im besten Fall Neugier und Interesse am Thema wecken soll. Außerdem ist es die Aufgabe des Unterrichtseinstiegs, die SuS über die kommende Schulstunde zu informieren, einen roten Faden darzulegen und Vorkenntnisse und Erfahrungen zum Gegenstand der Schulstunde in Erinnerung zu rufen.
Dabei ist es wichtig, die SuS in den Unterrichtseinstieg miteinzubeziehen und ihre Neugier und Kreativität mit Anregungen zu wecken. Das kann zum Beispiel durch Inszenierungen des/der Lehrers/Lehrerin von Situation, Experimente oder auch den Besuch von Experten im Klassenzimmer geschehen. Idealerweise muss der/die LehrerIn dann vor allem die Moderation des Lernprozesses übernehmen, da sich die SuS den Einstieg selbst erarbeiten. Der Unterrichtseinstieg hat eine fundamentale Bedeutung für das Gelingen einer Unterrichtstunde, da bereits am Anfang der Grundstein für die Motivation der SuS gelegt wird. Sollten SuS die Lust bereits am Anfang einer Schulstunde bzw. einer neuen Lerneinheit verlieren, ist es schwierig ihr Interesse wieder zu entfachen.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Theoretische Grundlagen
- 2.1 Unterrichtseinstiege
- 2.2 Alltagsbezug im Physikunterricht
- 2.3 Motivation
- 2.3.1 Intrinsische Motivation
- 2.3.2 Extrinsische Motivation
- 2.4 Selbstkonzept
- 3. Aktueller Forschungsstand
- 4. Forschungsfrage
- 5. Untersuchungsdesign
- 5.1 Teilnehmende Beobachtung
- 5.2 Fragebogen
- 5.3 Faktorenanalyse
- 6. Zeitplan
- 7. Datenerhebung und Auswertung
- 7.1 Physikstunden mit alltagsbezogenem Unterrichtseinstieg
- 7.2 Physikstunden ohne alltagsbezogenen Unterrichtseinstieg
- 7.3 Auswertung des Fragebogens
- 8. Ergebnisdarstellung und Reflexion
- 8.1 Experimentalgruppe
- 8.2 Kontrollgruppe
- 8.3 Reflexion der Ergebnisse
- 9. Fazit
- 10. Bullet Points
- 11. Anhang
- 12. Bibliographie
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Das Studienprojekt untersucht den Einfluss alltagsbezogener Unterrichtseinstiege auf die Motivation im Physikunterricht. Ziel ist es, herauszufinden, ob und wie ein Bezug zum Alltag die Lernbereitschaft und das Engagement der Schüler*innen positiv beeinflusst. Die Studie basiert auf empirischen Daten, die im Rahmen eines Praxissemesters an einem Kölner Gymnasium erhoben wurden.
- Der Einfluss von Alltagsbezug auf die Schülermotivation
- Die Rolle von Unterrichtseinstiegen für den Lernerfolg
- Unterschiede zwischen intrinsischer und extrinsischer Motivation im Physikunterricht
- Methoden der Datenerhebung und -auswertung (teilnehmende Beobachtung, Fragebögen)
- Reflexion der Ergebnisse und ihrer Implikationen für den Physikunterricht
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung beschreibt den Kontext des Studienprojekts, das im Rahmen eines Praxissemesters an einem Kölner Gymnasium durchgeführt wurde. Der Fokus liegt auf der Untersuchung des Einflusses alltagsbezogener Unterrichtseinstiege auf die Motivation im Physikunterricht. Die Autorin argumentiert, dass Physik oft negativ konnotiert ist, da sie als schwierig und abstrakt empfunden wird. Sie möchte zeigen, wie Alltagsbezüge dazu beitragen können, die Motivation der Schüler*innen zu steigern und den Unterricht sinnvoller zu gestalten. Der persönliche Bezug der Autorin zum Thema wird deutlich gemacht, und der Aufbau der Arbeit wird skizziert.
2. Theoretische Grundlagen: Dieses Kapitel legt die theoretischen Grundlagen der Studie dar. Es werden die Konzepte von Unterrichtseinstiegen, Alltagsbezug im Physikunterricht, intrinsischer und extrinsischer Motivation sowie Selbstkonzept definiert und erläutert. Es wird differenziert zwischen Stundeneröffnungen und thematischen Einstiegen in neue Unterrichtseinheiten. Die Bedeutung eines motivierenden und sinnhaften Unterrichtseinstiegs für den Lernerfolg wird hervorgehoben. Der Fokus liegt auf thematischen Einstiegen, da deren Einfluss auf die Motivation im Zentrum der Untersuchung steht. Die Autorin diskutiert die Herausforderung, diese beiden Arten von Einstiegen in der Praxis zu trennen.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zum Studienprojekt: Alltagsbezogene Unterrichtseinstiege und Schülermotivation im Physikunterricht
Was ist das Thema des Studienprojekts?
Das Studienprojekt untersucht den Einfluss alltagsbezogener Unterrichtseinstiege auf die Motivation von Schülern im Physikunterricht. Es wird analysiert, ob und wie ein Bezug zum Alltag die Lernbereitschaft und das Engagement der Schüler positiv beeinflusst.
Wo und wie wurde die Studie durchgeführt?
Die Studie wurde im Rahmen eines Praxissemesters an einem Kölner Gymnasium durchgeführt. Die Daten wurden empirisch erhoben.
Welche theoretischen Grundlagen werden behandelt?
Die Studie stützt sich auf die Konzepte von Unterrichtseinstiegen (Stundeneröffnungen und thematische Einstiege), Alltagsbezug im Physikunterricht, intrinsischer und extrinsischer Motivation sowie Selbstkonzept. Die Bedeutung motivierender und sinnhafter Unterrichtseinstiege für den Lernerfolg wird ausführlich erläutert.
Welche Forschungsmethoden wurden angewendet?
Die Datenerhebung erfolgte mittels teilnehmender Beobachtung und Fragebögen. Die Auswertung der Daten umfasste eine Faktorenanalyse.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in folgende Kapitel: Einleitung, Theoretische Grundlagen (inkl. Unterrichtseinstiege, Alltagsbezug, Motivation, Selbstkonzept), Aktueller Forschungsstand, Forschungsfrage, Untersuchungsdesign (inkl. Methoden der Datenerhebung), Zeitplan, Datenerhebung und Auswertung (inkl. Analyse von Physikstunden mit und ohne alltagsbezogenen Einstiegen und Auswertung der Fragebögen), Ergebnisdarstellung und Reflexion (inkl. Vergleich von Experimental- und Kontrollgruppe), Fazit, Bullet Points, Anhang und Bibliographie.
Welche Ergebnisse werden präsentiert?
Die Ergebnisse werden getrennt für eine Experimentalgruppe (mit alltagsbezogenen Unterrichtseinstiegen) und eine Kontrollgruppe (ohne alltagsbezogene Unterrichtseinstiege) dargestellt und reflektiert. Ein direkter Vergleich der beiden Gruppen ermöglicht die Analyse des Einflusses alltagsbezogener Einstiege auf die Schülermotivation.
Welche Zielsetzung verfolgt die Studie?
Die Studie zielt darauf ab, den Einfluss von Alltagsbezügen auf die Schülermotivation im Physikunterricht aufzuzeigen und die Rolle von Unterrichtseinstiegen für den Lernerfolg zu untersuchen. Es soll auch der Unterschied zwischen intrinsischer und extrinsischer Motivation im Physikunterricht beleuchtet werden.
Welche Schlussfolgerungen werden gezogen?
Das Fazit fasst die wichtigsten Ergebnisse zusammen und diskutiert deren Implikationen für den Physikunterricht. Es wird eine Reflexion der Ergebnisse und ihrer Bedeutung für die Praxis des Physikunterrichts präsentiert.
- Quote paper
- Bachelor of Arts Christoph Schrank (Author), 2018, Der Alltagsbezug im Unterrichtseinstieg. Welchen Einfluss hat er auf die Motivation im Physikunterricht?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/462682