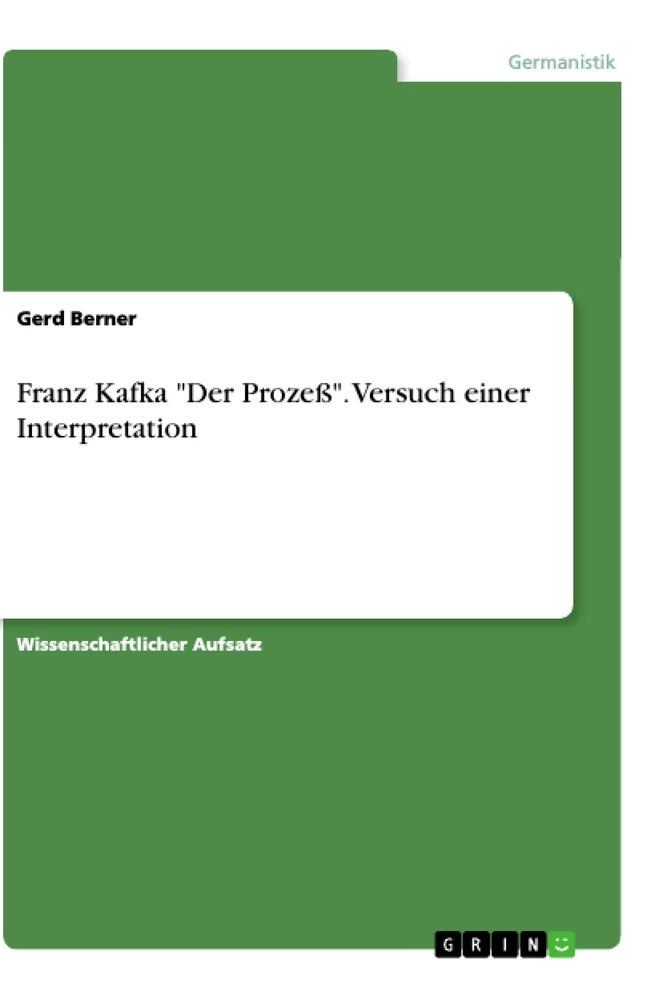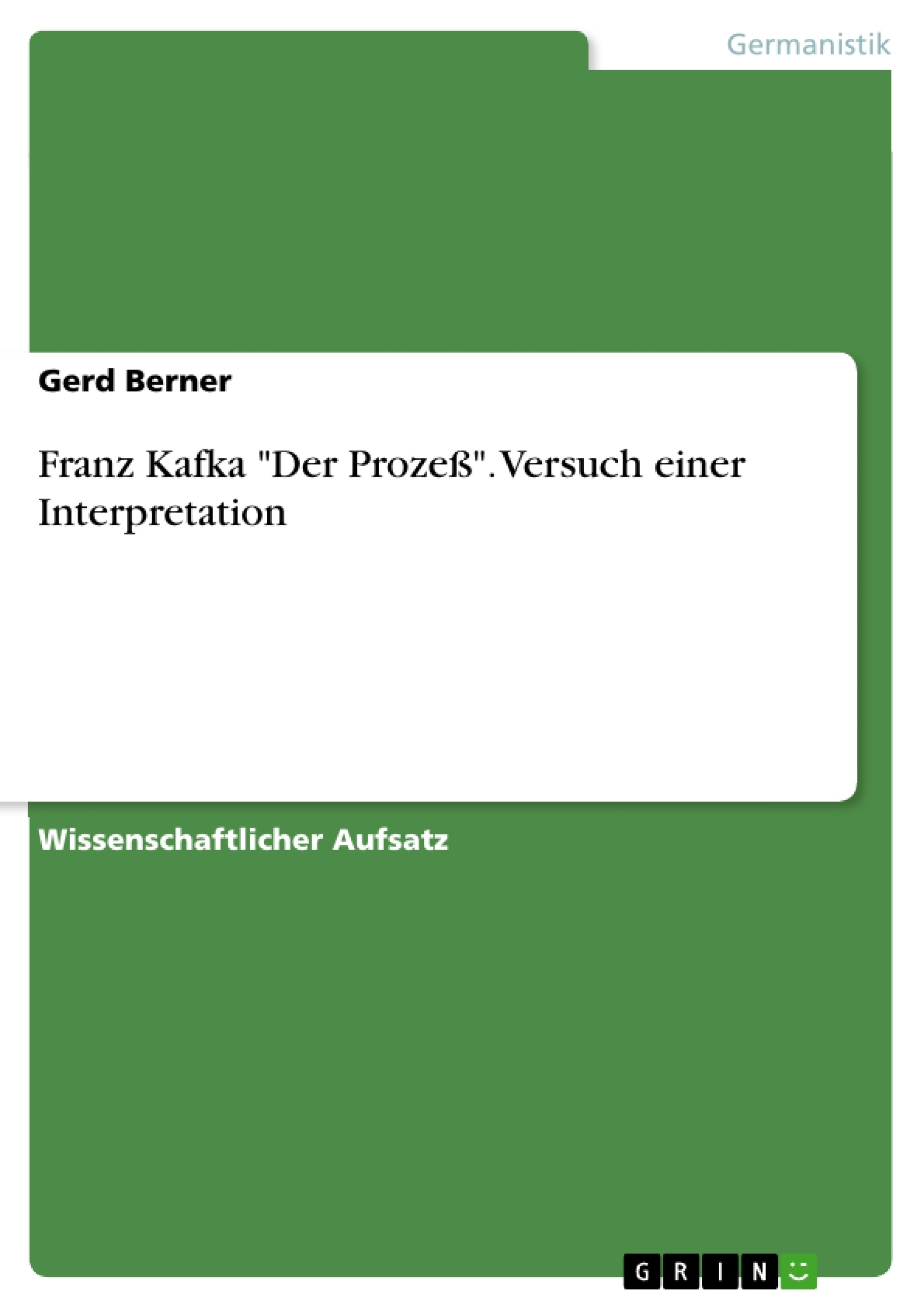Elias Canetti nennt in seinem Kafka-Essay Der andere Prozeß zwei Begebenheiten aus Kafkas Leben, die „Eingang in den Proceß gefunden haben“, nämlich seine Verlobung mit Felice Bauer am 1.6.1914 und die sechs Wochen später erfolgte Entlobung im Hotel Askanischer Hof in Berlin. Canetti begründet seine Sicht mit entsprechenden Tagebucheintragungen Kafkas, wie zum Beispiel er habe die Verlobung wie eine Verhaftung erlebt, bei der er sich „gebunden wie ein Verbrecher“ vorgekommen sei, das in der Auflösung der Verlobung gipfelnde Gespräch nennt Kafka ein Gericht, wörtlich schreibt er von einem „Gerichtshof im Hotel“.
Auch Peter-André Alt weist auf Kafkas Verlobung und auf den Gerichtstag in Berlin hin, verweist aber noch auf eine Stelle in Kafkas Tagebuch, in dem sich am 29.7.1914 „die Szene eines abendlichen Spaziergangs [findet], der Josef K., den <Sohn eines reichen Kaufmanns>, an einem Handelshaus vorbeiführt, vor dem ein <Türhüter> steht. Am selben Tag entsteht die knappe Skizze einer Schuldphantasie, in der ein Angestellter von seinem Vorgesetzten des Diebstahls bezichtigt und entlassen wird.“
Inhaltsverzeichnis
- 1. Entstehungs- und Veröffentlichungsgeschichte des Romanfragments
- 2. Die Gerichtsmetapher
- 3. Die Schreibweise des Romantitels
- 4. Einordnung des Romanfragments in Kafkas Gesamtwerk
- 5. Er-Erzählform und personales Erzählverhalten
- Exkurs: Monoperspektive mit auktorialen Einschüben
- 6. Redeformen in Kafkas Process
- 7. Die erzählte Process-Wirklichkeit
- 7.1 Erstes Kapitel: Verhaftung/ Gespräch mit Frau Grubach/ Dann ...
- 7.2 Zweites Kapitel: Erste Untersuchung
- 7.3 Drittes Kapitel: Im leeren Sitzungssaal/ Der Student/ Die Kanzleien
- 7.4 Viertes Kapitel: Der Prügler
- 7.5 Fünftes Kapitel: Der Onkel/ Leni
- 7.6 Sechstes Kapitel: Advokat/ Fabrikant/ Maler
- 7.7 Siebtes Kapitel: Kaufmann Block/ Kündigung des Advokaten
- 7.8 Achtes Kapitel: Im Dom
- Exkurs: Die Türhüterlegende
- 7.9 Neuntes Kapitel: Ende
- Exkurs: Die Beweiskraft der Betrachtungen über Sünde, Leid, Hoffnung und den wahren Weg
- 8. Verschiedene Deutungsrichtungen (Lesarten)
- 8.1 Die biographische Lesart
- 8.2 Die theologische Lesart
- 8.3 Die psychoanalytische Lesart
- 8.4 Zeitgeschichtlich bezogene Lesarten
- 8.5 Dekonstruktivistische Lesarten
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Der Text „Franz Kafka, Der Prozeß. Versuch einer Interpretation“ von Gerd Berner widmet sich einer umfassenden Analyse des berühmten Romanfragments „Der Prozeß“ von Franz Kafka. Die Arbeit zielt darauf ab, die Entstehung des Textes, seine literarischen Besonderheiten und verschiedene Deutungsansätze zu beleuchten.
- Die Entstehungsgeschichte des Romanfragments im Kontext von Kafkas Leben und Werk
- Die literarische Gestaltung des Prozeß-Themas und die Funktion von Metaphern
- Die Interpretation des Romans aus verschiedenen Perspektiven (biographisch, theologisch, psychoanalytisch etc.)
- Die Bedeutung des Werks im Kontext der Zeitgeschichte und der literarischen Moderne
- Die Herausforderungen der Edition und Interpretation eines unvollendeten Werkes
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit beginnt mit einer detaillierten Darstellung der Entstehungs- und Veröffentlichungsgeschichte des Romanfragments „Der Prozeß“. Der Autor beleuchtet die Verbindung des Textes zu Kafkas eigener Biografie, insbesondere zu seiner Verlobung und Entlobung mit Felice Bauer. Des Weiteren werden die Herausforderungen bei der Edition und Interpretation des unvollendeten Werkes beleuchtet, die sich aus Kafkas eigenem Vorgehen beim Schreiben und der Rolle des Herausgebers Max Brod ergeben.
Im zweiten Kapitel wird die „Gerichtsmetapher“ im „Prozeß“ analysiert. Berner zeigt, wie Kafka das Motiv des Prozesses als Symbol für die menschliche Existenz im Allgemeinen verwendet. Er untersucht die Ambivalenz der Gerichtsmetapher, die sowohl als Ausdruck von Schuldgefühlen als auch als Kritik an gesellschaftlichen Machtstrukturen interpretiert werden kann. Der Autor stellt auch die Schreibweise des Romantitels „Der Prozeß“ in den Mittelpunkt seiner Analyse und diskutiert deren Bedeutung im Kontext des Werkes.
Im vierten Kapitel wird der „Prozeß“ in das Gesamtwerk Kafkas eingeordnet. Dabei wird die Bedeutung des Romans für Kafkas Entwicklung als Autor und die prägende Rolle des Prozesses als Motiv in seinen Werken beleuchtet. Der Autor betrachtet insbesondere Kafkas Umgang mit der „Er-Erzählform“ und dem „personalen Erzählverhalten“ in seinen Texten.
Im sechsten Kapitel werden verschiedene Redeformen in Kafkas „Prozeß“ analysiert. Berner zeigt, wie Kafka die Sprache als Mittel der Manipulation und Verwirrung einsetzt und wie die sprachliche Gestaltung des Textes die Leser in die Situation Josef K.s versetzt. Das siebte Kapitel widmet sich schließlich der erzählten Prozess-Wirklichkeit und behandelt verschiedene Kapitel des Romans im Detail. Der Autor beleuchtet wichtige Motive und Charaktere sowie ihre Bedeutung für das Gesamtwerk.
Schlüsselwörter
Franz Kafka, Der Prozeß, Romanfragment, Gerichtsmetapher, Entstehungsgeschichte, Veröffentlichungsgeschichte, biographische Interpretation, theologische Interpretation, psychoanalytische Interpretation, Zeitgeschichte, literarische Moderne, Max Brod, Edition, Interpretation, Er-Erzählform, personales Erzählverhalten, Redeformen, Prozess-Wirklichkeit.
- Quote paper
- M.A. Gerd Berner (Author), 2019, Franz Kafka "Der Prozeß". Versuch einer Interpretation, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/464951