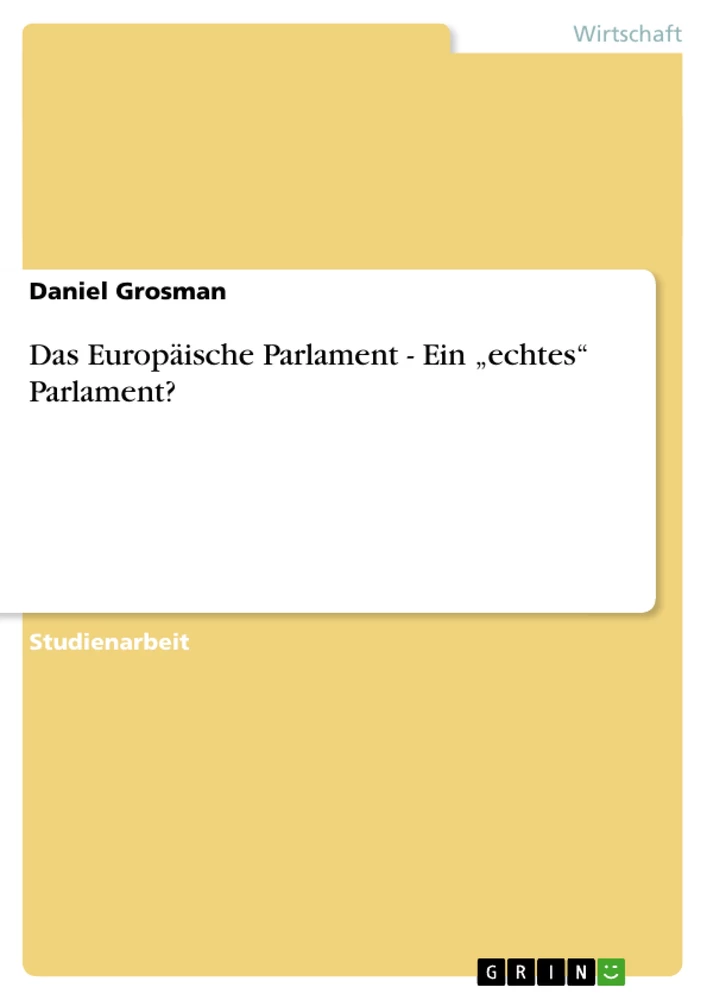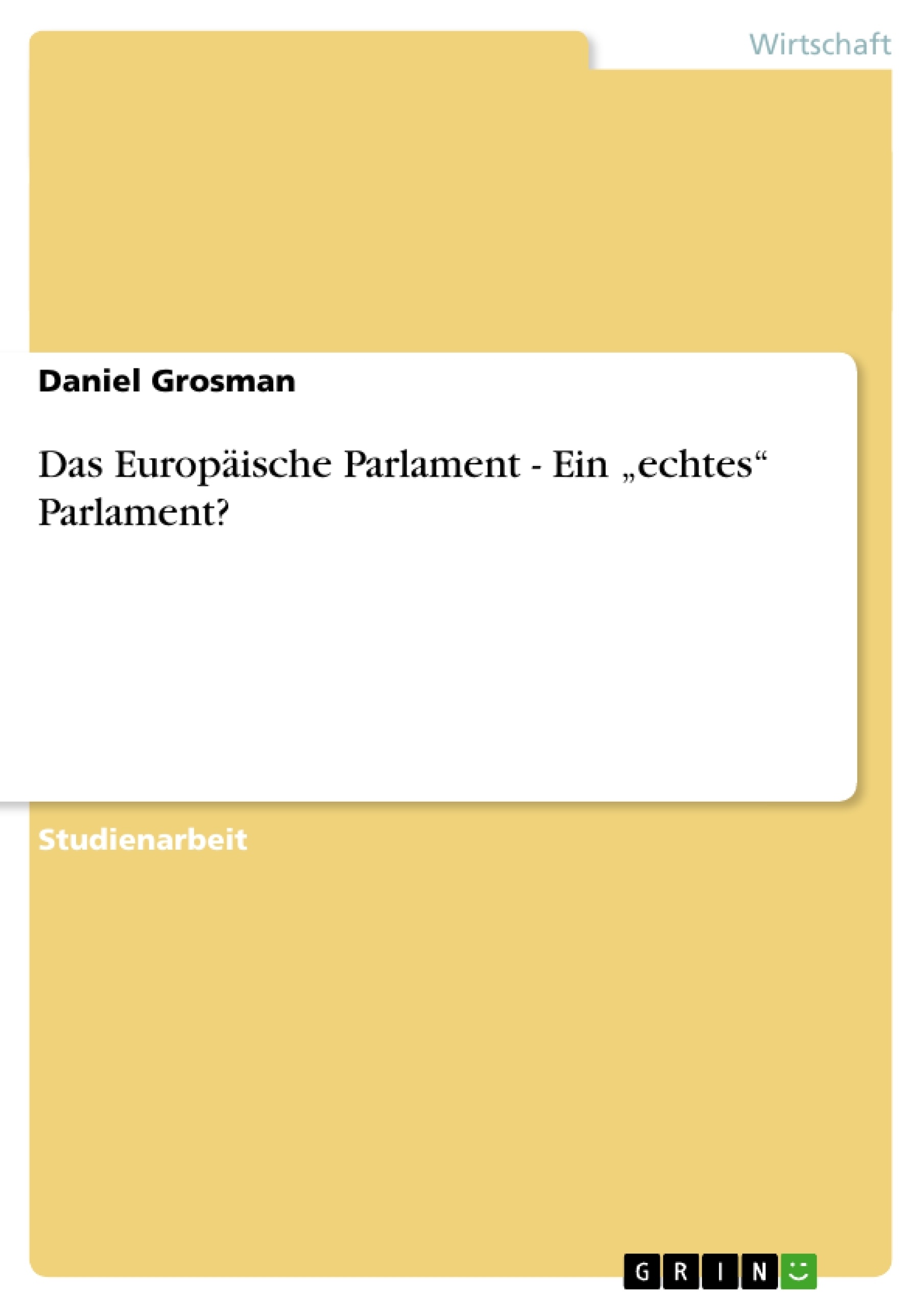“Demokratie im allgemeinen Sinne besagt, dass das Volk sich selbst regieren soll.“1 Diese Definition ist in vielen Literaturen wiederzufinden. Über die konkrete Gestaltung dieser Selbstherrschaft sagt die reine Definition allerdings nichts aus, so dass sich im Laufe der Zeit verschiedene Systeme (z.B. parlamentarische Demokratie oder präsidentielle Demokratie) herausgebildet haben. Da im Folgenden das System der parlamentarischen Demokratie behandelt wird, muss der Begriff „Parlament“ im Verlaufe dieser Arbeit noch näher definiert werden. Die demokratischen Funktionen und Befugnisse des Europäischen Parlaments (EP)2 als Organ der Europäischen Union sind im Sinne einer demokratischen Verfassungsordnung trotz diverser Änderungen der Gründungsverträge der EWG (später EG bzw. EU) durch Folgeverträge (z.B. Vertrag von Maastricht oder Vertrag von Nizza) noch immer nicht voll entwickelt bzw. angemessen. Im Folgenden wird diese Hausarbeit erläutern, ob und wenn ja welche Funktionen und Befugnisse dem EP bereits mit Gründung der EWG3 durch die „römischen Verträge“ von 1957 zugewiesen wurden, inwieweit eine Erweiterung dieser Befugnisse nötig war und was sie zur Stärkung der Stellung des EP beitrugen. Gleichzeitig wird gegebenenfalls die Frage behandelt, ob und inwiefern ein in der Literatur häufig besprochenes „Demokratiedefizit“ in der EU vorhanden ist, sofern das EP davon betroffen ist. Zusätzlich wird ein Vergleich der Funktionen der nationalen Parlamente (am Beispiel des Deutschen Bundestages) mit den Funktionen des EP durchgeführt, um ggf. an Gemeinsamkeiten bzw. Unterschieden die Frage eines „echten“ Parlaments zu klären.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Definition des Parlamentsbegriffes
- Übertragbarkeit der nationalen Demokratien
- Entstehung des Europäischen Parlaments
- Demokratie im Wahlsystem der Abgeordneten des Europäischen Parlaments
- Vergleich Europäisches Parlament und deutscher Bundestag
- Die Legislativfunktion
- des deutschen Bundestages
- des Europäischen Parlaments
- Legislativfunktion aus den Gründungsverträgen
- Änderungen durch den Maastrichter Vertrag
- Änderungen durch den Vertrag von Amsterdam
- Haushaltsbefugnisse
- des deutschen Bundestages
- des Europäischen Parlaments (allgemein)
- Die Haushaltsreform der siebziger Jahre
- Kontrolle der Exekutive
- Kontrollfunktion des deutschen Bundestages
- Kontrollfunktion des Europäischen Parlaments
- Änderungen durch die Einheitliche Europäische Akte
- Änderungen durch den Maastrichter Vertrag
- Die Legislativfunktion
- Zusammenfassung und Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit analysiert die Funktionen und Befugnisse des Europäischen Parlaments (EP) im Kontext der Europäischen Union (EU). Sie befasst sich mit der Frage, ob und inwieweit das EP, trotz diverser Änderungen in den Gründungsverträgen, eine angemessene demokratische Verfassungsordnung erreicht hat. Dabei werden die historischen Entwicklungen der EP-Befugnisse und die Auswirkungen von Folgeverträgen wie dem Vertrag von Maastricht und dem Vertrag von Nizza beleuchtet. Die Arbeit untersucht auch, ob ein in der Literatur häufig diskutiertes "Demokratiedefizit" in der EU vorliegt, und wie sich dieses auf das EP auswirkt. Abschließend wird ein Vergleich der Funktionen des EP mit denen des deutschen Bundestages durchgeführt, um die Frage eines "echten" Parlaments zu klären.
- Entwicklung der Funktionen und Befugnisse des Europäischen Parlaments
- Einfluss von Folgeverträgen auf die demokratische Struktur der EU
- Das "Demokratiedefizit" in der EU und seine Auswirkungen auf das EP
- Vergleich der Funktionen des EP mit nationalen Parlamenten (am Beispiel des deutschen Bundestages)
- Die Frage eines "echten" Parlaments im Kontext der Europäischen Union
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Diese Einleitung stellt die Definition des Begriffs "Demokratie" und seine unterschiedlichen Ausprägungen dar, insbesondere im Kontext parlamentarischer Demokratien. Sie führt die Arbeit ein, indem sie den Fokus auf die demokratischen Funktionen und Befugnisse des Europäischen Parlaments legt, insbesondere im Hinblick auf die Frage, ob es trotz Veränderungen in den Gründungsverträgen der EWG (später EG bzw. EU) eine angemessene demokratische Verfassungsordnung erreicht hat.
- Definition des Parlamentsbegriffes: Dieses Kapitel definiert den Begriff "Parlament" und erläutert seine traditionellen Funktionen und Befugnisse in modernen Demokratien. Es wird auf die Bedeutung des Parlaments als Vertretung der Bürger hingewiesen, insbesondere durch die direkte Legitimierung seiner Mitglieder durch Wahlen.
- Übertragbarkeit der nationalen Demokratien: Dieses Kapitel befasst sich mit der Übertragbarkeit nationaler demokratischer Systeme auf die Ebene der EWG (später EG bzw. EU) und stellt die Herausforderung dar, ein gemeinsames Demokratieverständnis zu entwickeln, das die unterschiedlichen nationalen Strukturen berücksichtigt.
- Entstehung des Europäischen Parlaments: Dieses Kapitel schildert die Entstehung des Europäischen Parlaments, ausgehend von der Gründung der EWG und den "römischen Verträgen" von 1957. Es wird auf die Anfänge der "Gemeinsamen Versammlung" als Kontrollorgan der "Hohen Behörde" sowie auf die Entwicklung hin zu einem Parlament mit eigenem Selbstverständnis und der offiziellen Umbenennung in "Europäisches Parlament" eingegangen.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter dieser Arbeit beinhalten den Begriff "Parlament" im Kontext der Europäischen Union, die Funktionen und Befugnisse des Europäischen Parlaments, die demokratische Verfassungsordnung, die Entwicklung der Gründungsverträge, das "Demokratiedefizit" und der Vergleich mit nationalen Parlamenten, insbesondere dem deutschen Bundestag. Die Arbeit beleuchtet die Frage, ob das Europäische Parlament ein "echtes" Parlament im Sinne einer modernen demokratischen Ordnung darstellt.
Häufig gestellte Fragen
Ist das Europäische Parlament ein „echtes“ Parlament?
Die Arbeit untersucht dies durch einen Vergleich mit dem Deutschen Bundestag und analysiert, ob das EP über ausreichende Legislativ- und Kontrollbefugnisse verfügt.
Was versteht man unter dem „Demokratiedefizit“ der EU?
Es beschreibt die Kritik, dass die Entscheidungsprozesse in der EU nicht ausreichend durch das direkt gewählte Parlament legitimiert sind.
Wie haben sich die Befugnisse des EP über die Zeit verändert?
Durch Verträge wie Maastricht, Amsterdam und Nizza wurden die Rechte des EP in der Gesetzgebung und bei der Kontrolle der Exekutive schrittweise gestärkt.
Welche Haushaltsbefugnisse hat das Europäische Parlament?
Die Arbeit beleuchtet die Haushaltsreformen der 70er Jahre, die dem EP erstmals substanzielle Mitwirkungsrechte bei den EU-Finanzen einräumten.
Wie unterscheidet sich das Wahlsystem des EP von nationalen Wahlen?
Die Arbeit analysiert die demokratischen Aspekte des Wahlsystems der Abgeordneten und dessen Bedeutung für die Legitimation des Parlaments.
- Quote paper
- Daniel Grosman (Author), 2003, Das Europäische Parlament - Ein „echtes“ Parlament?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/46642