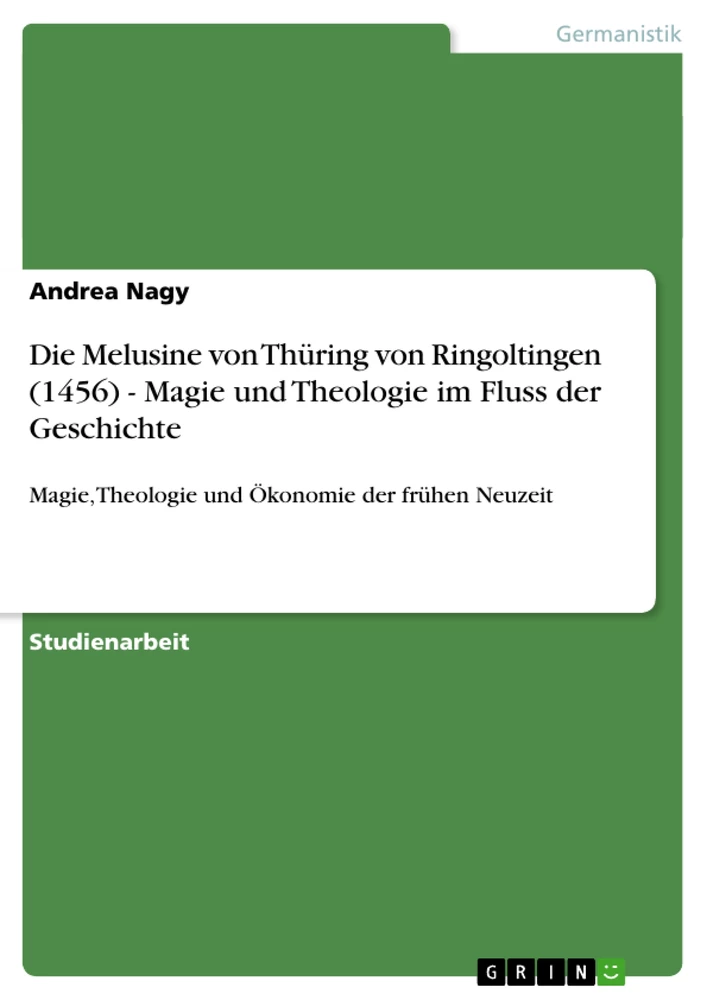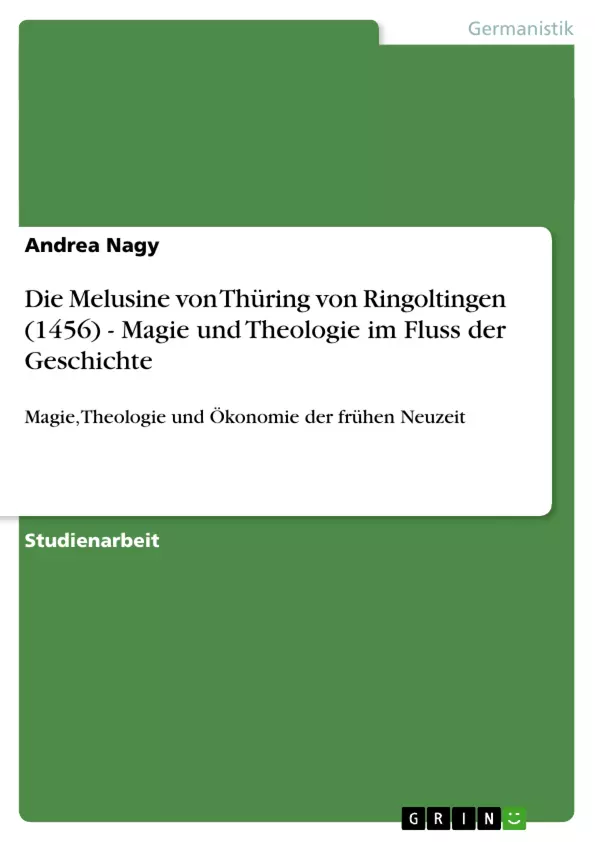Hinter der ´Schlangenfrau´ Melus ine verbirgt sich eine schöne und furchterregende Gestalt, welche in vielen Volkssagen ausschließlich Aspekte des Sinnlich-Betörenden trägt. Doch die Melusine aus der geheimnisvollen Welt der Meerestiefen verkörpert in der Erzählung Thüring von Ringoltinge ns weitaus mehr als nur eine Loreley, eine Verführerin. „Ihr Wesen steht für ein echtes, die ganze Personalität umfassendes Liebesglück – deshalb ist [ihre] Verbindung [mit Reymund] [...] auch, was in diesem Motivkreis keineswegs die Regel, vielmehr die Ausnahme ist, die Form der Ehe.“1 Melusine ist eine selbstbewusste, charakterstarke Frau, die in allen Bereichen ihres Lebens Erfolg hat. Reymunds Liebe bedeutet ihr viel, die starke Zuneigung beruht auf beiden Seiten. Und doch kann ihre Ehe den aufkommenden Stürmen des Lebens nicht standhalten. Der Kern der Melusinensage enthält ein uraltes, in vielen Kulturen anzutreffendes Motiv: es ist die Verbindung eines sterblichen Menschen mit einem überirdischen Wesen. Diese Verbindung ist in jeder Sage an ein Tabu geknüpft, welches den Menschen in seiner Unvollkommenheit von den unsterblichen, allwissenden Götterwesen deutlich abgrenzt. Wird dieses Tabu verletzt, folgt eine Trennung. In dieser Hausarbeit wollen wir in erster Linie die kultur- und vorstellungsgeschichtlichen Hintergründe dieser Sage näher beleuchten, dabei werfen wir auch einen Blick auf die ökonomisch-politische Situation der Zeit. Die Frage, wodurch es zur Verschiebung des Motivkreises in der Darstellungsform der ´mer faye´ kommen konnte, weg von der sinnlich-betörenden Geliebten, hin zu einer humanen, christlichen Ehefrau, ist von zentraler Bedeutung. Gleichzeitig möchten wir auch die Frage klären, warum die Melusine des Thüring von Ringoltingens den christlich-mittelalterlichen Verständnishorizont sprengt und ein religiöses Problem evoziert. Um das Bild zu vervollständigen, wollen wir das Magieverständnis und den Standpunkt der Theologen im Mittelalter sowie in der frühen Neuzeit bezüglich der Dämonologie der Schlangenfrau skizzieren. Eine Exkursion in die Geschichte der Magie und Astrologie macht die Zusammenhänge in diesem Konflikt deutlicher.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Melusine
- Melusine als Ahnfrau
- Die Fee als Opfer der Liebesbeziehung
- Die Problematik der Unsterblichkeit
- Astrologie und Magie in der Melusinenerzählung
- Die magische Welt der 'Meerfrau'
- Der Spuk
- Magie und Geschichte
- Magie der Worte
- Die Kunst der 'Astronomia'
- Der heidnische Ursprung der Sage
- Die 'uẞzeichnung - Herausgehobenheit im doppelten Sinne
- Die Wiege der Melusinensage - Melusine als heidnische Göttin
- Exkursion – Magie und Astrologie im Fluss der Zeit
- Der archaisch denkende Mensch
- Magie und Astrologie im alten Ägypten
- Die babylonische Astrologie
- Die hellenistische Astrologie
- Astrologie im Römischen Reich
- Der syrisch-römische Kulturaustausch
- Astrologie und das frühe Christentum
- Die christianisierte Astrologie
- Kampf ohne Kompromisse
- Dämonologie
- Magie und Astrologie in der Hochscholastik
- Magnus und Aquino
- Magie in der Medizin
- Die Situation in Deutschland
- Die Blütezeit der Astrologie
- Die Frühe Neuzeit - Paracelsus, ein Mensch Mitten im Wandel der Zeit
- Paracelsus als Visionär
- Die Verwissenschaftlichung des Übernatürlichen
- Die Elementargeister
- Die Entzauberung von Dämonen
- Das Licht der Natur
- Die ärztliche Kunst
- Die Lehre vom Mikro- und Makrokosmos
- Das Heilprinzip
- Die Auflösung der ´4-Säfte-Lehre
- Die Ökonomie der frühen Neuzeit
- Die ökonomisch-politische Lage der europäischen Großstädte
- Bürgertum – Kapitalismus – Rationalismus – Magie
- Männlichkeit und Magie
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit befasst sich mit der Figur der Melusine in der Erzählung von Thüring von Ringoltingen. Im Mittelpunkt stehen die kultur- und vorstellungsgeschichtlichen Hintergründe der Sage sowie die ökonomisch-politische Situation der Zeit.
- Die Entwicklung der Melusinenfigur von der verführerischen Geliebten hin zu einer christlich-humanen Frauengestalt.
- Die Verbindung eines sterblichen Menschen mit einem überirdischen Wesen und die damit verbundenen Tabus.
- Die Frage, wie die Melusine des Thüring von Ringoltingen den christlich-mittelalterlichen Verständnishorizont sprengt und ein religiöses Problem evoziert.
- Magieverständnis und Dämonologie im Mittelalter und in der frühen Neuzeit.
- Die Geschichte der Magie und Astrologie im Kontext der Melusinen-Erzählung.
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt die Figur der Melusine vor und erläutert die zentrale Frage der Arbeit: Wie kam es zur Verschiebung des Motivkreises in der Darstellungsform der 'mer faye' von der sinnlich-betörenden Geliebten hin zu einer humanen, christlichen Ehefrau?
Das Kapitel 2.1 analysiert Melusine als Ahnfrau und beleuchtet die Problematik ihrer Unsterblichkeit und die Auswirkungen ihrer Liebesbeziehung.
Kapitel 2.2 befasst sich mit der magischen Welt der Melusinenerzählung, untersucht den Spuk und beleuchtet die Rolle von Magie und Astrologie im Kontext der Geschichte.
Kapitel 2.3 untersucht den heidnischen Ursprung der Melusinensage und betrachtet Melusine als heidnische Göttin.
Kapitel 3 stellt eine Exkursion in die Geschichte der Magie und Astrologie dar. Es werden verschiedene Epochen und Kulturen beleuchtet, um die Entwicklung des Magieverständnisses zu veranschaulichen.
Kapitel 4 widmet sich Paracelsus und seiner Vision einer Verwissenschaftlichung des Übernatürlichen. Es wird die Frage der Dämonologie und der Bedeutung der Elementargeister im Kontext der 'Entzauberung' des Übernatürlichen diskutiert.
Kapitel 5 untersucht die ökonomisch-politische Lage der europäischen Großstädte in der frühen Neuzeit und die Rolle von Bürgertum, Kapitalismus und Rationalismus.
Schlüsselwörter
Melusine, Magie, Astrologie, Dämonologie, Theologie, frühe Neuzeit, Kulturgeschichte, Vorstellungsgeschichte, Ehe, Tabu, Unsterblichkeit, heidnische Göttin, Paracelsus, Ökonomie, Bürgertum.
Häufig gestellte Fragen
Wer ist die Gestalt der Melusine bei Thüring von Ringoltingen?
Melusine ist eine „Schlangenfrau“ oder Meerfee, die in der Erzählung von 1456 als selbstbewusste, christliche Ehefrau dargestellt wird, was einen Wandel von der rein verführerischen Sagengestalt markiert.
Welches Tabu steht im Zentrum der Melusinensage?
Die Verbindung zwischen dem sterblichen Reymund und der überirdischen Melusine ist an das Tabu gebunden, dass er sie an einem bestimmten Wochentag (Samstag) nicht sehen darf. Die Verletzung führt zur Trennung.
Welche Rolle spielen Astrologie und Magie in der Erzählung?
Die Arbeit untersucht die „magische Welt“ der Meerfrau und wie astrologische Kenntnisse (Astronomia) und magische Elemente in den mittelalterlichen Verständnishorizont integriert wurden.
Warum stellt Melusine ein religiöses Problem dar?
Ihre Existenz als Elementargeist sprengt das christlich-mittelalterliche Weltbild. Die Arbeit beleuchtet den Standpunkt der Theologen zur Dämonologie und zum Wesen übernatürlicher Frauenfiguren.
Was sagt Paracelsus über Wesen wie Melusine?
Im Rahmen der frühen Neuzeit versuchte Paracelsus eine „Verwissenschaftlichung“ des Übernatürlichen, indem er Melusine als Elementargeist einordnete und so zur Entzauberung von Dämonen beitrug.
Wie beeinflusste die Ökonomie der frühen Neuzeit die Sagenwelt?
Der Aufstieg des Bürgertums, Kapitalismus und Rationalismus veränderte die Sicht auf Magie und Männlichkeit, was sich auch in der literarischen Darstellung der Melusine widerspiegelt.
- Quote paper
- Andrea Nagy (Author), 2000, Die Melusine von Thüring von Ringoltingen (1456) - Magie und Theologie im Fluss der Geschichte, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/46673