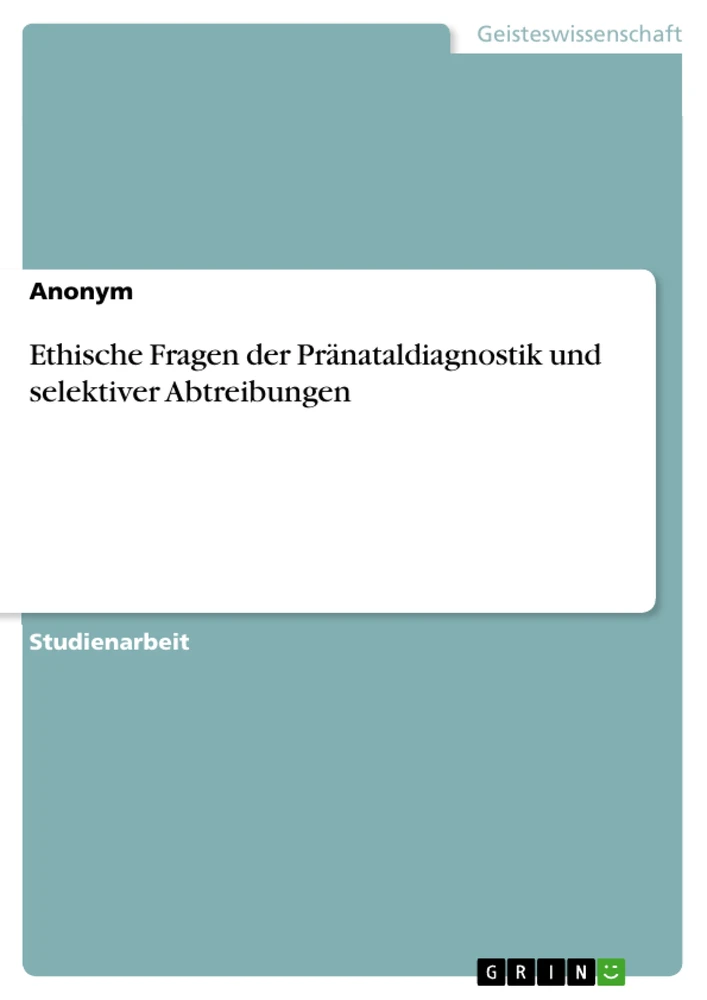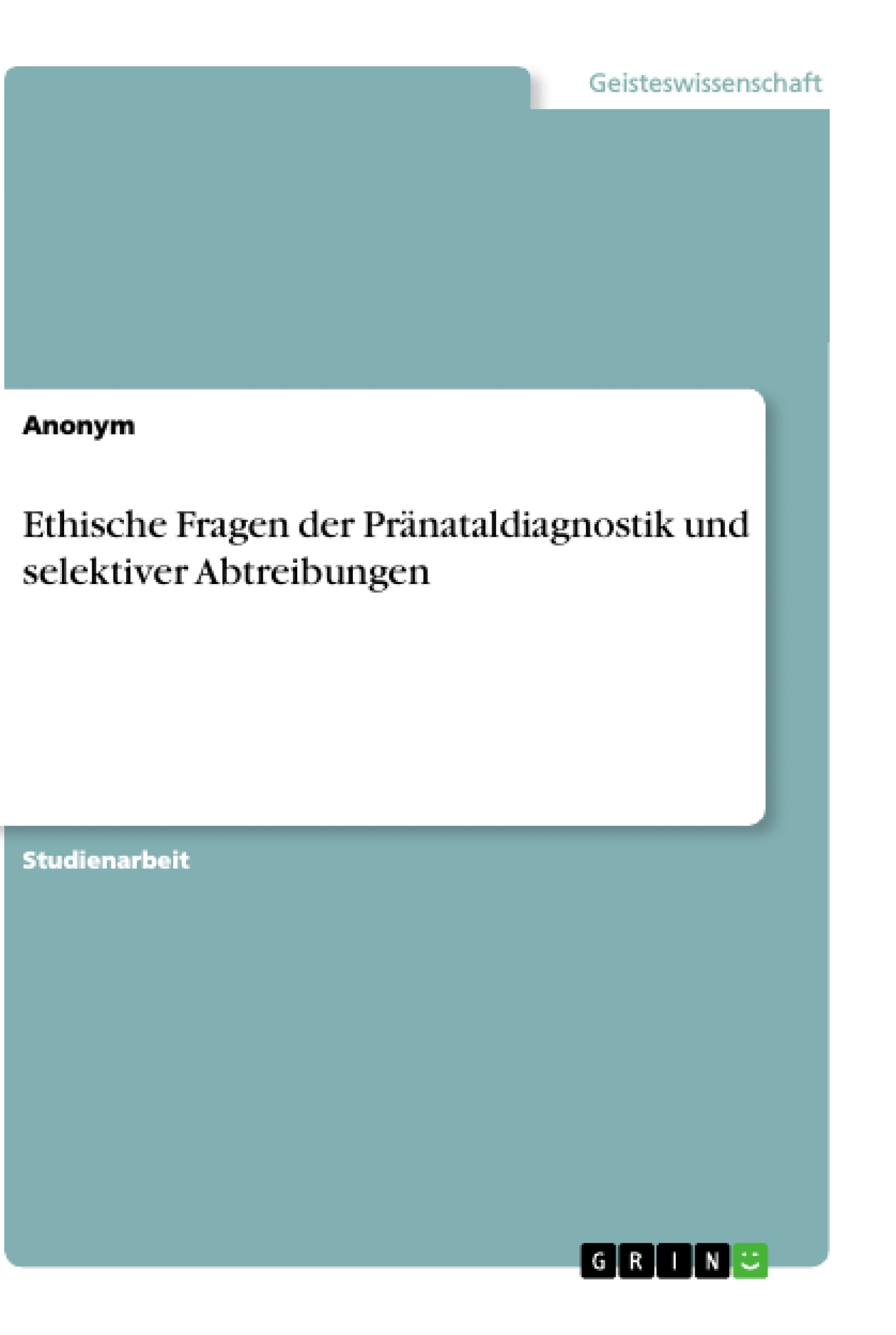Wie lassen sich Verfahren der Pränataldiagnostik und Schwangerschaftsabbrüche, die im Kontext einer zu erwartenden Krankheit des Kindes stattfinden, aus ethischer Sicht bewerten? Handelt es sich bei derartigen Aborten, wie Gegner behaupten, um ein diskriminierendes Selektionsverfahren von Behinderten? Besitzt vorgeburtliches Leben ein Lebensrecht oder kann das Töten von beeinträchtigten Embryonen und Föten ethisch begründet werden?
Ziel der vorliegenden Arbeit ist die Beantwortung dieser Fragestellungen, die unter der Bezugnahme des Präferenzutilitarismus Peter Singers und Helga Kuhses aus ihrem Werk "Muss dieses Kind am Leben bleiben? Das Problem schwerstgeschädigter Neugeborener" (1993) untersucht werden. Bereits zuvor wurden beide Autoren wegen ihrer kontroversen Thesen stark kritisiert. Singer wurden nicht nur eine Missachtung von Menschenrechten und eine diskriminierende Haltung gegenüber Behinderten vorgeworfen. Auch wurden Zitate aus seinem früherem Werk "Praktische Ethik" (1979) aus dem Zusammenhang gerissen, wodurch eine Parallele zwischen seiner partiellen Befürwortung der Euthanasie und dem Euthanasie-Programm im Nationalsozialismus hergestellt wurde.
Um die Ausgangsfragen zu beantworten, soll zunächst mithilfe von Sekundärliteratur der Begriff der Pränataldiagnostik genauer definiert und der rechtliche Rahmen, der bei Aborten gilt, geklärt werden. Anschließend folgt eine Skizze der allgemeinen ethischen Debatte um selektive Abtreibungen, an welche die wichtigsten Kernaspekte Peter Singers und Helga Kuhses Argumentation anknüpfen. Dazu zählen die Kritik an der Lehre von der Heiligkeit des Lebens, der Personenbegriff, die Interessenabwägung und Gegeneinwände zum Vorwurf der Diskriminierung von Behinderten durch selektive Abtreibungen. Während die Analyse der Pränatalen Diagnostik und der selektiven Schwangerschaftsabbrüche von zuverlässigen Positivergebnissen einer vorliegenden Anomalie der Schwangerschaft ausgeht, folgt im Fazit eine Zusammenfassung der Untersuchung sowie ihre kritische Betrachtung.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Pränataldiagnostik
- Begriffsklärung
- Rechtliche Lage eines Aborts nach einer positiven Diagnose
- Selektive Abtreibungen
- Ethische Debatte um selektive Aborte
- Peter Singers und Helga Kuhses Präferenzutilitarismus
- Heiligkeit des Lebens und Speziesismus
- Unterscheidung zwischen Menschen und Personen
- Interessenbefriedigung
- Diskriminierung Behinderter durch selektive Abtreibungen
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die ethische Bewertung von Pränataldiagnostik und daraus resultierenden Schwangerschaftsabbrüchen, insbesondere selektiven Abtreibungen. Sie analysiert die Argumentation von Peter Singer und Helga Kuhse im Kontext ihres Präferenzutilitarismus und deren Relevanz für die ethische Debatte um die Abtreibung von Föten mit Behinderungen.
- Ethische Bewertung der Pränataldiagnostik
- Rechtliche Rahmenbedingungen von Schwangerschaftsabbrüchen
- Der Präferenzutilitarismus von Singer und Kuhse
- Die ethische Debatte um selektive Abtreibungen
- Diskriminierung von Menschen mit Behinderungen
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik der Pränataldiagnostik und selektiver Abtreibungen ein. Sie stellt die zentralen Forschungsfragen der Arbeit vor, welche die ethische Bewertung dieser Praktiken im Lichte des Präferenzutilitarismus von Peter Singer und Helga Kuhse untersuchen. Die Einleitung skizziert den methodischen Ansatz und benennt die kontroversen Positionen der Autoren, die bereits in der Vergangenheit zu scharfer Kritik geführt haben. Die Autoren beziehen sich zwar hauptsächlich auf die Euthanasie schwerstbehinderter Neugeborener, doch lässt sich ihre Argumentation auf selektive Abtreibungen übertragen, was einen wesentlichen Aspekt der Arbeit darstellt.
Pränataldiagnostik: Dieses Kapitel definiert den Begriff der Pränataldiagnostik (PND) und unterscheidet zwischen invasiven und nicht-invasiven Methoden. Es erläutert die rechtlichen Aspekte von Abtreibungen nach auffälligen pränatalen Diagnosen, einschließlich der Beratungsregelungen und der medizinischen Indikationen. Der Fokus liegt auf den Risiken und der Zuverlässigkeit verschiedener diagnostischer Verfahren, die eine sorgfältige Abwägung erfordern. Das Kapitel beleuchtet den Spannungsbogen zwischen der Sicherheit der Mutter und der Genauigkeit der Diagnose, insbesondere im Hinblick auf die Folgen falscher positiver Ergebnisse.
Selektive Abtreibungen: Dieses Kapitel skizziert die ethische Debatte um selektive Abtreibungen, die im Gegensatz zu elektiven Abbrüchen explizit auf die Eigenschaften des Fötus beruhen. Es analysiert die Argumentation von Peter Singer und Helga Kuhse, die den Präferenzutilitarismus als Grundlage ihrer Position verwenden. Die Kapitel behandelt die Kritik an der Lehre von der Heiligkeit des Lebens, den Personenbegriff, die Interessenabwägung und die Einwände gegen den Vorwurf der Diskriminierung von Behinderten durch selektive Abtreibungen. Die Analyse konzentriert sich auf die ethischen Implikationen der Entscheidung für oder gegen einen Schwangerschaftsabbruch im Kontext einer pränatalen Diagnose von Behinderungen.
Schlüsselwörter
Pränataldiagnostik, selektive Abtreibung, Präferenzutilitarismus, Peter Singer, Helga Kuhse, ethische Bewertung, Schwangerschaftsabbruch, Behinderte, Lebensrecht, Diskriminierung, medizinische Indikation, rechtliche Lage.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Ethische Bewertung von Pränataldiagnostik und selektiven Abtreibungen
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht die ethische Bewertung von Pränataldiagnostik und daraus resultierenden Schwangerschaftsabbrüchen, insbesondere selektiven Abtreibungen. Im Fokus steht die Analyse der Argumentation von Peter Singer und Helga Kuhse und deren Präferenzutilitarismus im Kontext der ethischen Debatte um die Abtreibung von Föten mit Behinderungen.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Themen: Ethische Bewertung der Pränataldiagnostik, rechtliche Rahmenbedingungen von Schwangerschaftsabbrüchen, der Präferenzutilitarismus von Singer und Kuhse, die ethische Debatte um selektive Abtreibungen und die Diskriminierung von Menschen mit Behinderungen.
Was ist der Inhalt der Einleitung?
Die Einleitung führt in die Thematik der Pränataldiagnostik und selektiver Abtreibungen ein, stellt die zentralen Forschungsfragen vor und skizziert den methodischen Ansatz. Sie benennt die kontroversen Positionen von Singer und Kuhse und deren Übertragbarkeit von der Euthanasie auf selektive Abtreibungen.
Was wird im Kapitel zur Pränataldiagnostik erläutert?
Das Kapitel definiert den Begriff der Pränataldiagnostik (PND), unterscheidet zwischen invasiven und nicht-invasiven Methoden und erläutert die rechtlichen Aspekte von Abtreibungen nach auffälligen Diagnosen. Es beleuchtet die Risiken und die Zuverlässigkeit verschiedener Verfahren und den Spannungsbogen zwischen der Sicherheit der Mutter und der Genauigkeit der Diagnose.
Worum geht es im Kapitel zu selektiven Abtreibungen?
Dieses Kapitel analysiert die ethische Debatte um selektive Abtreibungen und die Argumentation von Singer und Kuhse basierend auf dem Präferenzutilitarismus. Es behandelt die Kritik an der Lehre von der Heiligkeit des Lebens, den Personenbegriff, die Interessenabwägung und den Vorwurf der Diskriminierung von Behinderten.
Welche Schlüsselwörter sind relevant?
Schlüsselwörter sind: Pränataldiagnostik, selektive Abtreibung, Präferenzutilitarismus, Peter Singer, Helga Kuhse, ethische Bewertung, Schwangerschaftsabbruch, Behinderte, Lebensrecht, Diskriminierung, medizinische Indikation, rechtliche Lage.
Welche Methode wird angewendet?
Die Arbeit analysiert die Argumentation von Peter Singer und Helga Kuhse im Kontext ihres Präferenzutilitarismus und dessen Relevanz für die ethische Debatte um die Abtreibung von Föten mit Behinderungen. Die genaue Methode ist in der Arbeit detaillierter beschrieben.
Wer sind die zentralen Autoren?
Die zentralen Autoren, deren Argumentation analysiert wird, sind Peter Singer und Helga Kuhse, bekannt für ihren Präferenzutilitarismus.
Welche ethischen Fragen werden gestellt?
Zentrale ethische Fragen betreffen die Bewertung von Pränataldiagnostik, die Zulässigkeit von Schwangerschaftsabbrüchen, insbesondere selektiver Abtreibungen aufgrund von Behinderungen, und die Vermeidung von Diskriminierung von Menschen mit Behinderungen.
Gibt es eine Zusammenfassung der Kapitel?
Ja, die Arbeit enthält eine Zusammenfassung jedes Kapitels, welche die wichtigsten Inhalte und Argumentationslinien zusammenfasst.
- Arbeit zitieren
- Anonym (Autor:in), 2019, Ethische Fragen der Pränataldiagnostik und selektiver Abtreibungen, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/468339