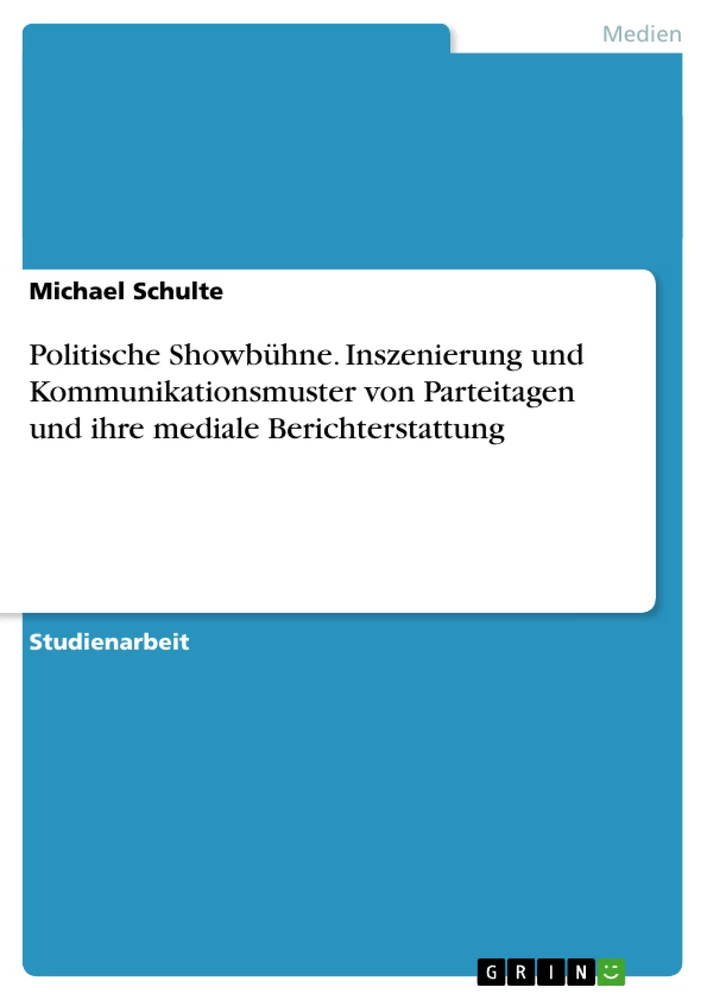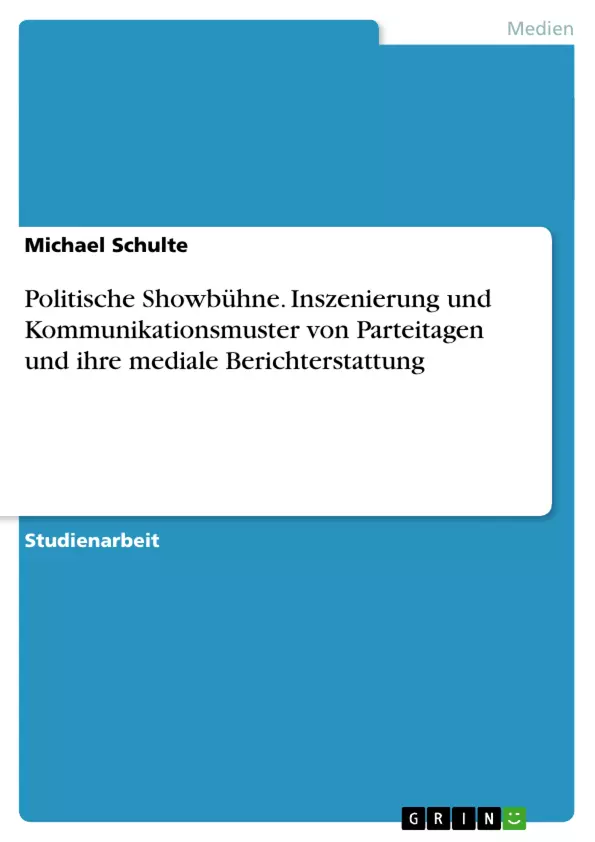Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit den Fragen, welche organisatorischen, kommunuikativen und gestalterischen Möglichkeiten bei der Inszenierung von Parteitagen angewendet werden, wie die Medien in ihrer Berichterstattung darauf reagieren und welche Entwicklungen in der deutschen Parteitagskultur zu erwarten sind. Damit soll ein Beitrag zur Bewertung des wechselseitigen Abhängigkeitsverhältnisses von Politik und Medien geleistet werden. Zunächst werden Funktion, Form und Organisation von Parteitagen erläutert. Darauf aufbauend erfolgt ein Überblick zu den räumlichen, zeitlichen und optischen Inszenierungstechniken. Ein eigenständiges Kapitel befasst sich mit den unterschiedlichen Kommunikationsformen auf Parteitagen und deren Verschiebungen, bevor eine Analyse der medialen Parteitagsberichtberichterstattung vorgenommen wird. Am Beispiel des SPD-Parteitags Leipzig 1998 werden die Inszenierungsmerkmale konkret dargestellt und das mediale Echo abgebildet. In der Schlussbetrachtung wird ein Ausblick auf die Entwicklung von Parteitage n gegeben.
Inhaltsverzeichnis
- Einführung
- Untersuchungsgegenstand und Erkenntnisinteresse
- Forschungsfrage und Struktur der Untersuchung
- Parteitage - Definitionen und Grundlagen
- Funktionen
- Parteitagsformen
- Strukturelle Organisation
- Inszenierung von Parteitagen
- Räumliche Komponente
- Zeitliche Komponente
- Optische Komponente
- Kommunikationsmuster von Parteitagen
- Binnenkommunikation
- Außenkommunikation
- Parteitagsberichterstattung in den Medien
- Vorberichterstattung
- Parallele und nachgelagerte Berichterstattung
- SPD-Parteitag Leipzig 1998 – das Urbild für die politische Showbühne
- Modernisiertes Veranstaltungsmanagement
- Telemediatisierung
- Probleme der Funktionsausübung
- Reaktion der Journalisten
- Verhältnis zwischen Politik und Medien
- Zusammenfassung und Schlussbetrachtung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Inszenierungs- und Kommunikationsstrategien von Parteitagen in Deutschland. Sie analysiert, wie Parteitage unter dem Einfluss der Mediendemokratie organisiert, inszeniert und kommuniziert werden. Der Fokus liegt dabei auf dem wechselseitigen Abhängigkeitsverhältnis zwischen Politik und Medien sowie den Auswirkungen dieser Entwicklungen auf die innerparteilichen Kommunikationsstrukturen.
- Parteitage als Instrument der Selbstdarstellung und des "impression management"
- Die Rolle der Medien in der Inszenierung von Parteitagen
- Verschiebung der Kommunikationsformen auf Parteitagen
- Analyse der medialen Parteitagsberichterstattung
- Die Entwicklung von Parteitagen im Kontext der Mediendemokratie
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit beginnt mit einer Einführung in den Untersuchungsgegenstand, dem Erkenntnisinteresse und der Forschungsfrage. Es folgt eine Definition der Parteitage, ihrer Funktionen und Formen, sowie ein Überblick über die strukturelle Organisation.
Im dritten Kapitel werden die räumlichen, zeitlichen und optischen Inszenierungstechniken von Parteitagen beleuchtet. Das vierte Kapitel behandelt die unterschiedlichen Kommunikationsformen auf Parteitagen, einschließlich Binnenkommunikation und Außenkommunikation.
Das fünfte Kapitel befasst sich mit der medialen Parteitagsberichterstattung und den verschiedenen Formen der Berichterstattung, wie Vorberichterstattung und parallele/nachgelagerte Berichterstattung. Am Beispiel des SPD-Parteitags Leipzig 1998 werden die Inszenierungsmerkmale und das mediale Echo konkret dargestellt.
Schlüsselwörter
Parteitage, Mediendemokratie, Inszenierung, Kommunikation, politische Showbühnen, Parteiführung, Parteimitglieder, Journalisten, innerparteiliche Kommunikation, Medienberichterstattung, SPD, CDU.
Häufig gestellte Fragen
Warum werden Parteitage heute oft als „Showbühne“ bezeichnet?
Durch die zunehmende Medialisierung dienen Parteitage weniger der internen Debatte als vielmehr der gezielten Selbstdarstellung (Impression Management) für die Wähler über das Fernsehen.
Welche Inszenierungstechniken werden auf Parteitagen genutzt?
Eingesetzt werden räumliche (Bühnenbau), zeitliche (Ablaufplanung für die Primetime) und optische Komponenten (Corporate Design, Lichteffekte).
Welche Rolle spielen die Medien bei der Berichterstattung?
Es besteht ein wechselseitiges Abhängigkeitsverhältnis: Parteien brauchen Medien für ihre Botschaften, während Medien über dramaturgisch aufbereitete politische Ereignisse berichten.
Was war das Besondere am SPD-Parteitag in Leipzig 1998?
Er gilt als Urbild der politischen Showbühne in Deutschland, mit modernisiertem Veranstaltungsmanagement und einer starken Ausrichtung auf die Telemediatisierung.
Was ist der Unterschied zwischen Binnen- und Außenkommunikation?
Binnenkommunikation richtet sich an die Parteimitglieder vor Ort; Außenkommunikation zielt über die Medienberichterstattung auf die breite Öffentlichkeit ab.
Leidet die demokratische Funktion unter der Inszenierung?
Kritiker argumentieren, dass echte politische Auseinandersetzungen und die Mitwirkung der Basis zugunsten einer harmonischen medialen Darstellung oft in den Hintergrund rücken.
- Quote paper
- Dipl.-Journ. Michael Schulte (Author), 2005, Politische Showbühne. Inszenierung und Kommunikationsmuster von Parteitagen und ihre mediale Berichterstattung, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/47094