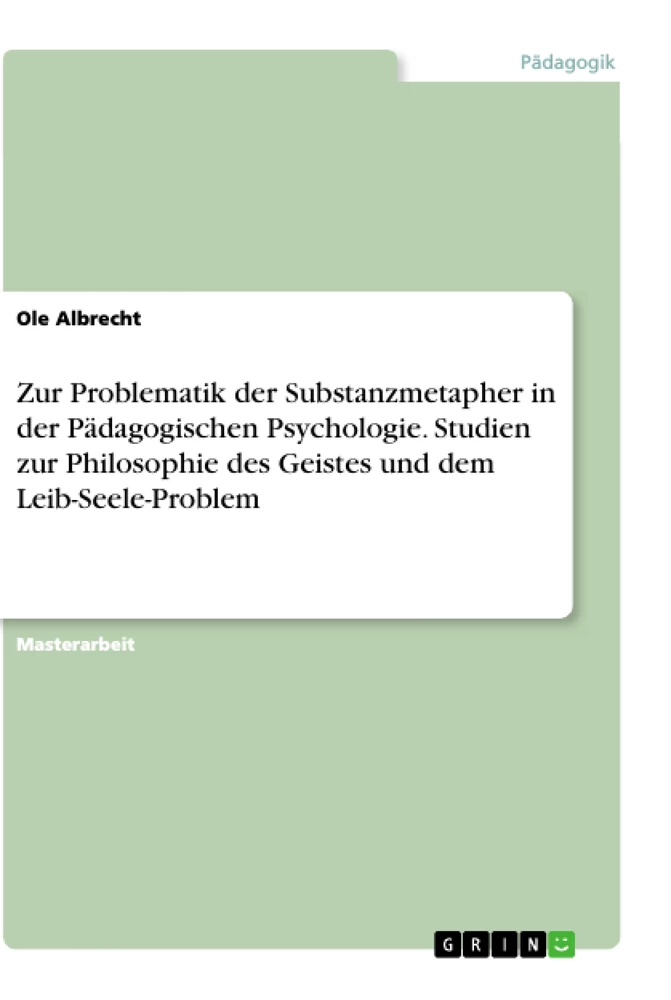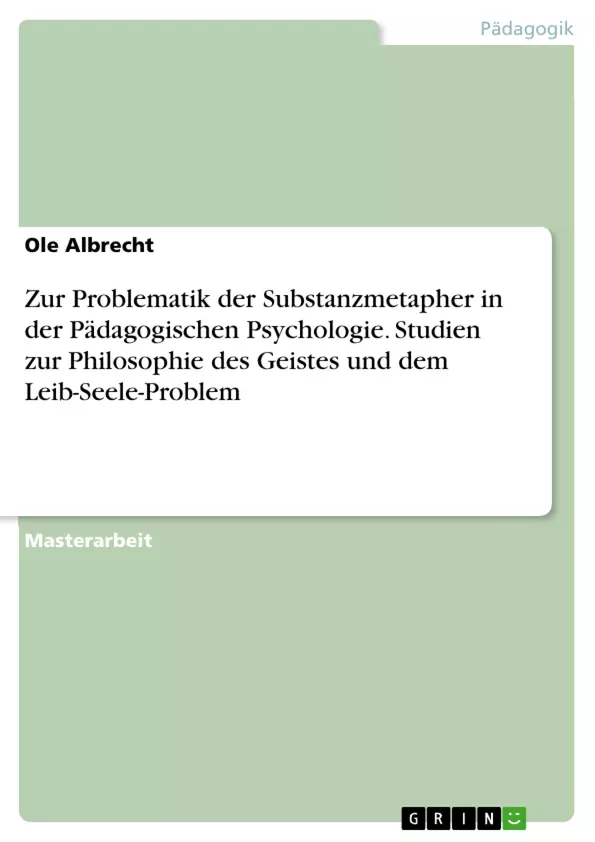Die vorliegende Arbeit befasst sich mit der Frage, welchen Einfluss philosophische Theorien auf die wissenschaftliche Psychologe ausüben und wie wiederum nachgewiesen werden kann, welchen Einfluss die philosophische Fundierung der Psychologie ihrerseits auf die Pädagogische Psychologie und das Erziehungs- und Bildungswesen ausübt.
Die im Zuge der Kognitiven Revolution zu Beginn der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts entstandenen Kognitionswissenschaften, in denen die verschiedensten wissenschaftlichen Disziplinen, etwa die Neurobiologie, die Psychologie, die Informatik oder die Linguistik, erfolgreich zusammenarbeiten, zeichnen sich besonders durch ein hohes Maß an interdisziplinärer Kooperation aus. Wissenschaftszweige wie die Kogntive Neurobiologie, die Computerlinguistik oder die Kognitive Neuropsychologie stellen Fusionen dar, in denen sich diese Interdisziplinarität manifestiert. Auch die Pädagogische Psychologie ist ein interdisziplinäres Projekt, in dem Pädagogik und Psychologie eine symbiotische Verbindung eingehen.
Auffällig ist jedoch, dass die Disziplin, aus der sowohl Psychologie als auch Pädagogik historisch hervorgingen, im interdisziplinären Diskurs selten eine entscheidende Rolle spielt. Die Rede ist von der Philosophie als Grundlage von Wissenschaft im Allgemeinen und im Besonderen. Dies mag damit zusammenhängen, dass die Philosophie sich in den Augen vieler Wissenschaftler ausschließlich mit unlösbaren theoretischen Rätseln beschäftigt, während es in der Wissenschaft doch vielmehr um empirische Resultate geht. Dies mag in vielen Fällen ein berechtigter Vorwurf sein. Im Hinblick auf die philosophischen Grundlagen der Kognitionswissenschaften, insbesondere der Kognitiven Psychologie , aus der ein Großteil der Pädagogischen Psychologie hervorgeht, trifft dieser Einwand definitiv nicht zu.
Wenn zum Beispiel im Bereich der Kognitiven Neurowissenschaft ausgesagt wird, dass kognitive Prozesse im Gehirn stattfinden, handelt es sich bereits um eine hochgradig philosophische Aussage, unabhängig davon, ob er, der Wissenschaftler, der diese Aussage trifft, sich dessen bewusst ist oder nicht. Man muss sich klar machen, dass philosophische Konzepte im Rahmen der Kognitionswissenschaften keine unlösbaren Rätsel darstellen, die man zu Gunsten der wissenschaftlichen Praxis ausklammern könnte.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Das Cartesianische Erbe
- Materialismus und Substanzmetapher
- Allgemein
- Behaviorismus
- Theorien der Identität
- Funktionalismus
- Fazit
- Die Substanzmetapher in der Pädagogische Psychologie
- Allgemein
- Pädagogik und Behaviorismus
- Pädagogik und Kognitive Psychologie
- Was ist Wissen?
- Was ist Transfer?
- Die Substanzmetapher in der Kognitiven Neurowissenschaft
- Allgemein
- Empirische Untersuchung
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Masterarbeit analysiert den Einfluss philosophischer Theorien, insbesondere des Materialismus und der Substanzmetapher, auf die Entwicklung der Pädagogischen Psychologie. Die Arbeit verfolgt das Ziel, die historische Entwicklung der Substanzmetapher in der Psychologie zu untersuchen und deren Bedeutung für die Pädagogische Psychologie aufzuzeigen.
- Die historische Entwicklung des Materialismus und der Substanzmetapher in der Psychologie
- Die Bedeutung der Substanzmetapher für das Verständnis von Geist und kognitiven Prozessen
- Die Rolle der Substanzmetapher in der Pädagogischen Psychologie und ihre Auswirkungen auf Erziehungs- und Bildungswesen
- Die Verbindung zwischen Substanzmetapher und dem Leib-Seele-Problem
- Die Herausforderungen und Chancen der Substanzmetapher für die moderne Psychologie und Pädagogik
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in das Thema der Substanzmetapher ein und erläutert die Bedeutung der Philosophie für die Kognitionswissenschaften, insbesondere die Pädagogische Psychologie. Kapitel 2 beleuchtet das Cartesianische Erbe und dessen Einfluss auf die Entwicklung der Substanzmetapher. In Kapitel 3 wird der Materialismus und die Substanzmetapher in ihren unterschiedlichen Ausprägungen (Behaviorismus, Theorien der Identität, Funktionalismus) näher betrachtet. Kapitel 4 untersucht die Substanzmetapher im Kontext der Pädagogischen Psychologie, während Kapitel 5 die Substanzmetapher in der Kognitiven Neurowissenschaft beleuchtet. Das Fazit fasst die zentralen Ergebnisse der Arbeit zusammen und gibt einen Ausblick auf weitere Forschungsfragen.
Schlüsselwörter
Substanzmetapher, Materialismus, Geist, Kognitionswissenschaften, Pädagogische Psychologie, Leib-Seele-Problem, Behaviorismus, Funktionalismus, Kognitiven Neurowissenschaft, Descartes, Philosophie.
- Quote paper
- Ole Albrecht (Author), 2013, Zur Problematik der Substanzmetapher in der Pädagogischen Psychologie. Studien zur Philosophie des Geistes und dem Leib-Seele-Problem, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/471047