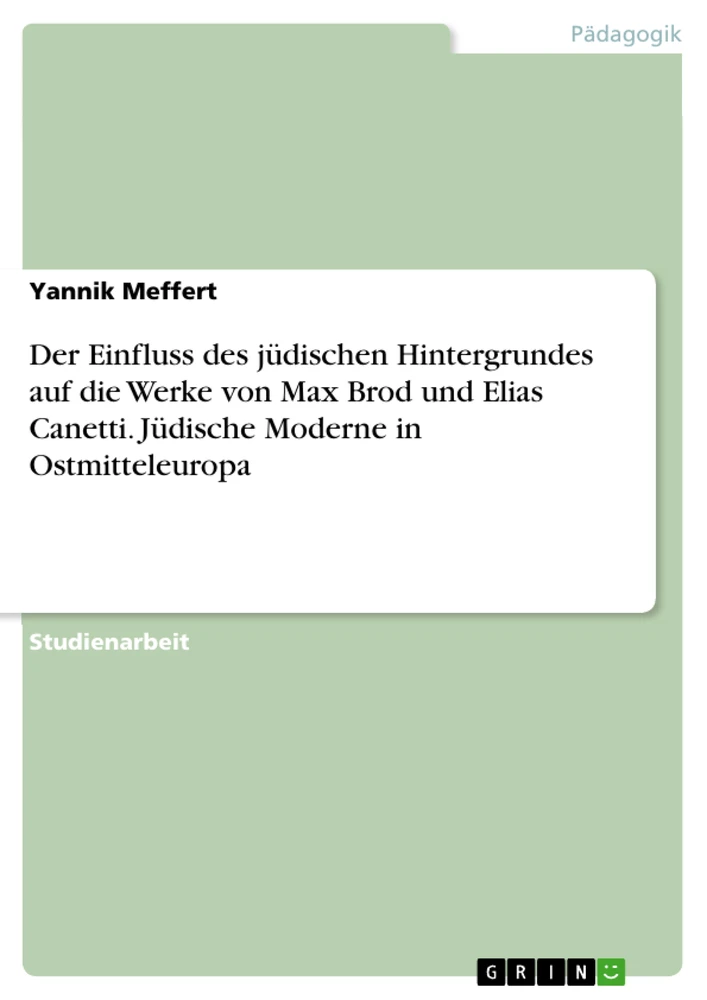Inhaltsangabe
Einleitung
Max Brod – Leben und Weltanschauung
Poetologie „Der jüdische Dichter deutscher Zunge“
„Reubeni Fürst der Juden“
Elias Canetti – Assimilation vs. Zionismus
„Die Befristeten“
Fazit
Nach dem Holocaust eröffnete sich für viele jüdische Autoren deutscher Herkunft ein Spannungsfeld zwischen ihrer Herkunft und dem Schaffen von Literatur in der deutschen Sprache. Die Selbstverortung der Autoren im Diskurs ist hierbei ein zentraler Aspekt dieser Hausarbeit, der andere zentrale Aspekt ist die Untersuchung, wie sich dieses Spannungsfeld und der jüdische Hintergrund auf die Werke niederschlägt.
Max Brod und Elias Canetti schufen nach ´45 weiter Literatur auf Deutsch. Neben ihrer Literatur setzen sie sich zudem poetologisch mit dem empfundenen Widerspruch zwischen ihrer Abstammung und Sprache auseinander. Von habe ich bei Brod einen poetologischen Text und einen literarischen Text ausgewählt. Am Text Der jüdische Dichter deutscher Zunge untersuche ich auf die Selbstverortung Brods als Dichter im Spannungsfeld zwischen jüdischer Herkunft und deutschem Nationalgefühl. Dabei gehe ich auf den Diskurs ein, der das Spannungsfeld zwischen eben jenen Polen umfasst. Im literarischen Teil zu Max Brod soll dieser Diskurs am Roman Reubeni Fürst der Juden verdeutlicht werden. Der biografische Teil dient jeweils als hinleitende Erklärung zu den beiden Autoren und beleuchtet ihre persönlichen Hintergründe, wie auch die historischen Umstände, die das Verhältnis zwischen Juden und ihrer Umgebung bestimmen. Zudem werde ich dabei einen Einblick in die persönliche politische und weltanschauliche Meinung der Autoren geben. Im Fall von Max Brod ist ein entscheidender Aspekt die Nationalitätenfrage im Prag des frühen 20. Jahrhunderts, welches mit dem Ende der kaiserlichen und königlichen Monarchie und der Selbstständigkeit der Tschechoslowakei große Veränderungen erlebt. Im Fall von Elias Canetti ist die Flucht vor dem Nationalsozialismus zu erwähnen, die ihn, der er eine Generation nach Brod zu verorten ist, ebenso betrifft, wie die Shoa, welche das Spannungsfeld zwischen jüdischer Herkunft und deutscher Sprache noch drastischer werden lässt. Vor diesem Hintergrund werde ich das Drama Die Befristeten analysieren. Dabei gehe ich einmal auf den Aspekt des jüdischen Einflusses auf das Werk ein und in welchen Motiven es sich äußert. Dazu werde ich untersuchen, wie die Shoa und der Tod an sich in Die Befristeten dargestellt und verarbeitet werden.
Inhaltsverzeichnis
l.Einleitung
2.1. Biografisches zu Max Brod
2.2. Derjüdische Dichter deutscher Zunge
2.3. Reubeni. Fürst der Juden
3.1. Biografie Elias Canetti
3.2. Die Befristeten
4. Fazit
-
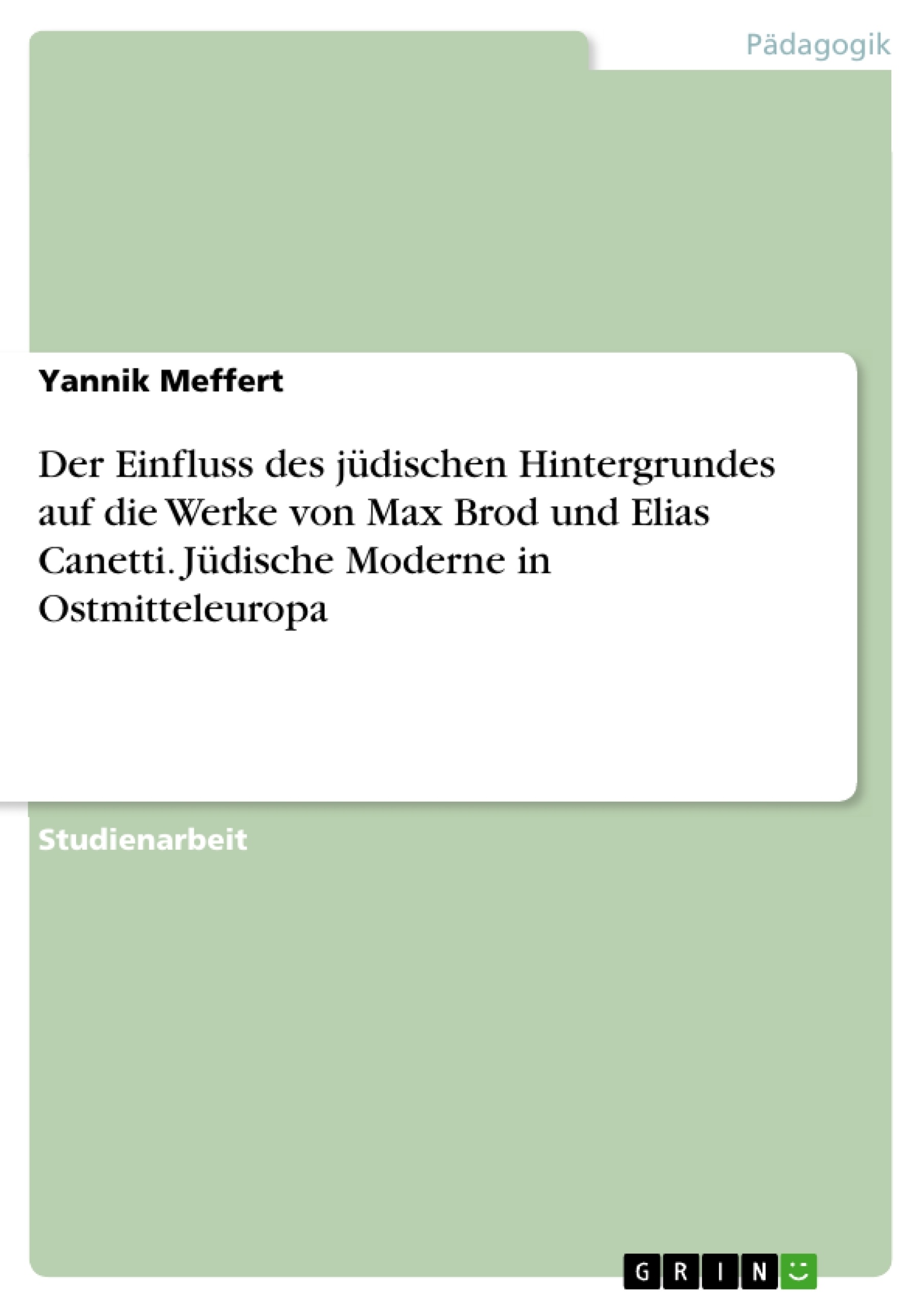
-

-

-
Laden Sie Ihre eigenen Arbeiten hoch! Geld verdienen und iPhone X gewinnen. -

-
Laden Sie Ihre eigenen Arbeiten hoch! Geld verdienen und iPhone X gewinnen. -

-
Laden Sie Ihre eigenen Arbeiten hoch! Geld verdienen und iPhone X gewinnen. -

-
Laden Sie Ihre eigenen Arbeiten hoch! Geld verdienen und iPhone X gewinnen. -

-
Laden Sie Ihre eigenen Arbeiten hoch! Geld verdienen und iPhone X gewinnen. -

-
Laden Sie Ihre eigenen Arbeiten hoch! Geld verdienen und iPhone X gewinnen. -

-
Laden Sie Ihre eigenen Arbeiten hoch! Geld verdienen und iPhone X gewinnen.