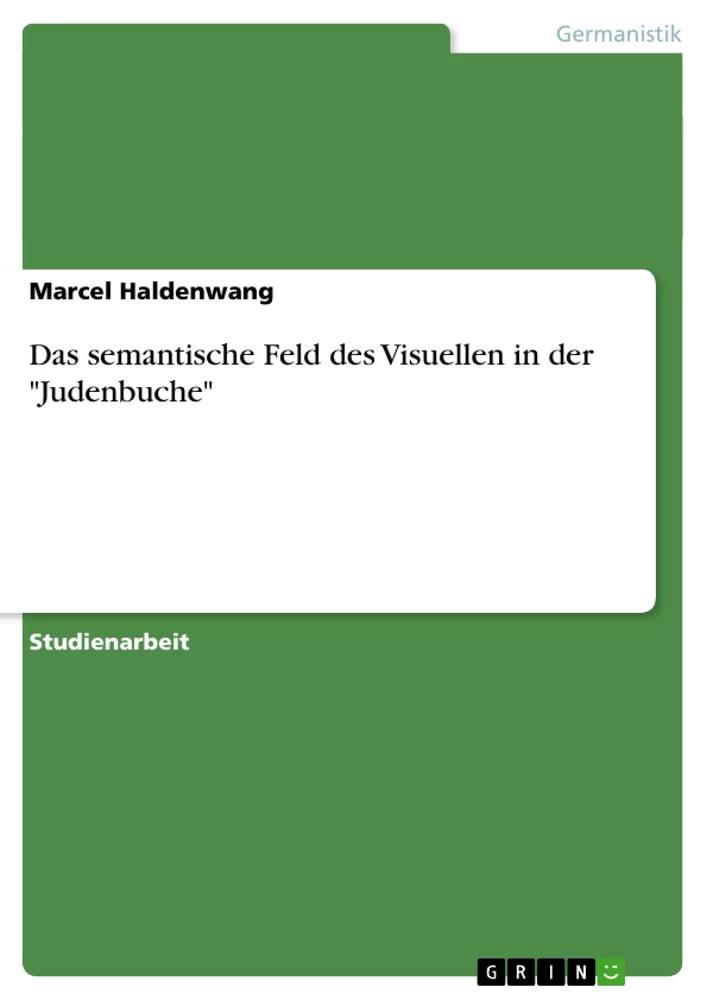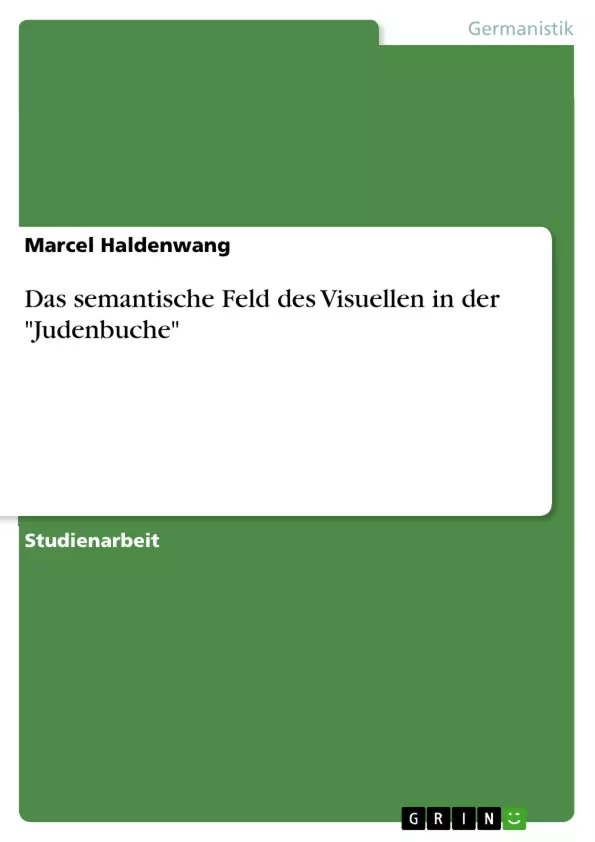Die vom renommierten Grimm-Forscher Prof. Rölleke mit „sehr gut“ bewertete Arbeit spürt der tiefen Symbolik der „Judenbuche“ nach. An manchen Stellen ist es recht augenscheinlich, dass Droste eine tiefe Symbolik in ihre Worte legt. So begegnet dem Leser vielfach Wettersymbolik, und auch die Namenssymbolik in der „Judenbuche“ ist recht evident. Zudem bekundet sich die Buche als Dingsymbol, deren Rachespruch die Dichterin selbst auflöst. Und auch die Narbe ist nicht einfach nur Narbe, genauso wie die (inkongruenten) Daten in der „Judenbuche“ einen unverkennbar symbolischen Gehalt haben. Schwieriger jedoch ist die Entschlüsselung des Symbolgehalts des Visuellen in der gesamten Novelle. Diese Arbeit nimmt daher einmal das semantische Feld des Visuellen genauestens in „Augenschein“.
Auszug aus der Bewertung:
„Die Arbeit ist eine in vieler Hinsicht ausgezeichnete Leistung. Problembewusste, methodenkundige, konzise Vorüberlegungen zum Begriff des Wortfeldes führen auf hohem Niveau ins Thema ein, das dann umfassend und mit z. T. sehr guten Interpretationen bewältigt ist. Genaueste Textkenntnisse und -beobachtungen führen zu einigen neuen, stringenten Ergebnissen. Berücksichtigung und Einarbeitung der Sekundärliteratur sind angemessen.“
Inhaltsverzeichnis
- 0. Einleitung
- 1. Wortfeldtheoretische Prämissen
- 2. Das semantische Feld des Visuellen
- 2.1. Literaler Sinn und erzähltechnische Verwendung
- 2.1.1. Vagheit
- 2.1.2. Perspektivierung
- 2.2. Bildhafter Wortgebrauch
- 2.2.1. Die Küchen- und Hochzeitsszene
- 2.2.2. Friedrichs Verführung
- 2.2.3. Der Förstermord
- 2.2.4. Der Judenmord
- 2.2.5. Die Heimkehr
- 2.1. Literaler Sinn und erzähltechnische Verwendung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht das semantische Feld des Visuellen in Annette von Droste-Hülshoffs „Judenbuche“. Ziel ist es, die verschiedenen Sinnschichten der visuellen Wortwahl zu analysieren und deren Bedeutung für die Erzähltechnik und mögliche Symbolik zu ergründen. Die Arbeit basiert auf einer wortfeldtheoretischen Grundlage und berücksichtigt verschiedene Interpretationsebenen der verwendeten Wörter.
- Analyse des semantischen Feldes des Visuellen in der „Judenbuche“
- Untersuchung des literalen Sinns und der erzähltechnischen Funktion visueller Wortwahl
- Erforschung des bildhaften Wortgebrauchs und möglicher symbolischer Bedeutungen
- Anwendung und Diskussion wortfeldtheoretischer Ansätze
- Interpretation der visuellen Elemente im Kontext der Gesamtgeschichte
Zusammenfassung der Kapitel
0. Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik ein und verweist auf die explizite Aussage des Erzählers über die Realität der dargestellten Ereignisse in der „Judenbuche“. Sie hebt die ambivalente Haltung des Lesers hervor, der zwischen der literarischen Gestaltung und der Behauptung der Authentizität der Geschichte vermittelt. Die Einleitung deutet auf die vielschichtige Symbolik des Werkes hin (Wetter-, Namenssymbolik, die Buche als Symbol, die Narbe, inkonsistente Daten) und kündigt die folgende Analyse des semantischen Feldes des Visuellen an, wobei verschiedene Sinnschichten der Wortwahl untersucht werden sollen.
1. Wortfeldtheoretische Prämissen: Dieses Kapitel definiert den Begriff „Wortfeld“ und beschreibt das zugrundeliegende Wortfeldverständnis der Arbeit. Es erläutert Triers Theorie der Wortfeldsemantik und diskutiert die Herausforderung, die sich aus der traditionellen Beschränkung auf eine Wortart ergibt. Die Arbeit weicht von dieser Einschränkung ab und verwendet den umfassenderen Begriff „semantisches Feld“, um die wortartenübergreifende Analyse des visuellen Wortfeldes in der „Judenbuche“ zu ermöglichen. Es werden kritische Überlegungen zur Wortartgrenze und die Berücksichtigung semantischer Ähnlichkeiten und Prototypen angesprochen.
2. Das semantische Feld des Visuellen: Dieses Kapitel bildet den Kern der Arbeit und analysiert das semantische Feld des Visuellen in der „Judenbuche“. Es unterteilt die Analyse in den „literalen Sinn und erzähltechnische Verwendung“ sowie den „bildhaften Wortgebrauch“. Der erste Teil fokussiert auf Wörter, die wörtlich verwendet werden, aber eine besondere Funktion in der Erzähltechnik erfüllen. Der zweite Teil befasst sich mit dem bildhaften Gebrauch von Wörtern aus dem semantischen Feld und erörtert deren mögliche symbolische Bedeutung. Die Unterkapitel untersuchen konkrete Szenen (Küchen- und Hochzeitsszene, Friedrichs Verführung, der Förstermord, der Judenmord, die Heimkehr) im Hinblick auf die visuelle Darstellung und deren Interpretation.
Schlüsselwörter
Judenbuche, Annette von Droste-Hülshoff, Semantisches Feld, Visuelles, Wortfeldtheorie, Erzähltechnik, Symbolik, Bildsprache, Literaler Sinn, Bildhafter Wortgebrauch, Wortbedeutung, Interpretation.
Häufig gestellte Fragen zur Analyse des semantischen Feldes des Visuellen in Annette von Droste-Hülshoffs „Judenbuche“
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit analysiert das semantische Feld des Visuellen in Annette von Droste-Hülshoffs Novelle „Judenbuche“. Im Fokus steht die Untersuchung der verschiedenen Sinnschichten der visuellen Wortwahl, ihrer Bedeutung für die Erzähltechnik und mögliche symbolische Bedeutungen.
Welche methodischen Grundlagen werden verwendet?
Die Analyse basiert auf der Wortfeldtheorie, erweitert um einen umfassenderen Ansatz des „semantischen Feldes“, der die wortartenübergreifende Betrachtung ermöglicht. Die Arbeit diskutiert kritisch die Grenzen traditioneller wortfeldtheoretischer Ansätze und berücksichtigt semantische Ähnlichkeiten und Prototypen.
Welche Aspekte des semantischen Feldes des Visuellen werden untersucht?
Die Analyse unterscheidet zwischen dem „literalen Sinn und der erzähltechnischen Verwendung“ visueller Wörter und dem „bildhaften Wortgebrauch“. Der literale Sinn betrachtet die wörtliche Bedeutung im Kontext der Erzähltechnik, während der bildhafte Wortgebrauch auf mögliche Symbolik und metaphorische Bedeutungen eingeht.
Welche konkreten Szenen werden analysiert?
Die Analyse untersucht verschiedene Schlüsselstellen der „Judenbuche“, darunter die Küchen- und Hochzeitsszene, Friedrichs Verführung, den Förstermord, den Judenmord und die Heimkehr. In diesen Szenen wird die visuelle Darstellung und ihre Interpretation im Detail beleuchtet.
Welche Ziele verfolgt die Arbeit?
Die Arbeit zielt darauf ab, die vielschichtigen Bedeutungen der visuellen Wortwahl in der „Judenbuche“ zu entschlüsseln. Es soll aufgezeigt werden, wie die visuelle Sprache die Erzähltechnik unterstützt und zur Gesamtdeutung des Werkes beiträgt. Die Anwendung und Diskussion wortfeldtheoretischer Ansätze ist ebenfalls ein zentrales Anliegen.
Wie wird die Einleitung gestaltet?
Die Einleitung führt in die Thematik ein und hebt die Ambivalenz der Erzählsituation hervor: Der Erzähler behauptet die Realität der Ereignisse, während die literarische Gestaltung eine Distanzierung impliziert. Es wird auf die vielschichtige Symbolik hingewiesen (Wetter, Namen, Buche, Narbe, inkonsistente Daten) und die Analyse des semantischen Feldes des Visuellen angekündigt.
Was beinhaltet das Kapitel zu den wortfeldtheoretischen Prämissen?
Dieses Kapitel definiert den Begriff „Wortfeld“ und erläutert das in der Arbeit verwendete Verständnis. Es beschreibt Triers Theorie und diskutiert die Herausforderung der traditionellen Beschränkung auf eine Wortart. Die Arbeit argumentiert für einen umfassenderen Ansatz, der semantische Ähnlichkeiten und Prototypen über Wortarten hinweg berücksichtigt.
Wie ist das Kapitel zum semantischen Feld des Visuellen aufgebaut?
Das Kernkapitel analysiert das semantische Feld des Visuellen, unterteilt in den literalen und den bildhaften Gebrauch visueller Wörter. Es untersucht konkrete Szenen aus der „Judenbuche“ und interpretiert deren visuelle Darstellung im Kontext der Gesamtgeschichte.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Judenbuche, Annette von Droste-Hülshoff, Semantisches Feld, Visuelles, Wortfeldtheorie, Erzähltechnik, Symbolik, Bildsprache, Literaler Sinn, Bildhafter Wortgebrauch, Wortbedeutung, Interpretation.
- Quote paper
- Marcel Haldenwang (Author), 2002, Das semantische Feld des Visuellen in der "Judenbuche", Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/4735