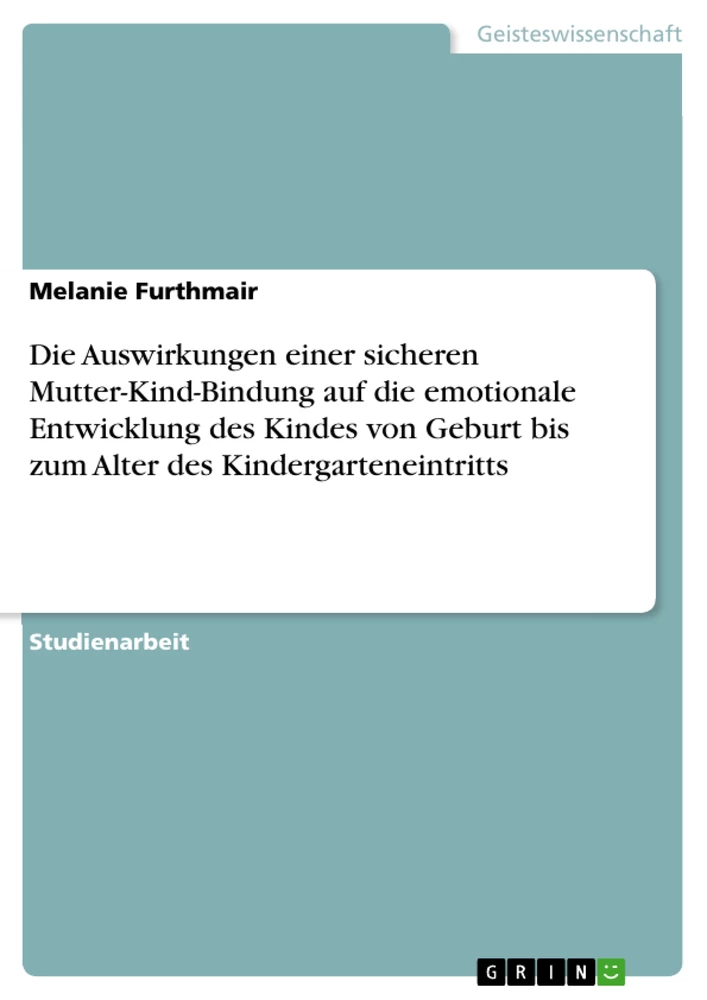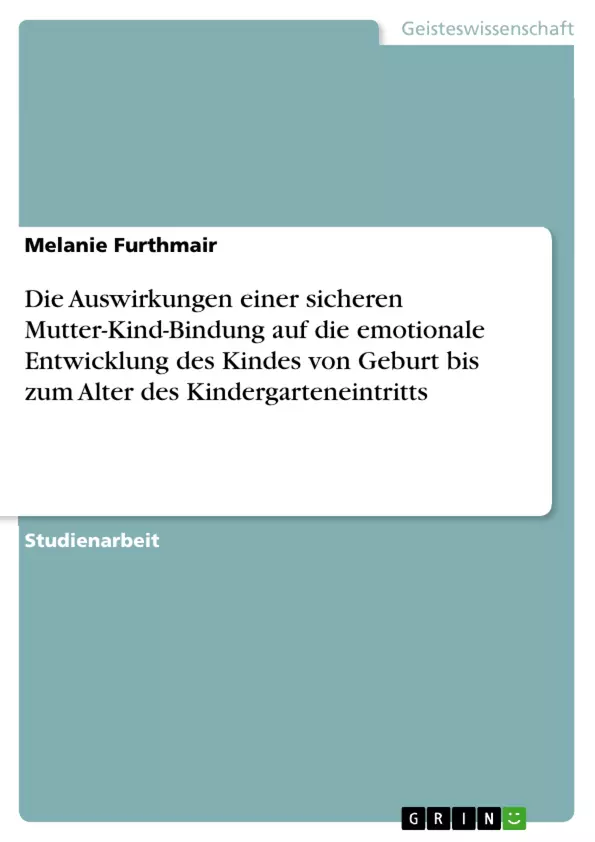Abschließend werden im letzten Abschnitt Erkenntnisse von Seiten der Autorin aufgezeigt und zusätzlich eine Prognose für die Zukunft in diesem Themenbereich gegeben.
Im ersten Abschnitt der Arbeit wird der Begriff „Bindung“ definiert, dessen Begründer, John Bowlby kurz vorgestellt und seine Bindungstheorie anhand einer kurzen inhaltlichen Einordnung mit den Kontroversen, die ihn von seinen damaligen Kollegen der psychoanalytischen Schule unterschieden, ausgeführt. Außerdem werden spezifisch drei dyadische Bedingungen einer Bindung genannt, die je nach deren Dimension Einfluss auf die Qualität der fokussierten Mutter- Kind- Bindung nehmen und anlässlich der zentralen Fragestellung wird weiterhin noch die klassische Laborbeobachtungsmethode zur Erhebung der Bindungsqualität skizziert und die vier möglichen „Bindungsergebnisse“, die Bindungsklassifikationen.
Die emotionale Entwicklung und Kompetenz werden im zweiten Teil der Arbeit zunächst begrifflich bestimmt und der Entwicklungsverlauf der emotionalen Entwicklung von Geburt bis etwa zum Alter des Kindergarteneintritts, in einzelne emotionale Entwicklungsbereiche untergliedert, aufgezeigt.
Abschließend werden im letzten Abschnitt Erkenntnisse von Seiten der Autorin aufgezeigt und zusätzlich eine Prognose für die Zukunft in diesem Themenbereich gegeben.
Inhaltsverzeichnis
- Einführung in die Thematik..
- Einleitender Gedanke und Themenbegründung
- Aufbau der folgenden Arbeit mit zentraler Fragestellung ..
- Bindung
- Begriffsbestimmung „Bindung“
- Die Bindungstheorie nach John Bowlby und Mary Ainsworth...
- Dyadische Bedingungen als Einflusskomponenten einer Bindung ..
- Bindungspersonen
- Feinfühligkeit als Einflusskriterium auf die „Bindung“.
- Internale Arbeitsmodelle
- Klassifikationen von Bindungsbeziehungen.
- B - Sicheres Bindungsmuster.....
- A - Unsicher- Vermeidendes Bindungsmuster
- C - Unsicher- Ambivalentes Bindungsmuster.....
- D - Desorganisiertes Bindungsmuster.....
- Emotionale Entwicklung und Kompetenz.
- Begriffsbestimmung „Emotionen“
- Begriffsbestimmung „Emotionale Kompetenz“.
- Entwicklungsverlauf der „emotionalen Entwicklung“ bis zum Kindergarteneintritt..
- Emotionale Bewusstheit und Emotionsausdruck
- Sprachlicher Emotionsausdruck........
- Trennung von emotionalem Erleben und Emotionsausdruck...
- Emotionsregulation
- Auswirkungen einer sicheren Eltern-Kind- Bindung auf die emotionale Entwicklung ......
- Ausführliche Beschreibung des B - Bindungsmusters...........
- Auswirkungen auf die „Entwicklung primärer Emotionen“.
- Auswirkungen auf die „Entwicklung des sprachlichen Emotionsausdrucks“.
- Auswirkungen auf die „Entwicklung von Emotionsregulationsstrategien”
- Fazit.
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit befasst sich mit der Eltern-Kind-Bindung, insbesondere der Mutter-Kind-Bindung, und ihren Auswirkungen auf die emotionale Entwicklung des Kindes. Die zentrale Fragestellung lautet: Inwiefern beeinflusst die Qualität der frühen Bindungsbeziehung die emotionale Entwicklung des Kindes?
- Definition des Begriffs „Bindung“ und Vorstellung der Bindungstheorie nach John Bowlby und Mary Ainsworth.
- Analyse der dyadischen Bedingungen einer Bindung, wie Bindungspersonen, Feinfühligkeit und interne Arbeitsmodelle.
- Klassifikation von Bindungsbeziehungen in sichere und unsichere Bindungsmuster.
- Beschreibung der emotionalen Entwicklung und Kompetenz sowie deren Entwicklungsverlauf bis zum Kindergarteneintritt.
- Präsentation von wissenschaftlichen Studien, die die Auswirkungen unterschiedlicher Bindungsqualitäten auf die emotionale Entwicklung des Kindes untersucht haben.
Zusammenfassung der Kapitel
- Einführung in die Thematik: Das Kapitel führt in das Thema der Eltern-Kind-Bindung ein und beleuchtet die Relevanz der Fragestellung für die Profession der Kindheitspädagogin. Es bietet einen Überblick über den Aufbau der Hausarbeit.
- Bindung: Dieses Kapitel definiert den Begriff „Bindung“ und stellt die Bindungstheorie nach John Bowlby und Mary Ainsworth vor. Außerdem werden die dyadischen Bedingungen der Bindung, wie Bindungspersonen, Feinfühligkeit und interne Arbeitsmodelle, erläutert. Abschließend werden die verschiedenen Klassifikationen von Bindungsbeziehungen vorgestellt.
- Emotionale Entwicklung und Kompetenz: Dieses Kapitel definiert die Begriffe „Emotionen“ und „Emotionale Kompetenz“ und beschreibt den Entwicklungsverlauf der emotionalen Entwicklung von Geburt bis zum Kindergarteneintritt. Es beleuchtet verschiedene Aspekte der emotionalen Entwicklung, wie emotionale Bewusstheit, Emotionsausdruck und Emotionsregulation.
- Auswirkungen einer sicheren Eltern-Kind- Bindung auf die emotionale Entwicklung: Dieses Kapitel untersucht die Auswirkungen einer sicheren Bindung auf die emotionale Entwicklung des Kindes. Es betrachtet dabei die Entwicklung primärer Emotionen, den sprachlichen Emotionsausdruck und die Entwicklung von Emotionsregulationsstrategien.
Schlüsselwörter
Die vorliegende Arbeit konzentriert sich auf die Eltern-Kind-Bindung, insbesondere die Mutter-Kind-Bindung, und ihre Auswirkungen auf die emotionale Entwicklung des Kindes. Die zentralen Schlüsselbegriffe sind: Bindung, Bindungstheorie, Bindungsqualität, emotionale Entwicklung, Emotionale Kompetenz, Feinfühligkeit, interne Arbeitsmodelle, Emotionsregulation und Emotionsausdruck.
Häufig gestellte Fragen
Wer begründete die Bindungstheorie?
John Bowlby gilt als Begründer der Theorie, die später von Mary Ainsworth durch das Experiment der „Fremden Situation“ erweitert wurde.
Welche vier Bindungsklassifikationen gibt es?
Man unterscheidet: sicher (B), unsicher-vermeidend (A), unsicher-ambivalent (C) und desorganisiert (D).
Was versteht man unter mütterlicher Feinfühligkeit?
Die Fähigkeit, Signale des Kindes wahrzunehmen, richtig zu interpretieren und prompt sowie angemessen darauf zu reagieren.
Wie beeinflusst eine sichere Bindung die Emotionsregulation?
Sicher gebundene Kinder entwickeln bessere Strategien, um mit Stress und negativen Emotionen umzugehen, da sie auf die Unterstützung ihrer Bezugsperson vertrauen.
Was sind internale Arbeitsmodelle?
Es sind mentale Repräsentationen, die das Kind auf Basis seiner Bindungserfahrungen entwickelt und die als Blaupause für spätere Beziehungen dienen.
- Quote paper
- Melanie Furthmair (Author), 2017, Die Auswirkungen einer sicheren Mutter-Kind-Bindung auf die emotionale Entwicklung des Kindes von Geburt bis zum Alter des Kindergarteneintritts, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/475194