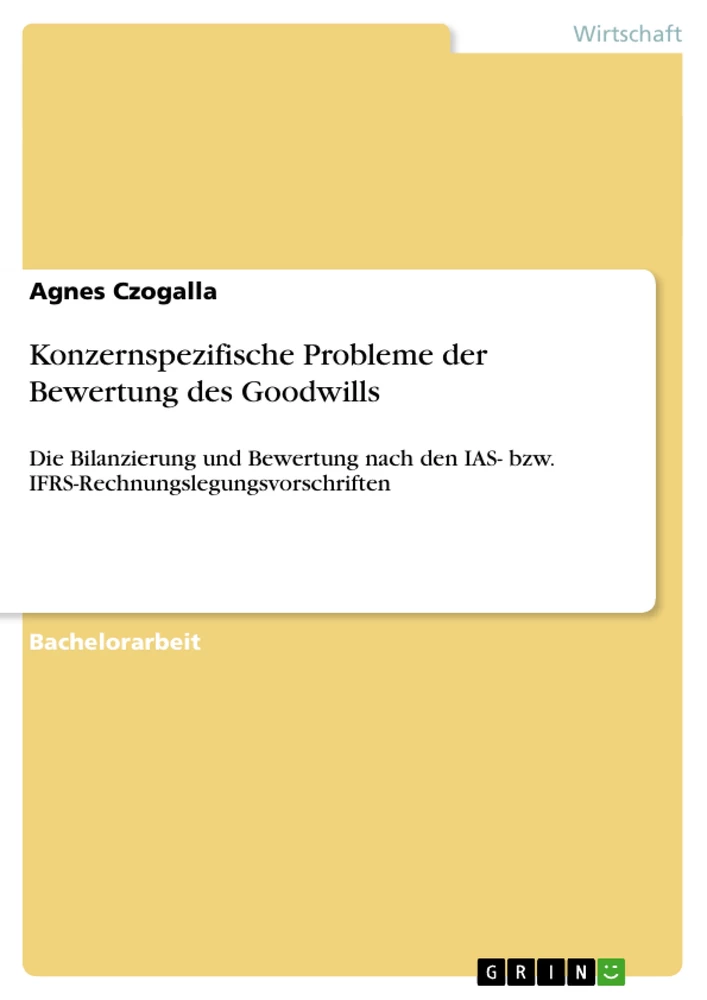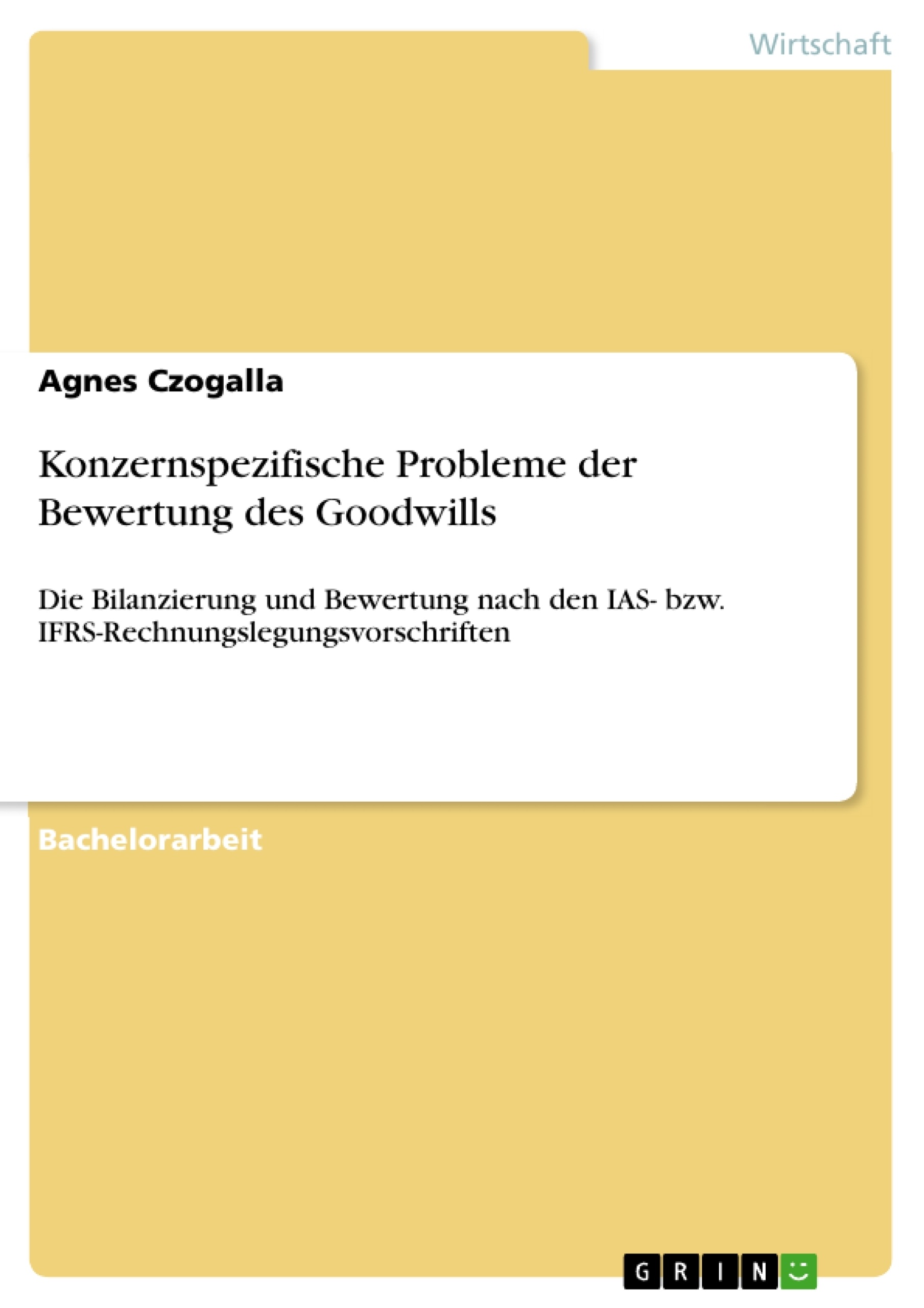Seit dem 1.1.2005 (in Ausnahmefällen ab dem 1.1.2007) müssen alle kapitalmarktorientierten Unternehmen ihre Konzernabschlüsse nach den IAS- bzw. IFRS-Rechnungslegungsvorschriften erstellen. Die internationale Rechnungslegung befindet sich in einer umfangreichen Reformphase, in der das IASB und das FASB eine Konvergenz der internationalen Rechnungslegungsvorschriften anstreben.
Einen Reformschwerpunkt stellt das Projekt Business Combinations dar, das im Juli 2001 ins Leben gerufen wurde, um die US-GAAP- und IAS-Rechnungslegungs-vorschriften in Bezug auf Konzernabschlüsse zu konkretisieren und anzugleichen. IFRS 3 Business Combinations und die überarbeiteten Versionen des IAS 36 Impairment of Assets und IAS 38 Intangible Assets wurden im März 2004 eingeführt und damit die erste Projektphase beendet. Die Veröffentlichung der Standards hat grundlegende Änderungen zur Folge. Beispielsweise dürfen Unternehmenserwerbe nur noch nach der Erwerbsmethode (Purchase Method) dargestellt werden. Die Bilanzierung und Bewertung von immateriellen Vermögenswerten wurde konkretisiert. Darüber hinaus darf Goodwill nicht mehr planmäßig abgeschrieben werden, sondern muss einem jährlichen Werthaltigkeitstest (Impairment Test) unterzogen werden.
Die Abkehr von der planmäßigen Abschreibung des Goodwills hat fundamentale Folgen für nationale und internationale Konzerne, denn die Bilanzposition Goodwill stellt eine Schlüsselgröße im Konzernabschluss dar. So betrug im Jahr 2003 der Goodwill der DAX-30-Unternehmen durchschnittlich 40% des bilanziell erfassten Eigenkapitals. Auch außenstehende Gesellschafter nehmen einen wichtigen Platz in der Konzernrechnungslegung ein. Im Jahr 2001 besaßen konzernfremde Gesellschafter in einzelnen DAX-30-Unternehmen über ein Drittel des Konzern-eigenkapitals. Die zweckadäquate Bewertung des Goodwills bei Vorhandensein von Minderheitenanteilen wird immer bedeutender.
In dieser Arbeit soll die Frage geklärt werden, wie sich die neue Bewertung des Goodwills nach IFRS 3 in Verbindung mit IAS 36 auswirkt, wenn der Goodwill aus einem Unternehmenserwerb mit einer Beteiligung von weniger als 100% stammt und Minderheiten an dem erworbenen Unternehmen beteiligt sind.
Inhaltsverzeichnis
- Einführung
- Problemstellung
- Zielsetzung und Aufbau
- Goodwill
- Definition und Bestandteile des Goodwills
- Verteilung des Goodwills auf zahlungsmittelgenerierende Einheiten
- Werthaltigkeitstest für goodwill-tragende zahlungsmittelgenerierende Einheiten
- Grundkonzeption des Werthaltigkeitstests
- Werthaltigkeitstest unter Berücksichtigung von Minderheitenanteilen
- Relevante Parameter
- Erzielbarer Betrag der zahlungsmittelgenerierenden Einheit
- Buchwert der zahlungsmittelgenerierenden Einheit
- Beispiel: Der Werthaltigkeitstest unter Berücksichtigung von Minderheitenanteilen
- Werthaltigkeitstest bei Vorhandensein von unterschiedlichen Minderheitenanteilen in einer zahlungsmittelgenerierenden Einheit
- Darstellung der Minderheitenproblematik
- Hochrechnung des Goodwills um Minderheitenanteile
- Aufteilung des Wertminderungsbedarfs auf einen Konzern- und einen Minderheitenanteil
- Beispiel zum Werthaltigkeitstest bei Vorhandensein von unterschiedlichen Minderheitenanteilen
- Hochrechnung des Goodwills
- Aufteilung des Wertminderungsbedarfs
- Werthaltigkeitstest bei sukzessivem Beteiligungserwerb
- Auswirkungen des sukzessiven Beteiligungserwerbs auf den Werthaltigkeitstest
- Beispiel zum Werthaltigkeitstest bei sukzessivem Beteiligungserwerb
- Kritische Betrachtung
- Kritische Würdigung der Hochrechnung des Goodwills
- Kritische Würdigung der Aufteilung des Wertminderungsbedarfs
- Werthaltigkeitstest nach Phase II
- Zusammenfassung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Bachelorarbeit untersucht die konzernpezifischen Probleme bei der Bewertung von Goodwill, insbesondere im Kontext der International Financial Reporting Standards (IFRS). Die Arbeit analysiert die Auswirkungen von Minderheitenanteilen und sukzessiven Beteiligungserwerben auf den Werthaltigkeitstest von Goodwill. Die Zielsetzung ist es, die komplexen Bewertungsmethoden unter Berücksichtigung dieser Faktoren zu erläutern und kritisch zu beleuchten.
- Bewertung von Goodwill nach IFRS
- Auswirkungen von Minderheitenanteilen auf die Goodwill-Bewertung
- Werthaltigkeitstest und Impairment Test
- Sukzessive Beteiligungserwerbe und deren Einfluss auf die Bewertung
- Kritische Analyse der Bewertungsmethoden
Zusammenfassung der Kapitel
Einführung: Die Arbeit führt in die Thematik der Goodwill-Bewertung im Kontext der IFRS-Rechnungslegung ein. Sie beschreibt die Relevanz der Thematik aufgrund der Umstellung auf IFRS und der damit verbundenen Änderungen in der Bewertung von immateriellen Vermögenswerten wie Goodwill. Der Fokus liegt auf den Herausforderungen, die sich durch Minderheitenanteile und sukzessive Beteiligungserwerbe ergeben.
Goodwill: Dieses Kapitel definiert Goodwill und seine Bestandteile. Es erläutert die Verteilung des Goodwills auf zahlungsmittelgenerierende Einheiten (ZGE) als Grundlage für den nachfolgenden Werthaltigkeitstest. Es werden die grundlegenden Prinzipien der Goodwill-Zuweisung im Konzernabschluss behandelt und die Schnittstellen zu anderen Bilanzierungspositionen aufgezeigt.
Werthaltigkeitstest für goodwill-tragende zahlungsmittelgenerierende Einheiten: Dieses Kapitel beschreibt die Grundkonzeption des Werthaltigkeitstests nach IFRS, insbesondere unter Berücksichtigung von Minderheitenanteilen. Es werden die relevanten Parameter wie erzielbarer Betrag und Buchwert der ZGE detailliert erklärt und anhand von Beispielen veranschaulicht. Die Kapitel diskutiert die Herausforderungen, die sich bei der Berücksichtigung von Minderheitenanteilen bei der Durchführung eines Impairment Tests ergeben.
Werthaltigkeitstest bei Vorhandensein von unterschiedlichen Minderheitenanteilen in einer zahlungsmittelgenerierenden Einheit: Dieses Kapitel befasst sich mit der komplexen Thematik der Goodwill-Bewertung, wenn eine ZGE unterschiedliche Minderheitenanteile aufweist. Es werden Methoden zur Hochrechnung des Goodwills und zur Aufteilung des Wertminderungsbedarfs auf Konzern- und Minderheitenanteile vorgestellt und anhand von Beispielen illustriert. Es werden verschiedene Lösungsansätze und deren Implikationen auf die Finanzberichterstattung analysiert.
Werthaltigkeitstest bei sukzessivem Beteiligungserwerb: Dieses Kapitel untersucht die Auswirkungen eines sukzessiven Beteiligungserwerbs auf den Werthaltigkeitstest. Es analysiert, wie sich die Bewertung des Goodwills im Laufe des Beteiligungserwerbs verändert und welche methodischen Herausforderungen damit verbunden sind. Es werden die Unterschiede im Vergleich zu einer einstufigen Beteiligungserwerbsstrategie beleuchtet und die methodischen Herausforderungen verdeutlicht.
Kritische Betrachtung: Dieses Kapitel widmet sich einer kritischen Würdigung der in den vorherigen Kapiteln vorgestellten Methoden zur Hochrechnung des Goodwills und der Aufteilung des Wertminderungsbedarfs. Es beleuchtet Stärken und Schwächen der einzelnen Ansätze und diskutiert die damit verbundenen Unsicherheiten und Interpretationsspielräume. Die kritische Betrachtung schließt eine Auseinandersetzung mit der praktischen Anwendbarkeit der Methoden ein.
Werthaltigkeitstest nach Phase II: Dieses Kapitel gibt einen Ausblick auf den Werthaltigkeitstest nach der ersten Phase der IFRS-Implementierung. Es zeigt mögliche zukünftige Entwicklungen und Anpassungen auf. Es antizipiert mögliche Herausforderungen und gibt einen Ausblick auf zukünftige Forschungsfragen.
Schlüsselwörter
Goodwill, IFRS, Werthaltigkeitstest, Impairment Test, Minderheitenanteile, sukzessiver Beteiligungserwerb, zahlungsmittelgenerierende Einheit (ZGE), Konzernabschluss, Bewertung immaterieller Vermögenswerte.
Häufig gestellte Fragen zur Bachelorarbeit: Goodwill-Bewertung nach IFRS
Was ist der Gegenstand dieser Bachelorarbeit?
Die Bachelorarbeit untersucht die konzerninternen Herausforderungen bei der Bewertung von Goodwill nach den International Financial Reporting Standards (IFRS). Ein besonderer Fokus liegt auf den Auswirkungen von Minderheitenanteilen und sukzessiven Beteiligungserwerben auf den Werthaltigkeitstest (Impairment Test) von Goodwill.
Welche Themen werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt die Bewertung von Goodwill nach IFRS, die Auswirkungen von Minderheitenanteilen auf die Bewertung, den Werthaltigkeitstest, sukzessive Beteiligungserwerbe und deren Einfluss, sowie eine kritische Analyse der Bewertungsmethoden. Es werden verschiedene Szenarien, inklusive der Behandlung unterschiedlicher Minderheitenanteile und sukzessiver Beteiligungsaufbauten, detailliert analysiert und anhand von Beispielen veranschaulicht.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in mehrere Kapitel: Eine Einführung mit Problemstellung und Zielsetzung, ein Kapitel zur Definition und Bestandteilen von Goodwill, Kapitel zum Werthaltigkeitstest (mit und ohne Minderheitenanteile), ein Kapitel zum Werthaltigkeitstest bei unterschiedlichen Minderheitenanteilen und sukzessiven Beteiligungserwerben, eine kritische Betrachtung der Methoden, ein Ausblick auf den Werthaltigkeitstest nach Phase II der IFRS-Implementierung und eine Zusammenfassung. Ein detailliertes Inhaltsverzeichnis ist im Dokument enthalten.
Welche Methoden werden zur Goodwill-Bewertung untersucht?
Die Arbeit untersucht die Methoden zur Bewertung von Goodwill nach IFRS, insbesondere die Verfahren zur Durchführung des Werthaltigkeitstests unter Berücksichtigung von Minderheitenanteilen und sukzessiven Beteiligungserwerben. Es werden Methoden zur Hochrechnung des Goodwills und zur Aufteilung des Wertminderungsbedarfs auf Konzern- und Minderheitenanteile detailliert erläutert.
Welche Herausforderungen werden im Zusammenhang mit Minderheitenanteilen diskutiert?
Die Arbeit beleuchtet die komplexen Herausforderungen bei der Bewertung von Goodwill, wenn eine zahlungsmittelgenerierende Einheit (ZGE) unterschiedliche Minderheitenanteile aufweist. Es wird gezeigt, wie die Hochrechnung des Goodwills und die Aufteilung des Wertminderungsbedarfs auf Konzern- und Minderheitenanteile erfolgen kann und welche methodischen Schwierigkeiten dabei auftreten können.
Wie werden sukzessive Beteiligungserwerbe berücksichtigt?
Die Arbeit analysiert, wie sich ein sukzessiver Beteiligungserwerb auf den Werthaltigkeitstest auswirkt und wie sich die Bewertung des Goodwills im Laufe des Beteiligungserwerbs verändert. Die Unterschiede im Vergleich zu einem einstufigen Beteiligungserwerb werden herausgestellt.
Wie kritisch wird die Arbeit bewertet?
Die Arbeit enthält eine kritische Würdigung der vorgestellten Methoden zur Hochrechnung des Goodwills und der Aufteilung des Wertminderungsbedarfs. Stärken und Schwächen der Ansätze werden beleuchtet, Unsicherheiten und Interpretationsspielräume diskutiert und die praktische Anwendbarkeit der Methoden bewertet.
Was ist das Ziel der Arbeit?
Die Arbeit zielt darauf ab, die komplexen Bewertungsmethoden von Goodwill unter Berücksichtigung von Minderheitenanteilen und sukzessiven Beteiligungserwerben zu erläutern und kritisch zu beleuchten. Sie soll ein tiefergehendes Verständnis der damit verbundenen Herausforderungen vermitteln.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt der Arbeit?
Goodwill, IFRS, Werthaltigkeitstest, Impairment Test, Minderheitenanteile, sukzessiver Beteiligungserwerb, zahlungsmittelgenerierende Einheit (ZGE), Konzernabschluss, Bewertung immaterieller Vermögenswerte.
Gibt es Beispiele in der Arbeit?
Ja, die Arbeit enthält mehrere Beispiele zur Veranschaulichung der komplexen Bewertungsmethoden, insbesondere im Zusammenhang mit Minderheitenanteilen und sukzessiven Beteiligungserwerben.
- Quote paper
- Agnes Czogalla (Author), 2005, Konzernspezifische Probleme der Bewertung des Goodwills, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/47837