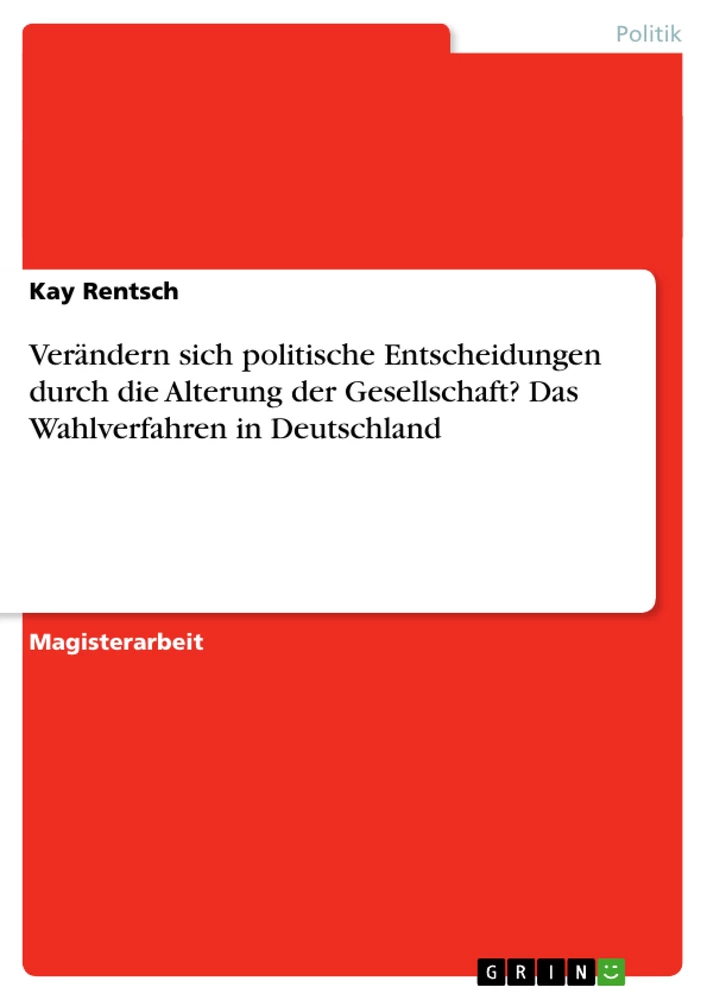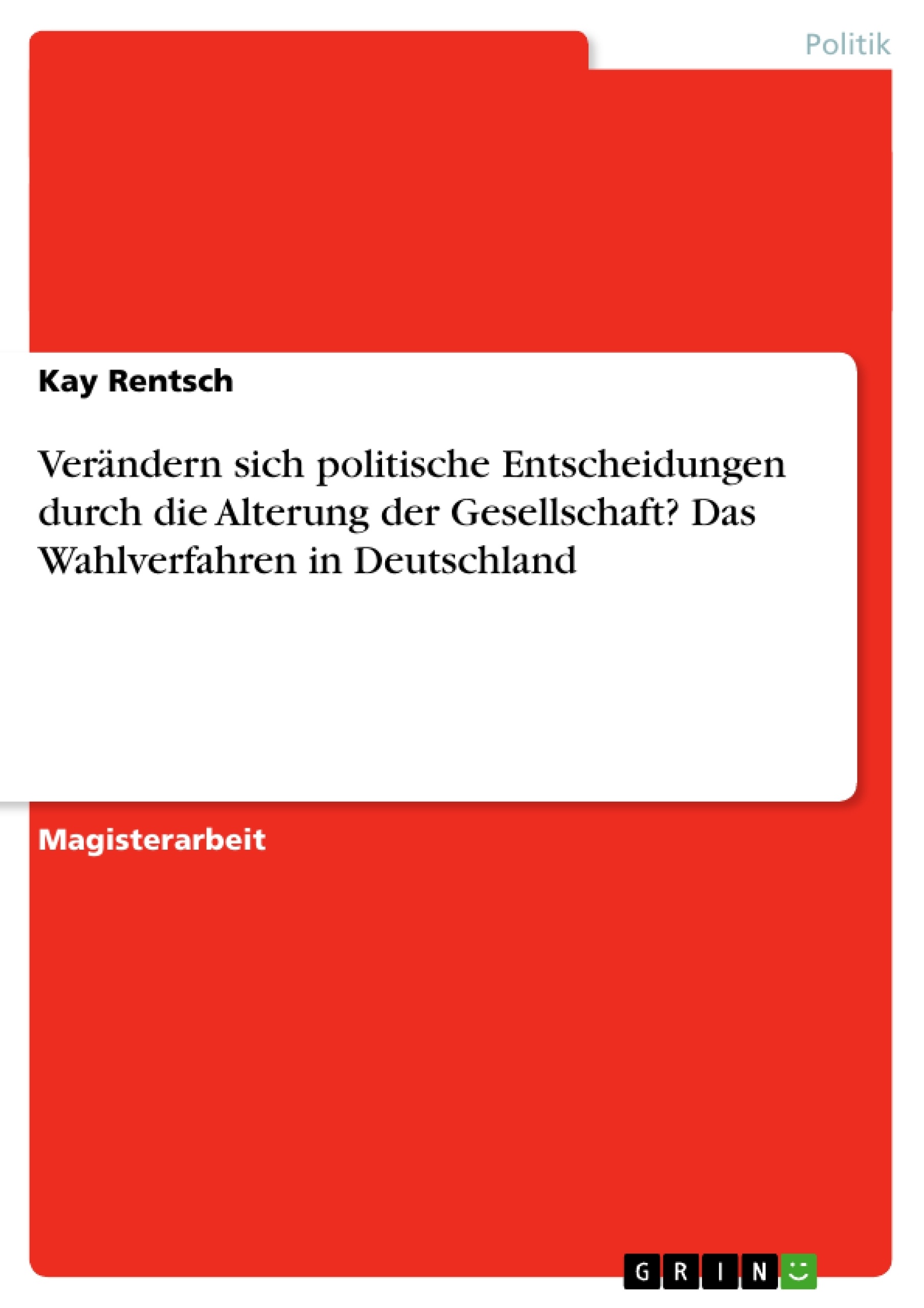Die Alterspyramide steht Kopf. Bildete früher eine breite Geburtenfront die
Basis der sich nach oben altersmäßig ausdünnenden Pyramide, so ist dieses
Fundament heute merklich zusammengeschrumpft. Breit hingegen läuft die
ehemalige Pyramide nun nach oben zu – die Bevölkerung wird immer älter.
Und nicht nur das: Gerade die über 60-Jährigen strahlen momentan in neuem
Glanz. In der Wirtschaft wird immer mehr von der Parole Abstand genommen,
die Führungsebenen seien gnadenlos zu verjüngen, weil sonst gar nichts mehr
vorangehe.1 Der Schuhhersteller Salamander soll von einem 65-Jährigen aus
der Krise geführt werden, Hewlett-Packard Deutschland reaktivierte den 63-
jährigen Computerspezialisten Jörg Menno Harms als Topmanager. Wissen
und Erfahrung werden teilweise wieder höher geschätzt als Jugend. Weniger
geschätzt wird die Altersentwicklung dagegen in der Politik. Das Phänomen
der zunehmenden Alterung der Bevölkerung stellt die entwickelten
Industrienationen der Welt vor enorme Herausforderungen. Viele Bereiche der
aktuellen Politik werden durch die demographische Entwicklung beeinflusst:
Insbesondere die Diskussion um den Umbau beziehungsweise Abbau des
Sozialstaates sei hier genannt. Verschärfend kommt hinzu, dass die
demographische Entwicklung ein langfristiger Prozess ist, der sich nicht durch
kurzfristig angelegte Gegenmaßnahmen aufhalten lässt.
Auch in der öffentlichen Diskussion nehmen die älteren Mitbürger einen
breiten Raum ein. Zum Thema „Rente“ liest man beinahe täglich etwas in den
Zeitungen, Begriffe wie „Generationengerechtigkeit“ sowie
„Gesellschaftsvertrag“ sind allgegenwärtig. Man weiß vieles von den Älteren:
Was sie kaufen, wie sie leben, wie viel Geld sie zur Verfügung haben. Jedoch,
wie wählt diese immer größer werdende Gruppe unserer Gesellschaft? Eine
gängige Vorstellung des politischen Alterns brachte Winston Churchill einmal
treffend auf den Punkt: „Wer unter 35 kein Sozialist ist, hat kein Herz, wer es
über 35 noch ist, hat keinen Verstand.“ Dahinter steht die Annahme, dass
Menschen mit zunehmendem Alter automatisch konservativer werden
Inhaltsverzeichnis
- I. Einleitung
- II. Wertewandel
- II.1. Werte und Wertewandel
- II.1.1. Der Wertbegriff
- II.2. Erklärungsmodelle zum Wertewandel
- II.3. Die Postmaterialismus Theorie nach Inglehart
- II.4. Lebenszyklus Theorie nach Klages
- II.1. Werte und Wertewandel
- III. Wählerverhalten
- III.1. Der sozialstrukturelle Ansatz
- III.1.1. Das Mikrosoziologische Erklärungsmodell
- III.1.2. Der Makrosoziologische Erklärungsansatz
- III.2. Der Sozialpsychologische Ansatz (Ann Arbor Modell)
- III.3. Der Rational-Choice Ansatz
- III.1. Der sozialstrukturelle Ansatz
- IV. Ausgangslage
- IV.1. Demographische Lage
- IV.1.1. Ursachen des Alterungsprozesses
- IV.1.1.1. Fertilität
- IV.1.1.2. Mortalität
- IV.1.1.3. Migration
- IV.1.1. Ursachen des Alterungsprozesses
- IV.2. Der Alterungsprozess im internationalen Vergleich
- IV.3. Probleme alternder Gesellschaften
- IV.1. Demographische Lage
- V. Das Verhältnis zwischen den Generationen
- V.1. Generationenbeziehungen
- V.2. Politische Einstellungen
- VI. Politische Partizipation der über 60-Jährigen
- VI.1. Wahlberechtigte und Wahlbeteiligung
- VI.2. Altersstruktur der Parteien/Parteimitglieder
- VII. Das Wahlverhalten der Generationen auf Parlamentsebenen
- VII.1. Datensätze und Forschungsdesign
- VII.2. Untersuchungsgruppe
- VII.3. Bundesebene
- VII.3.1. Bundestagswahl 1990
- VII.3.2. Bundestagswahl 1994
- VII.3.3. Bundestagswahl 1998
- VII.3.4. Bundestagswahl 2002
- VII.4. Zusammenfassung Bundesebene
- VII.5. Landesebene
- VII.5.1. Landtagswahl Baden-Württemberg 2001
- VII.5.2. Landtagswahl Sachsen-Anhalt 2002
- VII.5.3. Bürgerschaftswahl Hamburg 2001
- VII.6. Zusammenfassung Landesebene
- VIII. Unterschiede im Wahlverhalten der Generationen
- VIII.1. Ändert sich das Stimmgewicht?
- VIII.2. Verändern sich politische Entscheidungen mehr auf der einen oder der anderen Parlamentsebene?
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht, ob sich politische Entscheidungen in Deutschland durch die fortschreitende Alterung der Gesellschaft verändern. Dabei wird das Wahlverhalten als zentrale Einflussgröße betrachtet. Die Arbeit greift auf verschiedene theoretische Modelle des Wertewandels und des Wählerverhaltens zurück, um die demographischen Veränderungen in Deutschland zu beleuchten und deren Auswirkungen auf den politischen Prozess zu analysieren.
- Der Einfluss des demographischen Wandels auf politische Entscheidungen
- Das Wahlverhalten der älteren Generation
- Die Rolle von Wertewandel und Wählerverhalten in der Politik
- Das Verhältnis der Generationen im politischen Kontext
- Die Bedeutung der politischen Partizipation älterer Menschen
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt die Forschungsfrage nach dem Einfluss der demographischen Alterung auf politische Entscheidungen in Deutschland vor. Kapitel II behandelt den Wertewandel und verschiedene Erklärungsmodelle, die den Wandel von Werten in Gesellschaften erklären. Kapitel III beleuchtet unterschiedliche Ansätze zum Wählerverhalten und deren Relevanz für die Analyse politischer Entscheidungen. Kapitel IV fokussiert auf die demographische Entwicklung in Deutschland, inklusive der Ursachen des Alterungsprozesses und einem internationalen Vergleich. Kapitel V beschäftigt sich mit dem Verhältnis der Generationen in Deutschland, insbesondere mit deren politischen Einstellungen. Kapitel VI untersucht die politische Partizipation der über 60-Jährigen, einschliesslich Wahlbeteiligung und Altersstruktur in den Parteien. Kapitel VII analysiert das Wahlverhalten der Generationen auf Bundes- und Landesebene anhand verschiedener Wahlanalysen.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit zentralen Begriffen wie demographischer Wandel, Alterungsprozess, Wertewandel, Wahlverhalten, politische Partizipation, Generationenbeziehungen und politische Entscheidungen. Die Forschungsarbeit untersucht den Einfluss der demographischen Entwicklung auf den politischen Prozess in Deutschland, insbesondere auf die Partizipation und das Wahlverhalten der älteren Generation. Die Analyse greift dabei auf verschiedene theoretische Modelle des Wertewandels und des Wählerverhaltens zurück, um die demographischen Veränderungen in Deutschland zu beleuchten und deren Auswirkungen auf den politischen Prozess zu analysieren.
- Arbeit zitieren
- Kay Rentsch (Autor:in), 2005, Verändern sich politische Entscheidungen durch die Alterung der Gesellschaft? Das Wahlverfahren in Deutschland, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/48815