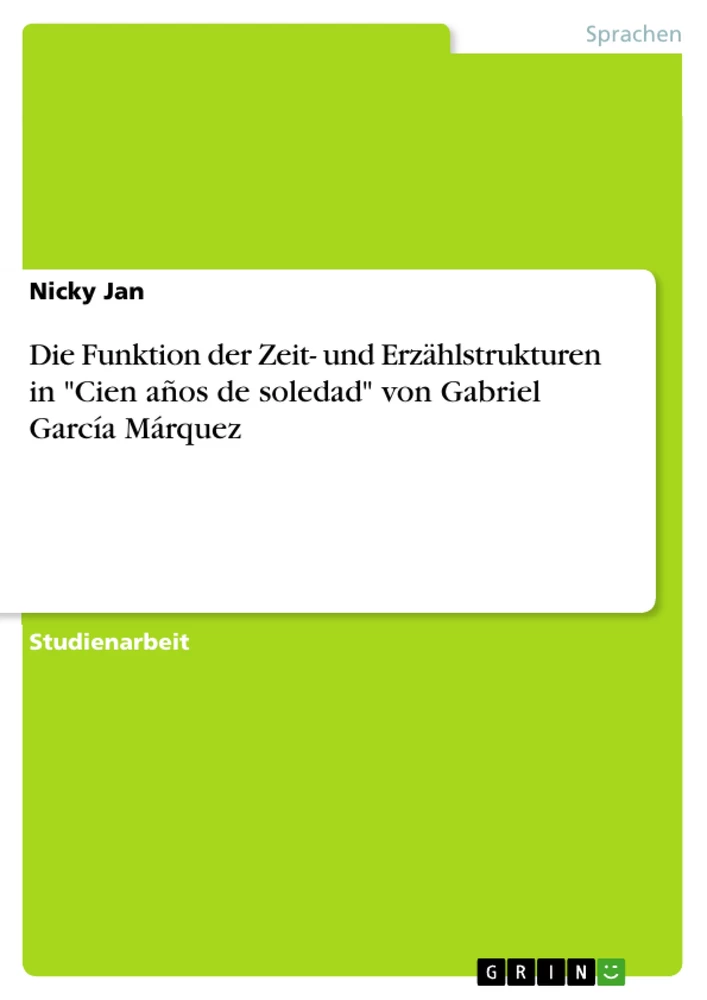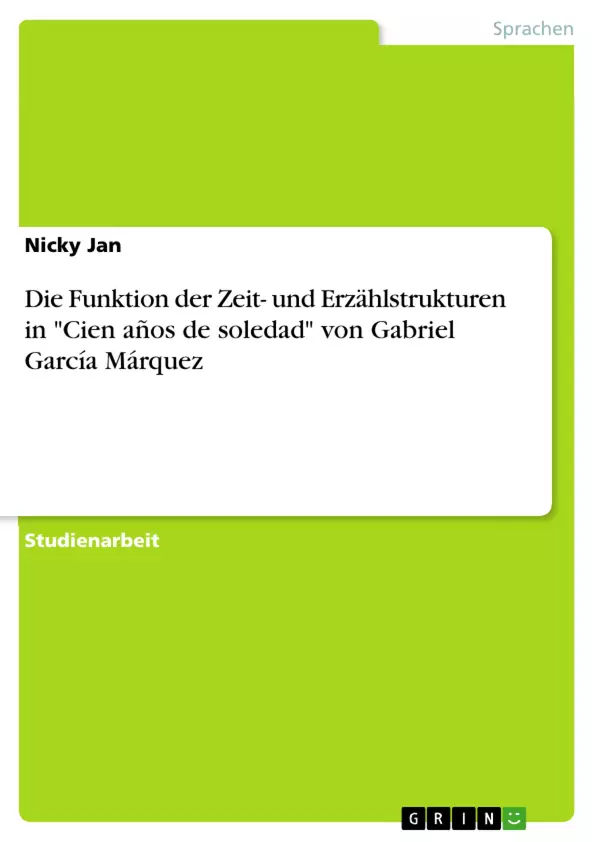In der vorliegenden Hausarbeit wird die Funktion der Erzähl- und Zeitstrukturen in „Cien años de soledad“ von Gabriel García Márquez untersucht und analysiert.
Der erste Satz des Romans zeigt bereits die Komplexität der literarischen Zeitmodellierung: „Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía había de recordar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo.” (S. 9). Allein in diesem Satz verwendet und verschmelzt der Autor bewusst Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft, sodass der Leser bereits zu Beginn in den Bann seines Romans gezogen wird. Der Leser wird von einem Ereignis ins Nächste geführt und verliert hierbei vollkommen das Gefühl für die Zeit, da alle Geschehnisse zu einer Gleichzeitigkeit zu verschmelzen scheinen. Daher spielt auch der Erzähler eine bedeutende Rolle, da lediglich dieser außerhalb der Zeit steht, somit eine gewisse Distanz wahrt und die Ereignisse angemessen zu vermitteln weiß.
Im Folgenden wird daher zunächst ein inhaltlicher Überblick über die komplexe Geschichte der Buendías gegeben, um daraufhin den Versuch der Unterteilung des Romans zu unternehmen. Hierbei wird auch die Bedeutung des Erzählers für die gesamte Geschichte erläutert. Vor diesem Hintergrund wird nun die doppelte Funktion der Zeitstruktur in „Cien años de soledad“ analysiert, und zwar mithilfe der Unterscheidung von mythischer und historischer Zeit und unter Berücksichtigung der strukturalistischen Erzähltheorie nach Gerard Genette, dabei wird besonders auf die Erzählordnung und –dauer eingegangen. Zum Schluss soll anhand der vorangegangenen Themen die Frage beantwortet werden, welche Erzähl- und insbesondere welche Zeitstrukturen zu erkennen sind und welche Funktion sie im gesamten Werk einnehmen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Inhaltlicher Überblick
- Magischer Realismus
- Erzählstrukturen
- Unterteilung des Romans in ciclos
- Die Funktion des Erzählers
- Die doppelte Funktion der Zeitstruktur im Roman
- Die historische und mythische Zeit
- Die strukturalistische Erzähltheorie nach Gérard Genette
- Die Erzähldauer
- Die Erzählordnung
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Hausarbeit analysiert die Funktion der Erzähl- und Zeitstrukturen in „Cien años de soledad“ von Gabriel García Márquez. Die Arbeit beleuchtet, wie der Autor die Zeit im Roman modelliert und welche Auswirkungen diese Modellierung auf die erzählte Geschichte hat. Insbesondere wird die doppelte Funktion der Zeitstruktur untersucht, indem die historische und mythische Zeit betrachtet und die strukturalistische Erzähltheorie von Gérard Genette herangezogen wird.
- Die komplexe Zeitmodellierung in „Cien años de soledad“
- Die Rolle des Erzählers in der Vermittlung von Zeit und Ereignissen
- Die Verschmelzung von Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft im Roman
- Die Bedeutung des Magischen Realismus für die Zeitstruktur
- Die Analyse der Erzähldauer und Erzählordnung im Roman
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt das Thema der Hausarbeit vor und zeigt anhand des ersten Satzes des Romans die Komplexität der Zeitmodellierung auf. Der zweite Abschnitt gibt einen inhaltlichen Überblick über die Geschichte der Familie Buendía und des Dorfes Macondo. Dabei wird auch auf die Bedeutung des Magischen Realismus in García Márquez’ Werk eingegangen. Der dritte Teil der Arbeit befasst sich mit den Erzählstrukturen des Romans und analysiert die Unterteilung in „ciclos“ und die Funktion des Erzählers. Der vierte Abschnitt untersucht die doppelte Funktion der Zeitstruktur im Roman, indem die historische und mythische Zeit sowie die strukturalistische Erzähltheorie von Gérard Genette betrachtet werden. Die Analyse der Erzähldauer und Erzählordnung steht im Fokus. Abschließend soll die Frage beantwortet werden, welche Erzähl- und insbesondere welche Zeitstrukturen im Werk erkennbar sind und welche Funktion sie einnehmen.
Schlüsselwörter
Die Arbeit beschäftigt sich mit den Themen Zeit, Erzählung, Magischer Realismus, "Cien años de soledad", Gabriel García Márquez, Familie Buendía, Macondo, Gérard Genette, Erzähldauer, Erzählordnung, historische Zeit, mythische Zeit, strukturalistische Erzähltheorie.
Häufig gestellte Fragen
Wie wird die Zeit in "Cien años de soledad" modelliert?
García Márquez verschmilzt Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft, wodurch eine Form der Gleichzeitigkeit entsteht, die den Leser das Zeitgefühl verlieren lässt.
Was ist der Unterschied zwischen mythischer und historischer Zeit?
Die historische Zeit folgt linearen Ereignissen, während die mythische Zeit zyklisch ist und sich in den Schicksalen der Familie Buendía ständig wiederholt.
Welche Rolle spielt der Erzähler im Roman?
Der Erzähler steht außerhalb der Zeit und bewahrt eine Distanz, die es ihm ermöglicht, die komplexen und magischen Ereignisse angemessen zu vermitteln.
Wie wird Gérard Genettes Erzähltheorie in der Arbeit angewendet?
Die Arbeit nutzt Genettes Konzepte der Erzählordnung und Erzähldauer, um die komplexe Struktur des Romans wissenschaftlich zu analysieren.
Was bedeutet "Magischer Realismus" für die Zeitstruktur?
Er erlaubt die Integration übernatürlicher Elemente in den Alltag, was die Grenzen zwischen Realität und Mythos sowie zwischen verschiedenen Zeitebenen aufhebt.
- Quote paper
- Nicky Jan (Author), 2016, Die Funktion der Zeit- und Erzählstrukturen in "Cien años de soledad" von Gabriel García Márquez, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/488866