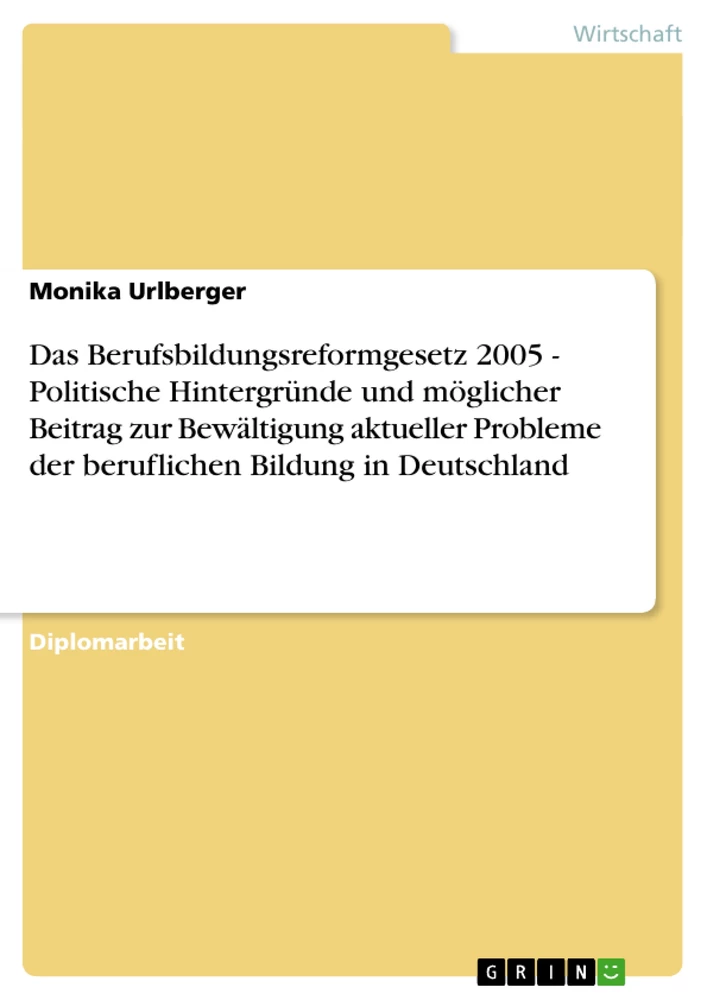Das 1969 in Kraft getretene Berufsbildungsgesetz (BBiG) stellt die rechtliche Grundlage beruflicher Bildung in Deutschland dar. Angesichts der derzeit schwierigen Lage auf dem Arbeitsmarkt in Deutschland mit hohen Arbeitslosenzahlen, einer seit Mitte der 90er Jahre zurückgehenden Zahl an neu geschlossenen Ausbildungsverträgen und einer mangelnden Ausbildungsbereitschaft der Betriebe wurden in den letzten Jahren die Rufe nach neuen Konzepten zur Entspannung der Situation immer lauter. Dazu gehören auch die berufliche Bildung, insbesondere die Ausbildung betreffende Konzepte und Reformen. Gewerkschaften stellten im Vorjahr erneut ihre altbekannten Forderungen nach einer gesetzlich geregelten Abgabe-Umlagefinanzierung durch die Betriebe während Arbeitgeberverbände verstärkt die Einführung verkürzter oder gestufter Ausbildungsgänge als Qualifizierungschance für leistungsschwächere Jugendliche forderten.
Nachdem seit Inkrafttreten des BBiG im Jahre 1969 mehrere Reformanläufe unternommen wurden, gelang es nun der rot-grünen Bundesregierung in Kooperation mit dem unionsgeführten Bundesrat, einen Kompromiss in Form des Berufsbildungsreformgesetzes (BerBiRefG) umzusetzen. Das neue BBiG trat ohne große Öffentlichkeitswirkung zum 1. April 2005 in Kraft. Auch wenn einige Gesetzesänderungen bereits kritisiert werden sind die Erwartungen, durch das Gesetz einen Beitrag zur Weiterentwicklung und Modernisierung des deutschen Berufsbildungssystems zu leisten, hoch.
Im Mittelpunkt dieses Werks steht neben einer Darstellung des Rechtsrahmens der beruflichen Bildung in Deutschland eine kritische Würdigung der Gesetzesänderungen aus berufspädagogischer Sicht.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Problemstellung, themenbezogene Definitionen und Untersuchungsplan
- 1.1 Hinführung zur Thematik und Begriffsklärungen
- 1.2 Untersuchungsplan
- 1.2.1 Grundlagen der Dokumentenanalyse
- 1.2.2 Untersuchungsvorgehen
- 1.2.3 Kriterien zur berufspädagogischen Würdigung der Gesetzesmaßnahmen
- 2 Der Rechtsrahmen der beruflichen Bildung in Deutschland
- 2.1 Das Berufsbildungsgesetz von 1969
- 2.1.1 Ursachen der Notwendigkeit einer rechtlichen Neuordnung der beruflichen Bildung in Deutschland vor 1969
- 2.1.2 Rechtliche Situation der Berufsbildung in Deutschland vor 1969
- 2.1.3 Gesetzgebungsprozess
- 2.1.4 Geltungs- und Regelungsbereich
- 2.2 Reformansätze von 1970 bis heute
- 2.2.1 Das Ausbildungsplatzförderungsgesetz von 1976
- 2.2.2 Das Berufsbildungsförderungsgesetz von 1981
- 2.2.3 Anpassungen des Berufsbildungsgesetzes von 1982 bis 1998
- 2.2.4 Reformbemühungen von 1998 bis heute
- 2.2.5 Die Entstehung des Berufsbildungsreformgesetzes 2005
- 3 Geplante Gesetzesänderungen, Stellungnahmen der an der Berufsbildungspolitik beteiligten politischen Parteien und Interessengruppen, endgültige Gesetzesfassung und berufspädagogische Würdigung
- 3.1 Zulassung vollzeitschulischer Ausbildungsgänge zur Kammerprüfung
- 3.2 Gesetzliche Verankerung der Stufenausbildung
- 3.3 Veränderungen beim Bundesinstitut für Berufsbildung
- 3.4 Reform des Prüfungswesens
- 3.4.1 Modell der gestreckten Abschlussprüfung
- 3.4.2 Stellungnahme Dritter zur Bewertung von Prüfungsleistungen
- 3.4.3 Zulassung zur Abschlussprüfung in besonderen Fällen
- 3.4.4 Anrechnung von Zusatzqualifikationen
- 3.4.5 Neuausrichtung der Prüfungsgegenstands zur beruflichen Handlungsfähigkeit
- 3.4.6 Delegation von Aufgaben bei der Bewertung von Abschlussprüfungen
- 3.5 Internationalisierung der Berufsausbildung
- 3.6 Stärkung der Verbundausbildung
- 3.7 Schaffung regionaler Berufsbildungskonferenzen
- 3.8 Verbesserung der Lernortkooperation
- 3.9 Stimmrechte der Lehrerinnen und Lehrer in den Berufsbildungsausschüssen
- 3.10 Weitere Neuerungen im Berufsbildungsgesetz
- 3.10.1 Verlängerung der Probezeit
- 3.10.2 Abschlusszeugnis
- 3.10.3 Erweiterung der Ermächtigungsgrundlage für Erprobungsverordnungen
- 3.10.4 Statistische Grundlagen
- 3.10.5 Qualitätssicherung der beruflichen Bildung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht das Berufsbildungsreformgesetz von 2005. Ziel ist es, die politischen Hintergründe der Reform zu beleuchten und ihren potenziellen Beitrag zur Lösung aktueller Probleme in der deutschen beruflichen Bildung zu analysieren.
- Politische Prozesse bei der Gesetzesgebung
- Rechtlicher Rahmen der beruflichen Bildung in Deutschland
- Berufspädagogische Bewertung der Gesetzesänderungen
- Reformansätze und ihre Auswirkungen
- Interessen verschiedener Akteure (Parteien, Verbände)
Zusammenfassung der Kapitel
1 Problemstellung, themenbezogene Definitionen und Untersuchungsplan: Dieses Kapitel führt in die Thematik ein, klärt wichtige Begriffe und beschreibt den methodischen Ansatz der Arbeit. Es legt die Grundlage für die nachfolgende Analyse des Berufsbildungsreformgesetzes von 2005 und skizziert den Untersuchungsplan, einschließlich der Methoden der Dokumentenanalyse und der Kriterien zur Bewertung der berufspädagogischen Relevanz der Gesetzesänderungen. Die Definitionen zentraler Begriffe stellen sicher, dass die Analyse auf einer gemeinsamen Basis steht und Missverständnisse vermieden werden. Der Untersuchungsplan selbst strukturiert den weiteren Verlauf der Arbeit und gibt einen Überblick über die Methodik.
2 Der Rechtsrahmen der beruflichen Bildung in Deutschland: Dieses Kapitel beleuchtet den historischen Kontext des Berufsbildungsreformgesetzes von 2005. Es analysiert das Berufsbildungsgesetz von 1969, seine Entstehungsgeschichte und seinen Einfluss auf die berufliche Bildung. Darüber hinaus werden frühere Reformversuche und ihre Erfolge und Misserfolge umfassend dargestellt. Der Fokus liegt auf der Entwicklung des rechtlichen Rahmens und den damit verbundenen Herausforderungen. Das Kapitel zeigt auf, wie sich die berufliche Bildung im Laufe der Zeit verändert hat und welche Faktoren zu den Reformen geführt haben. Es bereitet den Leser auf das Verständnis der neuen Gesetzgebung vor, indem es den bisherigen rechtlichen Kontext detailliert beschreibt.
3 Geplante Gesetzesänderungen, Stellungnahmen der an der Berufsbildungspolitik beteiligten politischen Parteien und Interessengruppen, endgültige Gesetzesfassung und berufspädagogische Würdigung: Dieses Kapitel bildet den Kern der Arbeit. Es analysiert die einzelnen Gesetzesänderungen im Detail, indem es die jeweiligen Gesetzentwürfe der Bundesregierung, der Fraktionen von CDU/CSU und FDP, sowie die Stellungnahmen relevanter Interessengruppen (Lehrerverbände, Gewerkschaften, Arbeitgeberverbände) gegenüberstellt. Für jede einzelne Gesetzesänderung wird die endgültige Fassung dargestellt und eine berufspädagogische Würdigung vorgenommen. Die Gegenüberstellung der verschiedenen Positionen ermöglicht es, die politischen Kompromisse und die Entscheidungsfindung im Gesetzgebungsprozess zu verstehen. Die berufspädagogische Würdigung bewertet den Einfluss der jeweiligen Gesetzesänderung auf die Qualität und Effektivität der beruflichen Bildung. Das Kapitel präsentiert eine detaillierte Analyse der einzelnen Aspekte der Reform und deren Auswirkungen.
Schlüsselwörter
Berufsbildungsreformgesetz 2005, berufliche Bildung, Deutschland, Gesetzgebungsprozess, politische Parteien, Interessengruppen, Berufspädagogik, Stufenausbildung, Prüfungswesen, Lernortkooperation, Verbundausbildung, Bundesinstitut für Berufsbildung.
Häufig gestellte Fragen zum Berufsbildungsreformgesetz 2005
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit analysiert das Berufsbildungsreformgesetz von 2005 in Deutschland. Sie untersucht die politischen Hintergründe der Reform, den rechtlichen Rahmen der beruflichen Bildung und die berufspädagogische Bewertung der Gesetzesänderungen. Die Arbeit beleuchtet den Gesetzgebungsprozess, die Interessen verschiedener Akteure und die Auswirkungen der Reform.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in drei Hauptkapitel: Kapitel 1 führt in die Thematik ein, klärt Begriffe und beschreibt die Methodik. Kapitel 2 analysiert den historischen Rechtsrahmen der beruflichen Bildung in Deutschland, inklusive des Berufsbildungsgesetzes von 1969 und nachfolgender Reformen. Kapitel 3 bildet den Kern der Arbeit und analysiert detailliert die einzelnen Gesetzesänderungen des Berufsbildungsreformgesetzes 2005, einschließlich der Stellungnahmen beteiligter Parteien und Interessengruppen, sowie deren berufspädagogische Würdigung.
Welche Methoden werden in der Arbeit verwendet?
Die Arbeit verwendet die Methode der Dokumentenanalyse, um die Gesetzestexte, Stellungnahmen und politischen Prozesse zu untersuchen. Die berufspädagogische Würdigung basiert auf festgelegten Kriterien, die im ersten Kapitel erläutert werden.
Welche Themenschwerpunkte werden behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Themenschwerpunkte: Politische Prozesse bei der Gesetzesgebung, den rechtlichen Rahmen der beruflichen Bildung in Deutschland, die berufspädagogische Bewertung der Gesetzesänderungen, Reformansätze und ihre Auswirkungen sowie die Interessen verschiedener Akteure (Parteien, Verbände).
Welche Gesetzesänderungen werden im Detail analysiert?
Kapitel 3 analysiert detailliert Gesetzesänderungen wie die Zulassung vollzeitschulischer Ausbildungsgänge, die gesetzliche Verankerung der Stufenausbildung, Reformen im Prüfungswesen (z.B. gestreckte Abschlussprüfung), die Internationalisierung der Berufsausbildung, die Stärkung der Verbundausbildung, die Schaffung regionaler Berufsbildungskonferenzen und Verbesserungen der Lernortkooperation. Zusätzlich werden Änderungen zur Probezeit, zum Abschlusszeugnis und zur Qualitätssicherung behandelt.
Welche Interessengruppen werden berücksichtigt?
Die Arbeit berücksichtigt die Stellungnahmen verschiedener Interessengruppen, darunter politische Parteien (CDU/CSU, FDP etc.), Lehrerverbände, Gewerkschaften und Arbeitgeberverbände.
Wie wird die berufspädagogische Relevanz der Gesetzesänderungen bewertet?
Die berufspädagogische Würdigung bewertet den Einfluss der Gesetzesänderungen auf die Qualität und Effektivität der beruflichen Bildung. Die konkreten Bewertungskriterien werden im ersten Kapitel dargelegt.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt der Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Berufsbildungsreformgesetz 2005, berufliche Bildung, Deutschland, Gesetzgebungsprozess, politische Parteien, Interessengruppen, Berufspädagogik, Stufenausbildung, Prüfungswesen, Lernortkooperation, Verbundausbildung, Bundesinstitut für Berufsbildung.
Wo finde ich den vollständigen Inhaltsverzeichnis?
Der vollständige Inhaltsverzeichnis befindet sich zu Beginn der Arbeit und ist detailliert aufgebaut, mit Unterpunkten zu den einzelnen Kapiteln und Unterkapiteln.
Welche Zusammenfassung der Kapitel gibt es?
Die Arbeit enthält eine Zusammenfassung jedes Kapitels, welche die wichtigsten Inhalte und Ergebnisse zusammenfasst.
- Quote paper
- Monika Urlberger (Author), 2005, Das Berufsbildungsreformgesetz 2005 - Politische Hintergründe und möglicher Beitrag zur Bewältigung aktueller Probleme der beruflichen Bildung in Deutschland, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/49025