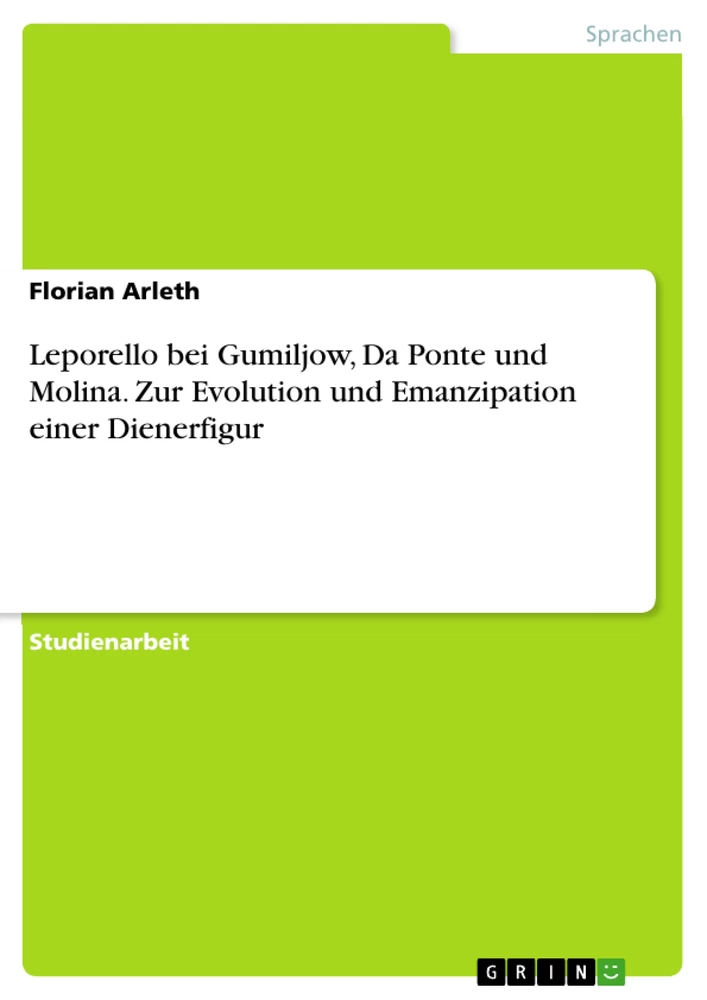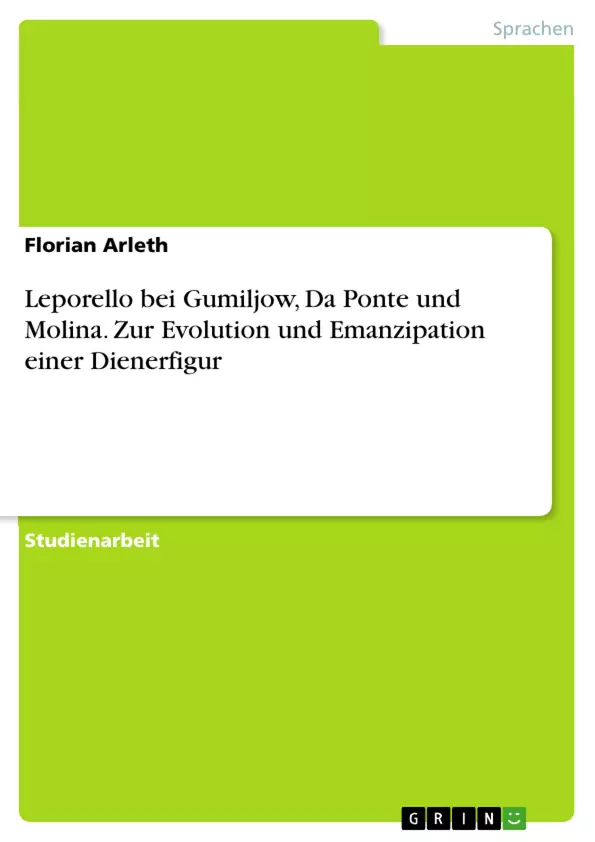Diese Hausarbeit möchte ergründen, ob sich in früheren Adaptionen des Don Juan-Stoffes Ansätze für eine Evolution der Dienerfigur finden. Hierzu werden die Werke "Don Juan in Ägypten" von Gumiljow , Molinas "Der Verführer von Sevilla und der steinerne Gast" aus dem Jahr 1613 und Lorenzo Da Pontes "Libretto zu Don Giovanni" aus dem Jahr 1787 zur Analyse herangenommen.
Der russische Dichter Nikolai Stepanowitsch Gumiljow verfasste innerhalb seiner kurzen, von Lyrik dominierten, künstlerischen Schaffensphase den Einakter "Don Juan in Ägypten". Das Drama entstand 1912 und steht auch heute noch im Schatten von Alexander Puschkins 1830 erschienener und später als Oper realisierter Adaption des Don Juan-Stoffes. Während sich Puschkin jedoch weitestgehend an der klassischen Vorlage orientierte, schuf Gumiljow mit seinem "Don Juan in Ägypten" eine Art Fortsetzung und lässt sein Drama im Ägypten des frühen 20. Jahrhunderts an den traditionellen Handlungsstrang anknüpfen.
Bei Gumiljow entsteigt Don Juan nach seinem Höllensturz einem Felsschlitz und trifft auf einen Leporello, der es zwischenzeitlich in Amerika zu einer Hochschulprofessur gebracht hat und kurz davor steht, die Tochter eines amerikanischen Millionärs zu heiraten. Damit bietet Don Juan in Ägypten nicht nur auf Handlungsebene einen harten Kontrast zu den gängigen Adaptionen des Don Juan-Stoffes, sondern schafft auch inhaltlich einige Dissonanzen, da das Verhältnis zwischen Don Juan und der Dienerfigur mindestens hinterfragt wird. Denn Don Juan trifft bei Gumiljow einen nun gesellschaftlich angesehenen Diener an, der zudem als Tourist auftritt, also als freier Mensch, und keinesfalls, um Dienste zu verrichten.
Molinas Diener trägt den Namen Catalinon und folgt seinem Herren durch die üblichen Abenteuer bis zum finalen Abendessen mit der rachsüchtigen Steinstatue. Lorenzo da Ponte führtals Dienerfigur den Leporello ein, der in einem ähnlichen Beziehungs- und Handlungsschema seinem, hier mit Don Giovanni betitelten, Herrn unterstellt ist. Durch diese Übereinstimmungen ergeben sich auch die Kriterien der nachfolgenden Textanalyse und die Strukturen der jeweiligen Hauptkapitel. Anhand relevanter Textstellen wird jeweils untersucht, wie das Selbstbild des Dieners ist, in welchem Verhältnis der Diener zu der Don Juan-Figur steht, ob sich dieses Verhältnis im Laufe der Handlung ändert, und ferner, ob es Ansätze für die später bei Gumiljows Diener vorhandene wissenschaftliche Karriere gibt.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Diener und Herr in der Tradition
- Ursprünge in der Commedia dell'arte
- Die Dienerfigur der Comedia nueva
- Die Entwicklung im Dramma Giocoso
- Catalinon bei Molina
- Der Vater-Sohn-Vergleich
- Die moralische Instanz
- Die Ohrfeige
- Die letzten gemeinsamen Abendessen
- Leporello bei Da Ponte
- Gehorsam wider Willen
- Die Geburt eines Wissenschaftlers
- Identitätsbetrug und körperliche Nötigung
- Von Mundraub und Strafe
- Leporello bei Gumiljow
- Ein unerwartetes Wiedersehen
- Der emanzipierte Diener
- Ein vollendeter Wissenschaftler
- Don Juans Gönner
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit beschäftigt sich mit der Evolution der Dienerfigur im Kontext des Don Juan-Stoffes und untersucht, ob in früheren Adaptionen Ansätze für eine Emanzipation der Dienerfigur zu finden sind.
- Die Entwicklung der Dienerfigur von der Commedia dell'arte bis zu Gumiljows Don Juan in Ägypten
- Die Beziehung zwischen Diener und Herr und ihre Veränderung im Laufe der Handlung
- Die Rolle des Dieners als moralische Instanz und seine Verbindung zu wissenschaftlicher Karriere
- Die Frage der Emanzipation des Dieners und seiner Abhängigkeit vom Herrn
- Die Analyse des Selbstbildes des Dieners und seine Wahrnehmung in den unterschiedlichen Adaptionen
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit beginnt mit einer Untersuchung der Ursprünge der Dienerfigur in der Commedia dell'arte, der Comedia nueva und dem Dramma Giocoso. Anschließend wird die Figur des Catalinon in Molinas Der Verführer von Sevilla und der steinerne Gast analysiert, wobei der Fokus auf dessen Verhältnis zu Don Juan, dessen moralische Rolle und seine Entwicklung im Laufe der Handlung liegt. Im nächsten Kapitel wird die Figur des Leporello in Da Pontes Libretto zu Don Giovanni beleuchtet, wobei insbesondere die Themen Gehorsam, Identitätsbetrug und die Anfänge einer wissenschaftlichen Karriere betrachtet werden. Schließlich wird Leporello bei Gumiljow in Don Juan in Ägypten untersucht, um die Frage der Emanzipation des Dieners zu beantworten.
Schlüsselwörter
Die Arbeit beschäftigt sich mit der Dienerfigur im Don Juan-Stoff, insbesondere mit den Figuren Catalinon und Leporello. Wichtige Themen sind die Evolution der Dienerfigur, ihr Verhältnis zum Herrn, ihre moralische Rolle, die Anfänge einer wissenschaftlichen Karriere und die Frage der Emanzipation. Die Arbeit analysiert klassische Werke wie Der Verführer von Sevilla und der steinerne Gast von Molina und Don Giovanni von Da Ponte, um die Entwicklung des Dieners im Kontext des Don Juan-Stoffes zu verstehen.
Häufig gestellte Fragen
Wie entwickelt sich die Dienerfigur in den Don Juan-Adaptionen?
Die Arbeit zeigt die Evolution vom bloßen Gehilfen (Catalinon) über den kritischen Begleiter (Leporello bei Da Ponte) bis hin zum emanzipierten Wissenschaftler bei Gumiljow.
Was ist das Besondere an Leporello in Gumiljows Werk?
Bei Gumiljow ist Leporello kein Diener mehr, sondern ein Universitätsprofessor, der gesellschaftlich angesehen ist und Don Juan als freier Mensch gegenübertritt.
Welche Rolle spielt Catalinon bei Molina?
Catalinon fungiert oft als moralische Instanz, die seinen Herrn Don Juan vor den göttlichen Konsequenzen seines Handelns warnt.
Gibt es bei Da Ponte schon Anzeichen für eine Emanzipation?
Ja, Leporellos „Gehorsam wider Willen“ und seine Katalog-Arie deuten auf eine intellektuelle Distanzierung und eine eigene Identität jenseits des Dienens hin.
Was sind die Ursprünge der Dienerfigur?
Die Arbeit beleuchtet die Wurzeln in der Commedia dell'arte und die Weiterentwicklung in der spanischen Comedia nueva.
- Quote paper
- Florian Arleth (Author), 2019, Leporello bei Gumiljow, Da Ponte und Molina. Zur Evolution und Emanzipation einer Dienerfigur, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/490592