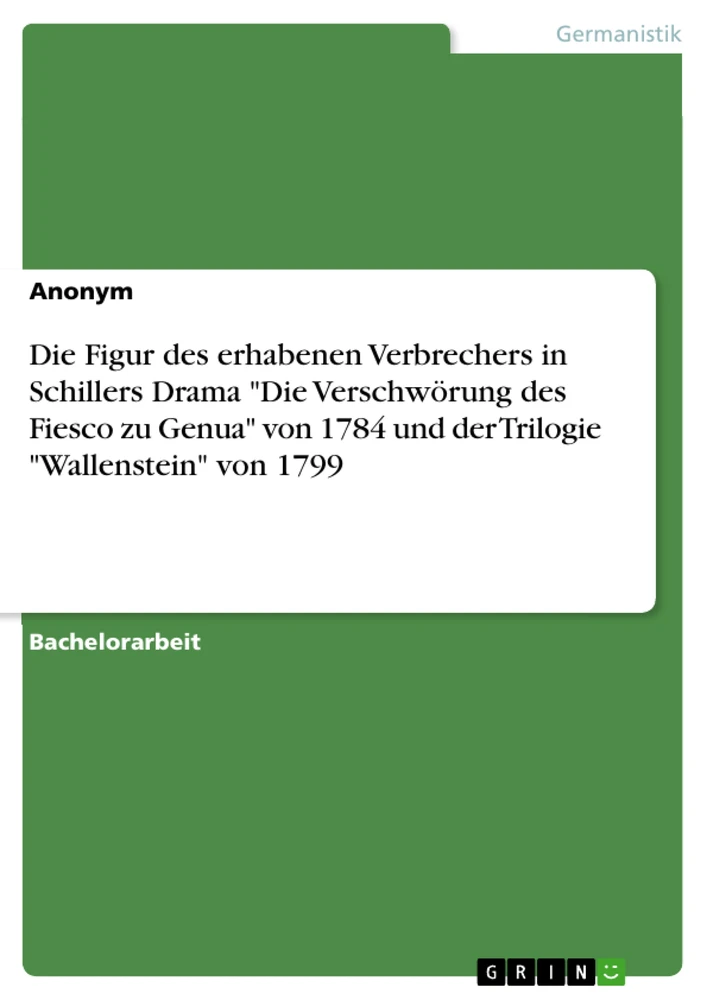Die Figur des Verbrechers ist aus der heutigen Literatur nicht mehr wegzudenken. Zahlreiche Kriminalromane erobern seit Jahren den Markt, die sich um den sogenannten „typischen Verbrecher“ drehen. Dieser wird im Roman meist von Gesetzeshütern verfolgt, die der Autor, aufgrund ihrer detektivischen Fähigkeiten, auswählt. Aber es existieren mittlerweile auch Romane, die sich darum bemühen, das bisher strikte negative Bild des Verbrechers umzudrehen. Der Leser verfolgt das Geschehen dann direkt aus der Perspektive des Verbrechers und bekommt so einen Einblick in den spannenden, undurchschaubaren Charakter. Die literarische Gestalt des Verbrechers, war bereits seit der Antike ein spannendes Phänomen, beispielsweise zu erkennen in der griechischen Göttermythologie. Die griechischen Götter hatten ihre Pflicht nicht nur darin, Gesetze festzulegen und über die Menschen zu herrschen, sondern auch Strafen gegen diejenigen zu verhängen, die sich nicht an die geltenden Gesetze hielten. Hierzu zählt beispielsweise Tantalus, der als König von Lydien mit den Göttern speiste und sie dabei auf die Probe stellte. Er tötete seinen Sohn Pelops, um ihn den Göttern als Mahl zu servieren. Die Götter erkannten die grausame Tat und bestraften Tantalus mit ewigen Qualen im Tartaros, sowie einem Fluch, der sein gesamtes Geschlecht betreffen sollte. Die Frage, die bis heute bleibt, ist aber: Was reizt einen Menschen zu solch‘ einem Vorgehen, das gegen geltende gesellschaftliche Normen verstößt? Worin liegen seine Handlungsmotive? Dies lässt sich nur anhand der subjektiven Abwägung des einzelnen Rezipienten herausfinden. Was kann den negativen Status des Verbrechers verändern? Bringt man die Gestalt des literarischen Verbrechers in Verbindung mit dem Wort „erhaben“, wird aus dem negativ konnotierten Typus des Verbrechers ein erhabener Verbrecher, der sich allein durch den Begriff bereits im positiven Sinn aufwertet. Doch inwiefern kann es erhabene Verbrecher geben und worin liegen ihre Funktion?
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Der Typus des literarischen Verbrechers in Verbindung mit dem Prinzip des Erhabenen nach Schiller
- Fiesco als politischer Einzelkämpfer und erhabener Verbrecher nach dem Prinzip des Erhabenen nach Pseudo-Longinus und nach Schiller
- Der Untergang Fiescos in Zusammenhang mit Schillers politischen Eindrücken im 18. Jahrhundert in Anlehnung an die Französische Revolution
- Der Typus des erhabenen Verbrechers in Schillers „Wallenstein“
- Wallenstein als ambivalenter Charakter in Zusammenhang mit dem Prinzip des Erhabenen nach Schiller
- Der Versuch der Überwindung vom geschichtlichem Handeln durch Wallenstein im Konflikt mit dem erhabenen Prinzip nach Schiller
- Kurzes Resümee
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Bachelorarbeit untersucht die Figur des erhabenen Verbrechers in Schillers Dramen „Die Verschwörung des Fiesco zu Genua“ und „Wallenstein“. Ziel ist es, die literarische Darstellung des Verbrechers im Kontext des Prinzips des Erhabenen nach Schiller zu analysieren und die kunstvolle Wirkung auf den Rezipienten aufzuzeigen.
- Die Verbindung des Begriffs „erhaben“ mit der Figur des Verbrechers und die resultierende paradoxe Wertigkeit.
- Schillers Interpretation des Prinzips des Erhabenen in Bezug auf die Dramenfiguren Fiesco und Wallenstein.
- Die Funktion des Erhabenen als Mittel der Charakterzeichnung und der Gestaltung des Spannungsbogens.
- Die Analyse der Handlungsmotivationen der beiden Figuren im Licht des Prinzips des Erhabenen.
- Die mögliche Entwicklung Schillers und seiner Vorstellung vom Erhabenen im Vergleich der beiden Dramen.
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in das Thema der Arbeit ein und stellt die Relevanz des Verbrechertypus in der Literatur sowie die Bedeutung des Prinzips des Erhabenen dar. Im ersten Kapitel wird der Typus des literarischen Verbrechers in Verbindung mit dem Prinzip des Erhabenen nach Schiller untersucht, wobei die Figur des Fiesco als Beispiel herangezogen wird. Das zweite Kapitel betrachtet den Untergang Fiescos im Kontext von Schillers politischen Eindrücken im 18. Jahrhundert. Das dritte Kapitel widmet sich dem Typus des erhabenen Verbrechers in Schillers „Wallenstein“, wobei die ambivalente Charakterzeichnung Wallensteins und sein Versuch der Überwindung des geschichtlichen Handelns im Zentrum stehen.
Schlüsselwörter
Schillers Dramen, erhabener Verbrecher, Prinzip des Erhabenen, Pseudo-Longinus, Fiesco, Wallenstein, ambivalente Charakterzeichnung, politische Handlungsmotivationen, ästhetische Wirkung, Literaturanalyse, Kunstgeschichte, Drameninterpretation.
- Arbeit zitieren
- Anonym (Autor:in), 2015, Die Figur des erhabenen Verbrechers in Schillers Drama "Die Verschwörung des Fiesco zu Genua" von 1784 und der Trilogie "Wallenstein" von 1799, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/491207