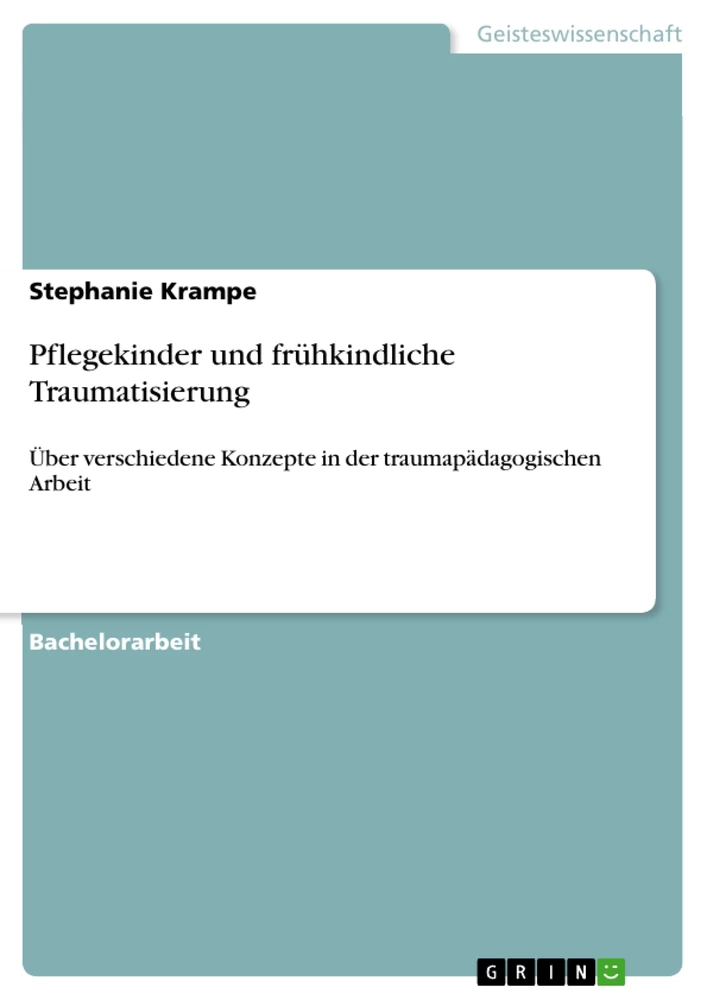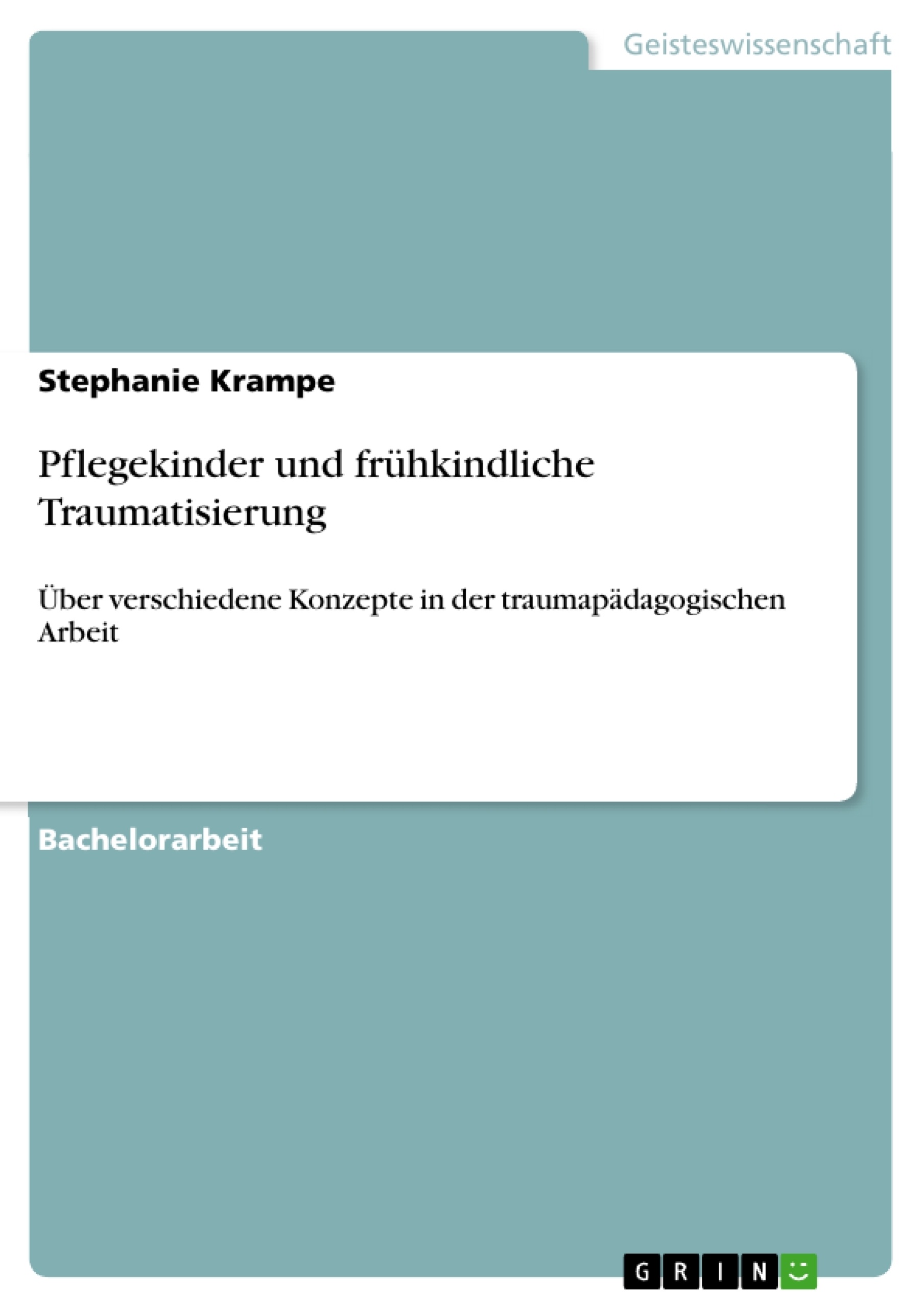Diese Arbeit geht der Frage nach, wie Pflegekinder, die in ihrer frühen Kindheit traumatische Situationen durchlebt haben, auf Basis der traumapädagogischen Erkenntnisse von ihren Pflegeeltern, Erziehern und Lehrern am besten gefördert werden können, um ihre mentale und psychosoziale Gesundheit zu schützen und optimal zu unterstützen. Auf Basis einer Definition des Begriffs "Trauma" werden zunächst die Symptomatik und Klassifikation der Diagnose "Posttraumatische Belastungsstörung" unter Einbezug der traumapädagogischen Diagnostik vorgestellt. Im weiteren Verlauf wird die Entstehung einer frühkindlichen Traumatisierung näher analysiert, um dann im nächsten Schritt einen Überblick über die verschiedenen Formen einer Posttraumatischen Belastungsstörung zu geben.
Darauf folgend werden die verschiedenen Konzepte und Methoden der Traumapädagogik präsentiert und unter Einbezug der Fragestellung, inwieweit die Traumapädagogik die Entwicklung einer Posttraumatischen Belastungsstörung positiv beeinflussen kann, analysiert. Abschließend wird ein kurzer Ausblick gegeben, wie besonders Pflegeeltern traumatisierten Kinder eine Chance auf eine gesunde und positive Zukunft bieten können, in der sie ihre Identität neu entwickeln lernen. Die vorliegende Arbeit schließt mit einem Fazit, in dem die wichtigsten Ergebnisse noch einmal präsentiert werden.
Kinder, deren leibliche Eltern die Erziehungsverantwortung nicht angemessen wahrnehmen können und dadurch bedingt in einer Pflegefamilie aufwachsen, haben in ihren ersten Lebensmonaten und -jahren häufig Situationen erlebt, die als "traumatisch" charakterisiert werden. Vernachlässigung und Vereinsamung in den ersten Lebensjahren, aber auch Gewalt und sexueller Missbrauch durch Familienangehörige sowie Trennungs- und Verlusterfahrungen können die Verarbeitungsmöglichkeiten von Kindern schnell überfordern, sodass das Kind innerlich verändert aus dieser Situation herauskommt. Häufig resultieren daraus Traumafolgestörungen.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Definition Trauma
- 2.1 Symptomatik und Klassifikation
- 2.2 Traumapädagogische Diagnostik
- 3. Entstehung einer frühkindlichen Traumatisierung
- 3.1 Auslösende Faktoren und Erleben eines Traumas
- 3.2 Traumatisierung im Prozess
- 4. Folgen einer frühkindlichen Traumatisierung
- 4.1 Formen der PTBS
- 4.2 Auswirkungen auf die mentale Gesundheit
- 4.3 Auswirkungen auf das psychosoziale Umfeld
- 4.4 Bindungsqualität im Erwachsenenalter
- 5. Möglichkeiten innerhalb der Traumapädagogik
- 5.1 Grundsätze und Haltungen in der traumapädagogischen Arbeit
- 6. Konzepte und Methoden
- 6.1 Der Notfallkoffer
- 6.2 Konzept des guten Grundes
- 6.3 Der sichere Ort
- 6.4 Selbstbemächtigung und Selbstwirksamkeit
- 7. Zukunftsperspektive Pflegefamilie
- 7.1 Identitätsbildung in der Pflegefamilie
- 8. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit befasst sich mit der Thematik der frühkindlichen Traumatisierung von Pflegekindern und untersucht, wie diese Kinder durch die Anwendung traumapädagogischer Erkenntnisse von ihren Pflegeeltern, Erziehern und Lehrern optimal gefördert werden können.
- Definition und Symptome des Traumas sowie die Klassifikation der Posttraumatischen Belastungsstörung (PTBS).
- Analyse der Entstehung frühkindlicher Traumatisierung und der auslösenden Faktoren.
- Untersuchung der Folgen einer frühkindlichen Traumatisierung auf die mentale Gesundheit, das psychosoziale Umfeld und die Bindungsqualität im Erwachsenenalter.
- Präsentation von Konzepten und Methoden der Traumapädagogik und deren Einfluss auf die Entwicklung einer PTBS.
- Perspektive der Pflegefamilie und die Möglichkeiten, traumatisierten Kindern eine positive Zukunft zu ermöglichen.
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit beginnt mit einer Einleitung, die das Thema der frühkindlichen Traumatisierung von Pflegekindern einführt und die Relevanz der Traumapädagogik für die Unterstützung dieser Kinder verdeutlicht. Im zweiten Kapitel wird der Begriff „Trauma“ definiert und die Symptomatik sowie die Klassifikation der Diagnose „Posttraumatische Belastungsstörung“ (PTBS) unter Einbezug der traumapädagogischen Diagnostik vorgestellt.
Das dritte Kapitel analysiert die Entstehung einer frühkindlichen Traumatisierung, indem es die auslösenden Faktoren und das Erleben eines Traumas sowie die Traumatisierung im Prozess näher beleuchtet. Kapitel 4 befasst sich mit den Folgen einer frühkindlichen Traumatisierung, darunter die verschiedenen Formen der PTBS, die Auswirkungen auf die mentale Gesundheit, das psychosoziale Umfeld und die Bindungsqualität im Erwachsenenalter.
Kapitel 5 untersucht die Möglichkeiten innerhalb der Traumapädagogik und die Grundsätze sowie Haltungen in der traumapädagogischen Arbeit. Im sechsten Kapitel werden verschiedene Konzepte und Methoden der Traumapädagogik präsentiert, wie z. B. der Notfallkoffer, das Konzept des guten Grundes, der sichere Ort und Selbstbemächtigung und Selbstwirksamkeit.
Das siebte Kapitel widmet sich der Zukunftsperspektive der Pflegefamilie und betrachtet die Identitätsbildung von traumatisierten Kindern in der Pflegefamilie. Schließlich werden die wichtigsten Ergebnisse der Arbeit im Fazit zusammengefasst.
Schlüsselwörter
Frühkindliche Traumatisierung, Pflegekinder, Traumapädagogik, Posttraumatische Belastungsstörung (PTBS), Symptomatik, Klassifikation, Diagnostik, Auslösende Faktoren, Folgen, mentale Gesundheit, psychosoziale Umfeld, Bindungsqualität, Konzepte, Methoden, sichere Bindung, Identitätsbildung, Pflegefamilie.
- Quote paper
- Stephanie Krampe (Author), 2018, Pflegekinder und frühkindliche Traumatisierung, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/492438