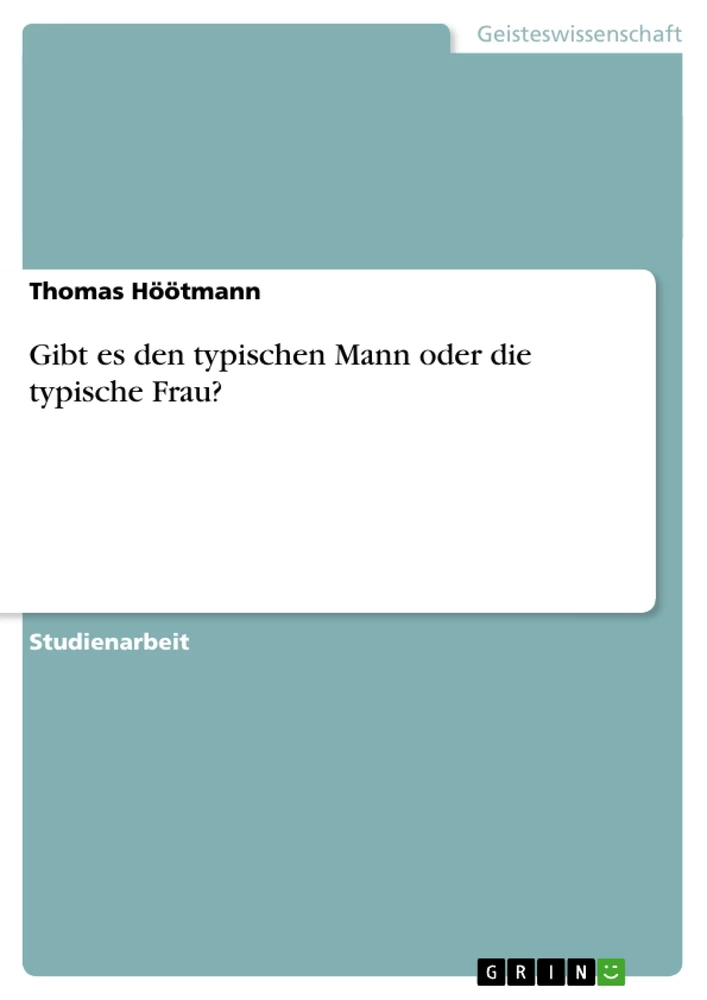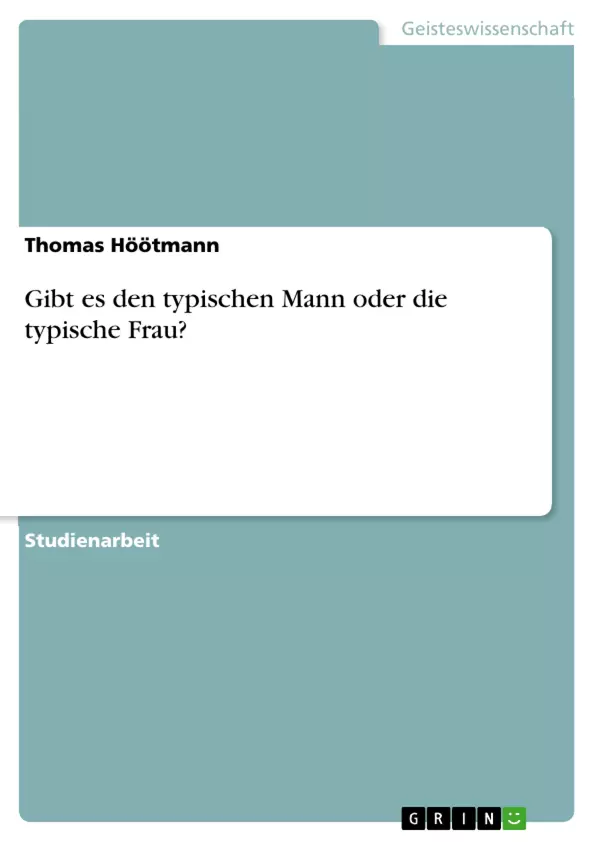1 Einleitung
Aufgrund meines persönlichen Interesses, habe ich mich bei der Themenwahl meiner Hausarbeit für folgende Fragestellung entschieden: "Gibt es den typischen Mann bzw. die typische Frau?" Um eine grobe Struktur in meine Arbeit zu bringen, möchte ich im Folgenden kurz auf einige Inhaltliche, wie auch formelle Aspekte eingehen.
Nach der Einleitung geht es in meiner Hausarbeit direkt zu meiner Leitthese über, die mich als roter Faden durch meine Hausarbeit begleiten soll und in einigen Kapiteln aufgegriffen, erläutert und erklärt wird. Das zweite Kapitel steht unter der Überschrift "Geschlechtsrollenentwicklung und Geschlechterstereotype". Hier möchte ich auf eventuell bestehende Unterschiede zwischen Mann und Frau eingehen und eine Analyse von Stereotypen und deren Inhalten aufzeigen. Um die Leitthese zu belegen, stelle ich ein Experiment vor, welches sich mit der Geschlechtsrollenprojektion von Eltern auf ihre Säuglinge beschäftigt. In Kapitel drei werden einige Theorien vorgestellt, die speziell auf die Geschlechtstypisierung und die Sozialisation der Geschlechter eingeht. Hier wird beschrieben, wie es zu den Geschlechtsspezifischen Unterschieden kommen könnte und was diese Prozesse möglicherweise unterstützen könnte. Das bis hier erarbeitete Material soll also erst eine unterschiedliche Darstellung von Mann und Frau, sowie einige Stereotype aufzeigen und im Folgenden (Kap.3) die dafür verantwortlichen Prozesse erläutern. Im darauf folgenden Kapitel 4 (Ergebnisse/ Diskussion) sollen die erarbeiteten Aspekte, wie auch die Leitthese erneut aufgegriffen werden. Diese werden nun mit der Fragestellung der Hausarbeit in Bezug gesetzt und diskutiert.
[...]
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 1.1 Einleitungsthese
- 2. Geschlechtsrollenentwicklung und Geschlechterstereotype
- 2.1 Kurze Definition der Begriffe
- 2.2 Erläuterung der Strukturen und Inhalte von Geschlechterstereotypen
- 2.2.1 Experiment zur Projektion von Geschlechtsrollen durch Eltern auf Säuglinge
- 2.3 Klassen von Stereotypmerkmalen
- 2.4 Funktionen und Unterschiede der Begriffe Stereotypisierung und Kategorisierung
- 3. Theorien der Geschlechtstypisierung und Sozialisation der Geschlechter
- 3.1 Biologischer Ansatz
- 3.2 Psychoanalytischer Ansatz
- 3.3 Die Soziale Lerntheorie
- 3.4 Die Sozial-kognitive Lerntheorie
- 4. Ergebnisse/ Diskussion
- 5. Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit untersucht die Frage, ob es einen „typischen Mann“ oder eine „typische Frau“ gibt. Ziel ist es, die Entwicklung von Geschlechterrollen und Geschlechterstereotypen zu beleuchten und verschiedene Theorien dazu zu präsentieren. Die Arbeit analysiert, wie diese Stereotype entstehen und welche Rolle sie in der Sozialisation spielen.
- Entwicklung von Geschlechterrollen
- Inhalt und Struktur von Geschlechterstereotypen
- Einfluss von Geschlechterstereotypen auf die Sozialisation
- Theorien der Geschlechtstypisierung
- Analyse eines Experiments zur Geschlechtsrollenprojektion
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in die Fragestellung der Hausarbeit ein: Gibt es den typischen Mann bzw. die typische Frau? Sie beschreibt den Aufbau der Arbeit und die Leitthese, die die Argumentation durchzieht. Die Leitthese besagt, dass Kinder, die in einer von Geschlechterstereotypen geprägten Umwelt aufwachsen, frühzeitig in bestehende Geschlechterrollen kategorisiert werden. Diese These wird im weiteren Verlauf der Arbeit untersucht und belegt.
2. Geschlechtsrollenentwicklung und Geschlechterstereotype: Dieses Kapitel definiert die Begriffe „Geschlechtsrollenentwicklung“ und „Geschlechterstereotype“. Es wird erläutert, wie sich geschlechtsbezogene Kognitionen, Einstellungen und Verhaltensmuster entwickeln und wie kulturelle Erwartungen dabei eine Rolle spielen. Die Theorie der sozialen Rollen von Eagly (1987) wird vorgestellt. Weiterhin werden Geschlechterstereotype als kognitive Strukturen beschrieben, die sozial geteiltes Wissen über die charakteristischen Merkmale von Männern und Frauen enthalten. Ein Experiment zur Projektion von Geschlechtsrollen durch Eltern auf Säuglinge wird vorgestellt, um die These der frühzeitigen Kategorisierung zu unterstützen.
Schlüsselwörter
Geschlechterrollenentwicklung, Geschlechterstereotype, Sozialisation, Geschlechtstypisierung, Theorien der Geschlechtstypisierung (biologisch, psychoanalytisch, sozial-kognitive Lerntheorie), Stereotypisierung, Kategorisierung, Experiment, Eltern, Säuglinge.
Häufig gestellte Fragen (FAQs) zur Hausarbeit: Geschlechterrollen und Geschlechterstereotype
Was ist das Thema der Hausarbeit?
Die Hausarbeit untersucht die Frage, ob es einen „typischen Mann“ oder eine „typische Frau“ gibt. Sie beleuchtet die Entwicklung von Geschlechterrollen und Geschlechterstereotypen und präsentiert verschiedene Theorien dazu. Ein Schwerpunkt liegt auf der Entstehung dieser Stereotype und ihrer Rolle in der Sozialisation.
Welche Zielsetzung verfolgt die Arbeit?
Ziel der Arbeit ist es, die Entwicklung von Geschlechterrollen und Geschlechterstereotypen zu analysieren und verschiedene Theorien zu präsentieren. Es soll untersucht werden, wie diese Stereotype entstehen und welche Rolle sie in der Sozialisation spielen. Die Leitthese der Arbeit besagt, dass Kinder in einer von Geschlechterstereotypen geprägten Umwelt frühzeitig in bestehende Geschlechterrollen kategorisiert werden.
Welche Themenschwerpunkte werden behandelt?
Die Arbeit behandelt die Entwicklung von Geschlechterrollen, den Inhalt und die Struktur von Geschlechterstereotypen, den Einfluss von Geschlechterstereotypen auf die Sozialisation, Theorien der Geschlechtstypisierung und die Analyse eines Experiments zur Geschlechtsrollenprojektion.
Welche Kapitel umfasst die Hausarbeit?
Die Hausarbeit gliedert sich in eine Einleitung, ein Kapitel zur Geschlechtsrollenentwicklung und Geschlechterstereotypen, ein Kapitel zu Theorien der Geschlechtstypisierung und Sozialisation der Geschlechter, ein Kapitel mit Ergebnissen/Diskussion und ein Literaturverzeichnis.
Was wird in der Einleitung erläutert?
Die Einleitung führt in die Fragestellung ein: Gibt es den typischen Mann bzw. die typische Frau? Sie beschreibt den Aufbau der Arbeit und die Leitthese: Kinder werden in einer von Geschlechterstereotypen geprägten Umwelt frühzeitig in bestehende Geschlechterrollen kategorisiert. Diese These wird im weiteren Verlauf untersucht und belegt.
Was beinhaltet das Kapitel über Geschlechtsrollenentwicklung und Geschlechterstereotype?
Dieses Kapitel definiert die Begriffe „Geschlechtsrollenentwicklung“ und „Geschlechterstereotype“. Es erläutert die Entwicklung geschlechtsbezogener Kognitionen, Einstellungen und Verhaltensmuster und die Rolle kultureller Erwartungen. Die Theorie der sozialen Rollen von Eagly (1987) wird vorgestellt. Geschlechterstereotype werden als kognitive Strukturen beschrieben, die sozial geteiltes Wissen über die charakteristischen Merkmale von Männern und Frauen enthalten. Ein Experiment zur Projektion von Geschlechtsrollen durch Eltern auf Säuglinge wird vorgestellt, um die These der frühzeitigen Kategorisierung zu unterstützen.
Welche Theorien der Geschlechtstypisierung werden behandelt?
Die Arbeit behandelt den biologischen, den psychoanalytischen Ansatz, die soziale Lerntheorie und die sozial-kognitive Lerntheorie der Geschlechtstypisierung.
Welche Schlüsselwörter sind relevant?
Wichtige Schlüsselwörter sind: Geschlechterrollenentwicklung, Geschlechterstereotype, Sozialisation, Geschlechtstypisierung, Theorien der Geschlechtstypisierung (biologisch, psychoanalytisch, sozial-kognitive Lerntheorie), Stereotypisierung, Kategorisierung, Experiment, Eltern, Säuglinge.
Welches Experiment wird analysiert?
Die Arbeit analysiert ein Experiment zur Projektion von Geschlechtsrollen durch Eltern auf Säuglinge. Dieses Experiment dient dazu, die These der frühzeitigen Kategorisierung von Kindern in Geschlechterrollen zu unterstützen.
- Arbeit zitieren
- Thomas Höötmann (Autor:in), 2002, Gibt es den typischen Mann oder die typische Frau?, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/4937