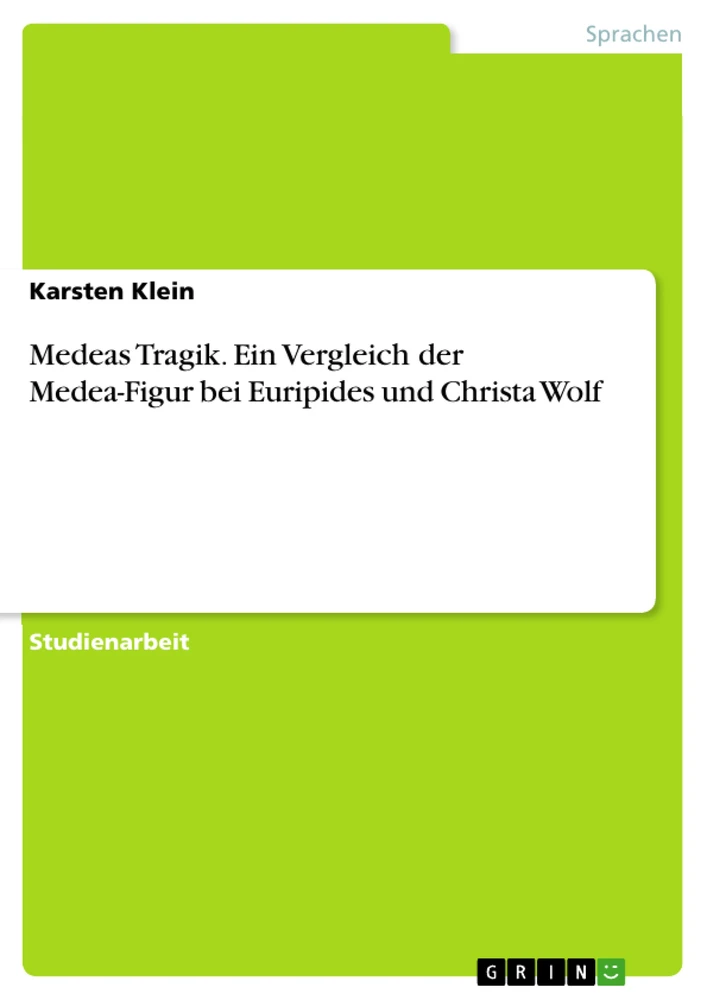In dieser Arbeit wird die Tragik zweier Versionen der Medea analysiert und miteinander verglichen. Es handelt sich zum einen um die antike Vorlage des Medea-Stoffes, die Tragödie "Medea" von Euripides. Das zweite gewählte Werk ist eine der neueren Bearbeitungen, "Medea. Stimmen" von Christa Wolf. Als erstes wird in einem theoretischen Teil der Begriff des Tragischen definiert, um so eine einheitliche Definition für die weitere Analyse der Werke zu erlangen. Im Anschluss folgt die Analyse der antiken euripideischen Medea. Hierbei wird zuerst ihre Emotionalität in den Vordergrund gestellt, bevor ihre Rolle als Frau im Stück analysiert wird.
Den Abschluss dieses Kapitels bildet eine Analyse der Rache der Medea. Danach wird die Tragik der Medea bei Christa Wolf in den Fokus gerückt. Nach einer kurzen Beschreibung der Gattungswahl wird die Liebesbeziehung von Medea und Jason untersucht. Abschließend erfolgt die Erforschung der Opferrolle Medeas bei Christa Wolf. Darauffolgend werden beide Medea-Figuren direkt miteinander verglichen, bevor eine finale Schlussbemerkung die Arbeit abschließt. Es wird dabei deren Tragik in beiden Werken in Beziehung zueinander gestellt, um Gemeinsamkeiten und Unterschiede zu differenzieren.
Der Mythos Medea ist seit jeher ein Bestandteil der europäischen Literatur. Er hat bis zum heutigen Tage viele Umdeutungen, Bearbeitungen und Korrekturen erfahren. Aufgrund der unterschiedlichen Zeiten, zu denen die jeweiligen Versionen verfasst wurden, können an den mythologischen Stoffen immer auch kulturelle Besonderheiten der verschiedenen Epochen abgelesen werden. Anhand dieser Tatsache ist es zu erklären, dass viele Autoren von der Antike bis in die Gegenwart den Mythos Medea anders auslegten und ihren Fokus auf unterschiedliche Dinge setzten. Über die Jahrtausende hinweg, zeigt sich die Protagonistin als äußerst vielfältig interpretierbar. Unterschiedliche positive und negative Charaktereigenschaften sind bei dieser Figur zu finden, die von Autor zu Autor verschieden stark gewichtet werden. So wirkt sie teilweise als kaltblütige Kindsmörderin, oder auch als selbstbewusste Frau und Mutter. Ihre eigenen Emotionen und ihre Einstellung zu den Menschen um sie herum werden ihr zum Verhängnis, wodurch sie zu einer tragischen Heldin wird.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Der Begriff des Tragischen
- Die Tragik der antiken euripideischen Medea
- Medea als emotionale Figur
- Medea als tragische Frau
- Die Rache der Medea
- Die Tragik der Medea bei Christa Wolf
- Gattungswahl
- Medeas Beziehung zu Jason und ihre Flucht
- Medea als Opfer
- Vergleich der Medea Figuren
- Schlussbetrachtung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit analysiert die Tragik der Medea-Figur in den Werken von Euripides und Christa Wolf, um Gemeinsamkeiten und Unterschiede in der Darstellung der Figur aufzuzeigen. Es werden die jeweiligen historischen und literarischen Kontexte berücksichtigt, um ein tieferes Verständnis für die unterschiedlichen Interpretationen des Mythos zu gewinnen.
- Der Begriff des Tragischen und seine Anwendung auf die Medea-Figuren
- Die Emotionalität und Motivation der Medea in den beiden Werken
- Die Rolle der Medea als Frau und Mutter
- Medeas Rache und ihre Auswirkungen auf die Figuren und die Handlung
- Der Vergleich der Medea-Figuren in Bezug auf ihre Tragik, Schuld und Opferrolle
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt den Mythos Medea als ein wiederkehrendes Thema der europäischen Literatur vor und erläutert die unterschiedlichen Interpretationen der Figur im Laufe der Zeit. Im zweiten Kapitel wird der Begriff des Tragischen definiert und die für die Analyse relevanten Aspekte herausgearbeitet, wobei der Fokus auf die tragische Schuld der Figuren liegt.
Das dritte Kapitel analysiert die antike Tragödie Medea von Euripides. Zunächst wird die emotionale Verfassung der Medea im Stück beleuchtet, gefolgt von einer Analyse ihrer Rolle als Frau und Mutter. Abschließend wird die Rache der Medea im Stück untersucht.
Im vierten Kapitel wird die Tragik der Medea in Christa Wolfs Medea. Stimmen beleuchtet. Nach einer kurzen Beschreibung der Gattungswahl, wird die Beziehung zwischen Medea und Jason näher betrachtet, bevor die Opferrolle der Medea analysiert wird.
Schlüsselwörter
Medea, Tragik, Euripides, Christa Wolf, Mythos, antike Tragödie, moderne Literatur, Gattungswahl, Beziehung, Rache, Opferrolle, Schuld, Hamartia.
Häufig gestellte Fragen
Was sind die zentralen Unterschiede zwischen der Medea von Euripides und Christa Wolf?
Während Euripides Medea als rachsüchtige Kindsmörderin in einer antiken Tragödie darstellt, deutet Christa Wolf die Figur in "Medea. Stimmen" um. Bei Wolf wird Medea eher als Sündenbock und Opfer politischer Intrigen in einer korrupten Gesellschaft gezeigt, die ihre Kinder nicht selbst tötet.
Wie wird der Begriff des Tragischen in dieser Arbeit definiert?
Die Arbeit nutzt einen theoretischen Teil, um das Tragische über Begriffe wie die tragische Schuld (Hamartia) und den unvermeidbaren Konflikt der Heldin mit ihrer Umwelt oder ihrem Schicksal zu definieren, um eine Basis für den Vergleich beider Werke zu schaffen.
Welche Rolle spielt die Emotionalität bei der euripideischen Medea?
Bei Euripides steht Medeas tiefe Verletzung durch Jasons Verrat im Vordergrund. Ihre starken Emotionen – von Liebe zu tiefem Hass – treiben sie zur extremen Rache, was sie zu einer hochemotionalen, aber auch erschreckenden tragischen Figur macht.
Warum wählte Christa Wolf die Gattung "Stimmen" für ihren Roman?
Die Wahl der Polyphonie (verschiedene Erzählstimmen) erlaubt es Wolf, die Geschichte aus unterschiedlichen Perspektiven zu beleuchten. Dadurch wird die Komplexität der Figur Medea und ihre Stigmatisierung durch die Gesellschaft von Korinth deutlicher spürbar.
Inwiefern wird Medea bei Christa Wolf als Opfer dargestellt?
Medea fungiert bei Wolf als Projektionsfläche für die Ängste der Korinther. Sie wird zur Außenseiterin gemacht, die aufgrund ihres Wissens und ihrer Unabhängigkeit als Bedrohung wahrgenommen und schließlich für das Unheil der Stadt verantwortlich gemacht wird.
Welche Bedeutung hat der Mythos Medea für die europäische Literatur?
Der Medea-Mythos dient seit der Antike als fester Bestandteil der Literatur, der je nach Epoche unterschiedlich umgedeutet wurde. Er spiegelt kulturelle Besonderheiten und den jeweiligen Zeitgeist wider, insbesondere in Bezug auf Frauenrollen und Fremdenfeindlichkeit.
- Arbeit zitieren
- Karsten Klein (Autor:in), 2018, Medeas Tragik. Ein Vergleich der Medea-Figur bei Euripides und Christa Wolf, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/495455