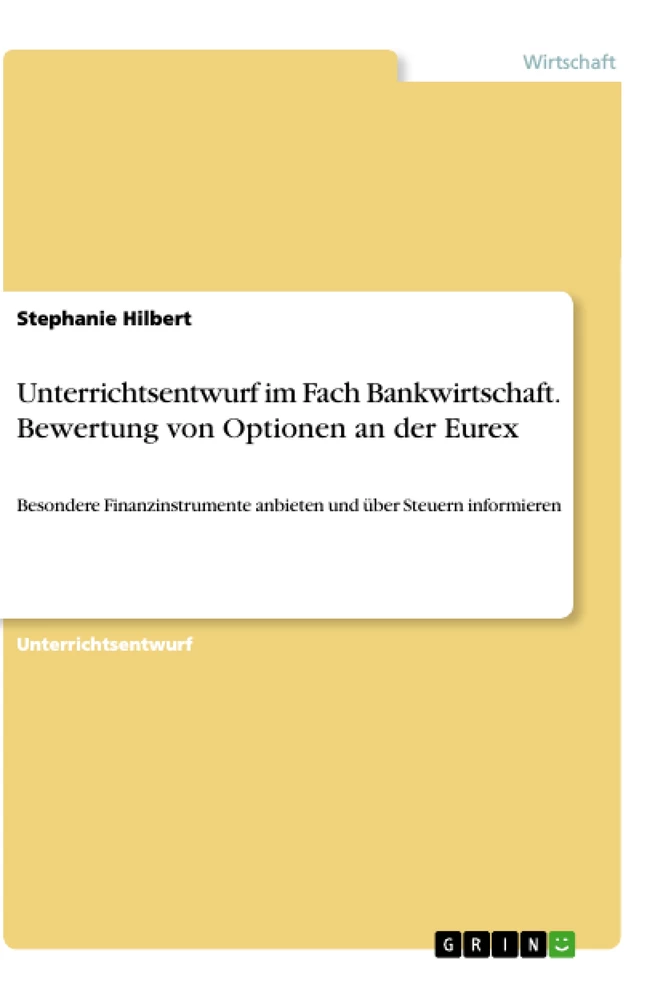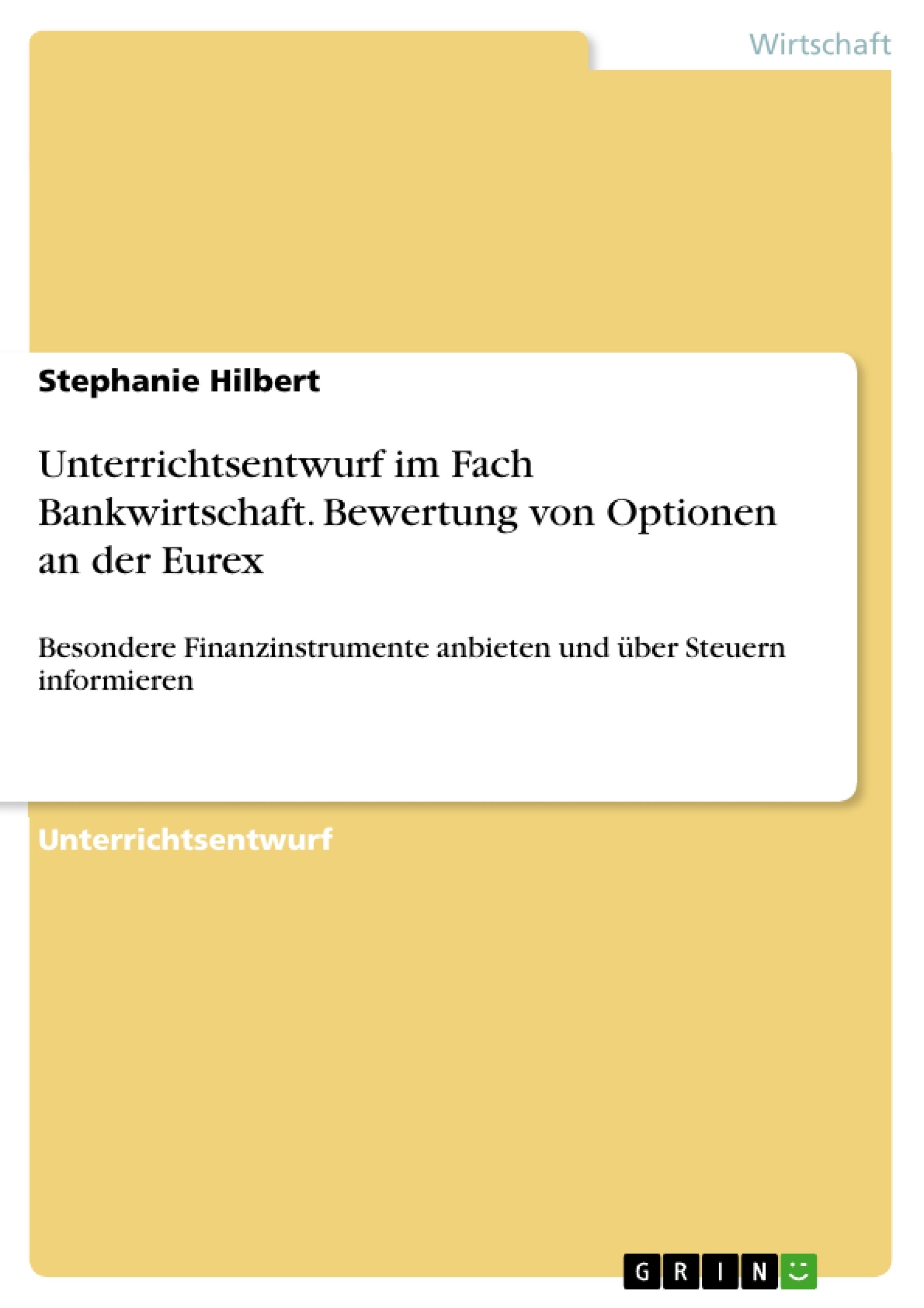Der Lehrplan des Ausbildungsberufes Bankkaufmann/-frau enthält das Lernfeld 5 "Besondere Finanzinstrumente anbieten und über Steuern informieren". Im Rahmen dieses Lernfelds sollen die Schüler die Kriterien besonderer Anlageformen kennen, vergleichen und begründet anbieten können. Gegenstand der Sequenz wird daher die inhaltliche Erschließung verschiedener Anlageformen sowie die Betrachtung der Besteuerung in verschiedenen Situationen sein. Grundsätzliches Ziel der Sequenz ist es, die Schüler in die Lage zu versetzen, eine Anlageempfehlung begründet treffen und beurteilen zu können.
Abgesehen vom Lehrplan ist das Thema Anlageformen für die Schüler in ihrem späteren Berufsleben von großer Relevanz. Die im Unterricht behandelten besonderen Anlageformen eignen sich jedoch ausschließlich für Kunden, die ein erhöhtes Risiko eingehen wollen und somit benötigt der Berater fundiertes Fachwissen und Erfahrung im Rahmen der Produktempfehlung.
In der geplanten Stunde sollen zwei Positionen im Optionsgeschäft der Eurex begründet bewertet werden. Die Schüler entwickeln Chancen, Risiken, Erwartungen und Gewinnschwellen zu den "long"-Positionen im Call und Put. Die analogen Erwartungen in der "short"-Position sind didaktisch reduziert, da diese entgegengesetzte Chancen bzw. Risiken aufweisen und es daher ausreicht, dass die Schüler im Rahmen des Gruppenpuzzles die allgemeinen Risiken kennen. Eine weitere, konkrete Anlagebewertung im "short"-Profil würde eine unerwünschte analoge Redundanz bedeuten.
Inhaltsverzeichnis
- Planungsrelevante Faktoren
- Schülerbezogene Planungsfaktoren
- Lehrerbezogene Planungsfaktoren
- Organisatorische Planungsfaktoren
- Sachanalyse
- Entscheidungen
- Makroebene
- Legitimation des Unterrichts und grundsätzliche Absichten
- Einbettung in den laufenden Unterricht
- Mikroebene
- Didaktische Reduktion
- Stundenlernziel
- Unterrichtsverlauf
- Phasierung
- Einstieg
- Vorbereitungsphase - Stammgruppen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Der Unterrichtsbesuch im Fach Bankwirtschaft zielt auf die Vermittlung von Kenntnissen über besondere Finanzinstrumente und deren Bewertung ab. Die Schüler sollen die Kriterien verschiedener Anlageformen kennenlernen, vergleichen und begründet anbieten können. Die Stunde fokussiert sich auf die Bewertung von Optionen an der Eurex, wobei die Chancen und Risiken verschiedener Positionen im Optionsgeschäft im Vordergrund stehen.
- Bewertung von Optionen an der Eurex
- Chancen und Risiken von Anlageformen
- Grundpositionen im Optionsgeschäft (Call und Put)
- Entwicklung von Szenarien für verschiedene Kursentwicklungen
- Ermittlung von Gewinnschwellen
Zusammenfassung der Kapitel
Der Text beschreibt den Entwurf eines Unterrichtsbesuches im Fach Bankwirtschaft. Der Fokus liegt auf der Bewertung von Optionen an der Eurex. Die Stunde beinhaltet eine praxisnahe Handlungssituation, die den Schülern die Relevanz des Themas für ihren späteren Beruf verdeutlicht. Die Schüler werden in Expertengruppen eingeteilt, um verschiedene Aspekte des Optionsgeschäfts zu erforschen und anschließend gemeinsam eine Anlageentscheidung zu bewerten.
Die Schüler lernen die Chancen und Risiken der Grundpositionen im Optionsgeschäft kennen und entwickeln Szenarien für verschiedene Kursentwicklungen. Sie ermitteln Gewinnschwellen und diskutieren ihre Ergebnisse im Plenum. Die didaktische Reduktion der „short“-Positionen ermöglicht es den Schülern, die grundlegenden Risiken zu verstehen, ohne in detaillierte Analysen einzugehen.
Schlüsselwörter
Die wichtigsten Schlüsselwörter des Textes sind Optionen, Eurex, Anlageentscheidung, Chancen, Risiken, Gewinnschwellen, Expertengruppen, Call, Put, Kursentwicklung, didaktische Reduktion, Stammgruppen, Handlungssituation und Anlageformen.
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Ziel dieses Unterrichtsentwurfs?
Das Ziel ist es, Schülern der Bankwirtschaft die Kriterien besonderer Anlageformen zu vermitteln und sie zu befähigen, Anlageempfehlungen für Optionen an der Eurex begründet zu treffen.
Welche konkreten Finanzinstrumente werden behandelt?
Der Fokus liegt auf Optionen, speziell auf den "Long"-Positionen im Call und Put, sowie deren Chancen, Risiken und Gewinnschwellen.
Warum wurden die "Short"-Positionen didaktisch reduziert?
Da Short-Positionen spiegelbildliche Risiken zu Long-Positionen aufweisen, reicht die Kenntnis der allgemeinen Risiken aus, um Redundanz im Unterricht zu vermeiden.
Wie ist die Unterrichtsstunde methodisch aufgebaut?
Die Stunde nutzt ein Gruppenpuzzle mit Experten- und Stammgruppen, um eine praxisnahe Handlungssituation und Anlagebewertung zu erarbeiten.
Welche Rolle spielt die Eurex in diesem Kontext?
Die Eurex dient als Referenzmarkt für das standardisierte Optionsgeschäft, an dem die Schüler Preisentwicklungen und Gewinnschwellen analysieren.
- Quote paper
- Stephanie Hilbert (Author), 2019, Unterrichtsentwurf im Fach Bankwirtschaft. Bewertung von Optionen an der Eurex, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/495471