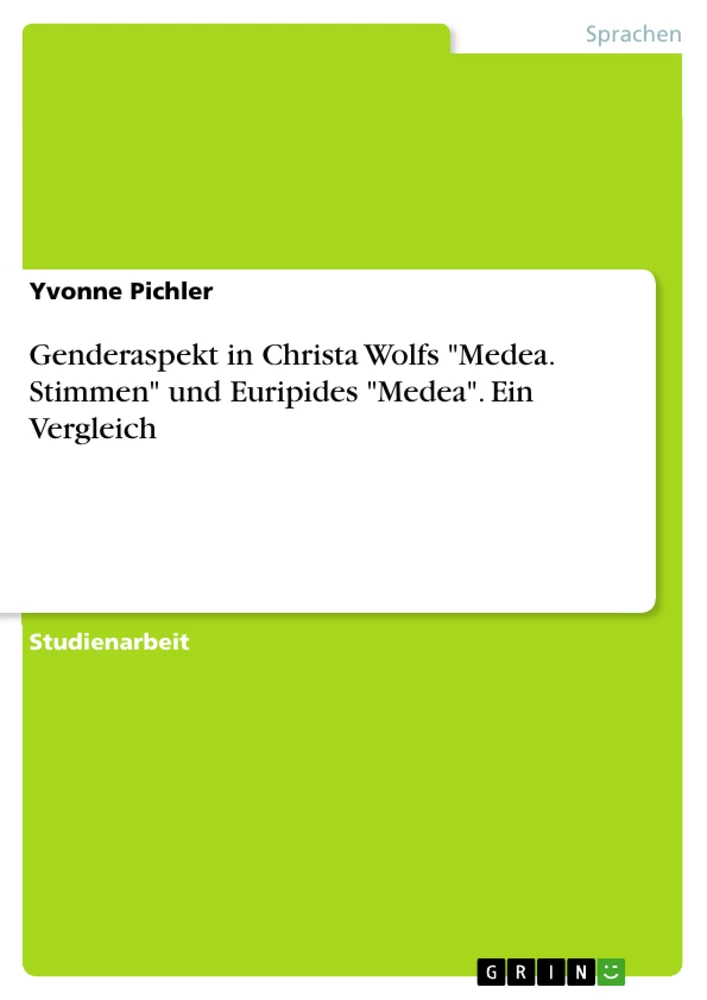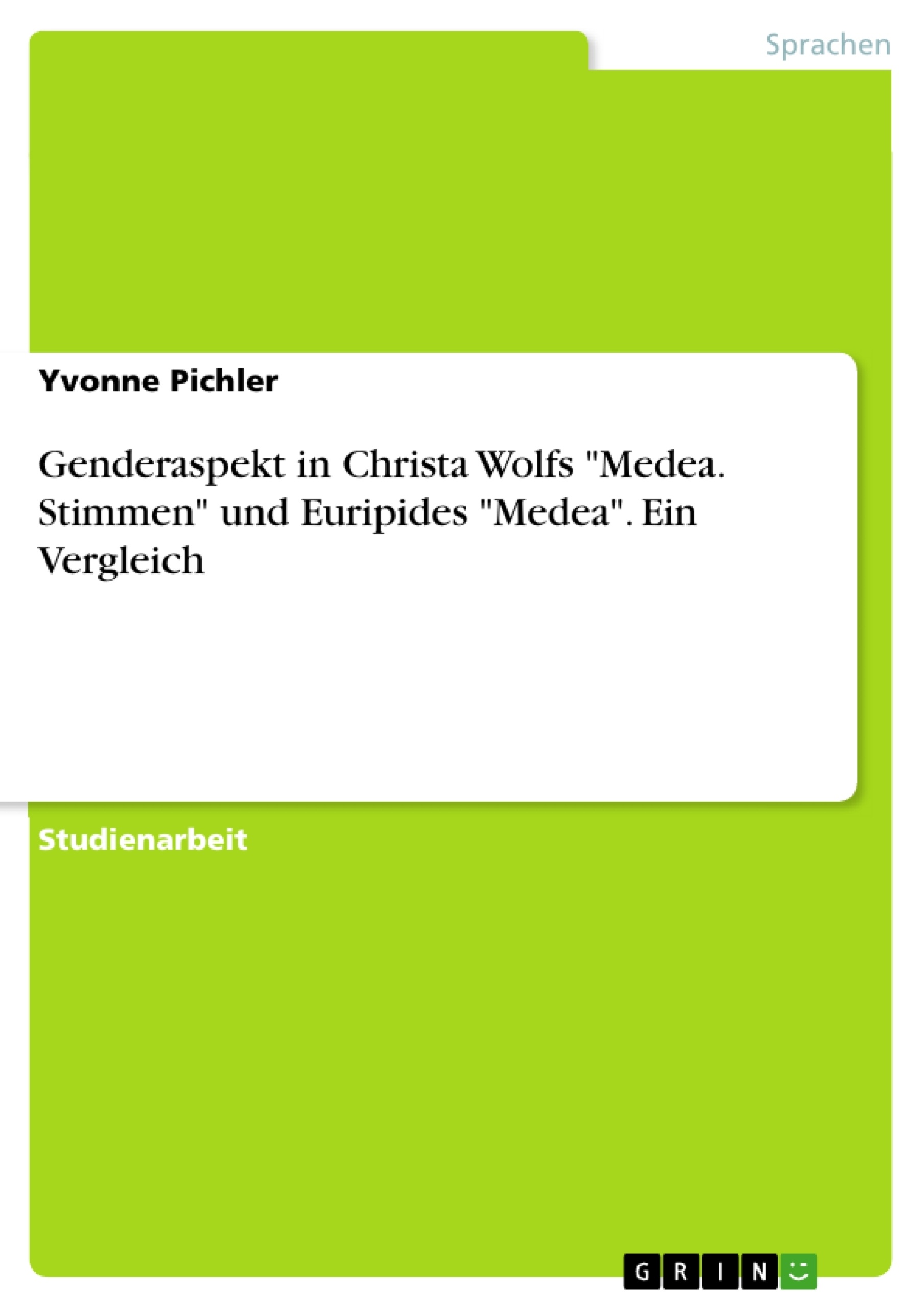Diese Seminararbeit behandelt die Genderaspekte in den beiden Werken „Medea. Stimme“ von Christa Wolf und „Medea“ von Euripides. Mein Interesse an diesem Thema wurde geweckt, da Christa Wolf selbst in ihrem Werk die traditionelle Genderstereotypisierung sowie die Rollenerwartung kritisiert. Der Hauptteil meiner Arbeit setzt sich mit dem Vergleich der beiden Werke und deren Anerkennungsmodi im Bezug auf die Rollenverteilung auseinander. Die Vorgehensweise in meiner Seminararbeit wird folgendermaßen aussehen: zunächst werde ich die Begriffe Anerkennung, Respekt und Toleranz definieren. Danach gehe ich auf Anerkennung und die Ursachen für den Verlust der Anerkennung anhand der beiden Protagonisten, Medea und Jason, ein. Eine besonders zentrale Bedeutung spielt dabei die Anerkennung bzw. Nichtanerkennung/ Missachtung der Frau. Dabei soll die Frage geklärt werden, durch welchen Habitus Medea Anerkennung verliert. Ich beziehe mich in meiner Arbeit auf die Anerkennungsmodelle von Axel Honneth und Nancy Fraser, darüber hinaus gehe ich auf die These der Herrschaft und Knechtschaft von Georg Wilhelm Friedrich Hegel ein.
Zum Schluss soll ein Vergleich zwischen den Werken stattfinden, in welchen die Anerkennungsmodelle in Bezug auf die Genderthematik dargelegt werden.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Begriffserklärung
- ,,Medea. Stimmen\" von Christa Wolf
- ,,Medea\" von Euripides
- Vergleich der beiden Werke
- Resümee
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Seminararbeit untersucht die Genderaspekte in den Werken ,,Medea. Stimmen“ von Christa Wolf und „Medea“ von Euripides. Sie analysiert, wie die beiden Werke die traditionellen Geschlechterrollen und die Erwartungen an Frauen und Männer in der Antike und im 20. Jahrhundert darstellen. Die Arbeit konzentriert sich auf die Anerkennung bzw. Nichtanerkennung der Protagonistin Medea in beiden Werken, insbesondere im Kontext der Herrschafts- und Knechtschaftsverhältnisse zwischen Mann und Frau.
- Anerkennung und Nichtanerkennung von Frauen in der Antike und im 20. Jahrhundert
- Analyse der Rolle von Medea als Frau in einem patriarchalen Gesellschaftssystem
- Vergleich der Genderdarstellungen in den Werken von Christa Wolf und Euripides
- Untersuchung der Anerkennungstheorie von Axel Honneth im Kontext der Werke
- Analyse der Rolle von Macht und Herrschaftsverhältnissen in der Geschlechterdynamik
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Die Einleitung stellt das Thema der Seminararbeit vor und erläutert den Fokus auf die Genderaspekte in den Werken von Christa Wolf und Euripides. Sie führt den Leser in die Thematik der Anerkennung ein und skizziert die zentrale Frage der Arbeit: Wie wird Medea in beiden Werken anerkannt oder nicht anerkannt, und was sind die Ursachen dafür?
- Begriffserklärung: Dieses Kapitel definiert die Begriffe Anerkennung, Respekt und Toleranz im Kontext der Antike und des 20. Jahrhunderts. Es beleuchtet die unterschiedlichen Rollen und Erwartungen an Frauen in diesen Epochen und stellt die Herausforderungen für die Anerkennung von Frauen dar.
- ,,Medea. Stimmen“ von Christa Wolf: Dieses Kapitel analysiert die Rolle von Medea in Christa Wolfs Werk und untersucht, wie die Autorin die traditionelle Genderstereotypisierung und die Erwartungen an Frauen in einem patriarchalen Gesellschaftssystem darstellt. Es beleuchtet die verschiedenen Aspekte der Anerkennung, die Medea in der korinthischen Gesellschaft erfährt, und untersucht die Ursachen für ihre Nichtanerkennung.
Schlüsselwörter
Die Seminararbeit behandelt wichtige Schlüsselbegriffe wie Gender, Anerkennung, Respekt, Toleranz, Patriarchat, Herrschaftsverhältnisse, Macht, Frau, Mann, Medea, Christa Wolf, Euripides, Antike, 20. Jahrhundert und die Anerkennungstheorie von Axel Honneth. Diese Begriffe werden in Bezug auf die Analyse der beiden Werke verwendet, um die zentralen Themen und Argumente der Arbeit zu beleuchten.
Häufig gestellte Fragen
Welche Werke werden in dieser Seminararbeit verglichen?
Verglichen werden „Medea. Stimmen“ von Christa Wolf und die klassische „Medea“ von Euripides.
Welche Genderaspekte kritisiert Christa Wolf?
Wolf kritisiert traditionelle Genderstereotypen, patriarchale Rollenerwartungen und die Nichtanerkennung der Frau in der Gesellschaft.
Welche Rolle spielen Axel Honneth und Nancy Fraser?
Ihre Anerkennungsmodelle dienen als theoretische Basis, um die Missachtung oder Anerkennung der Figur Medea zu analysieren.
Was bedeutet „Herrschaft und Knechtschaft“ nach Hegel in diesem Kontext?
Die These wird herangezogen, um die Machtdynamik und Abhängigkeitsverhältnisse zwischen Medea und Jason zu untersuchen.
Wie unterscheidet sich die Medea bei Wolf von der bei Euripides?
Die Arbeit untersucht die unterschiedlichen Habitus-Formen und gesellschaftlichen Rahmenbedingungen, durch die Medea in den jeweiligen Epochen Anerkennung verliert.
- Citation du texte
- Yvonne Pichler (Auteur), 2019, Genderaspekt in Christa Wolfs "Medea. Stimmen" und Euripides "Medea". Ein Vergleich, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/495804