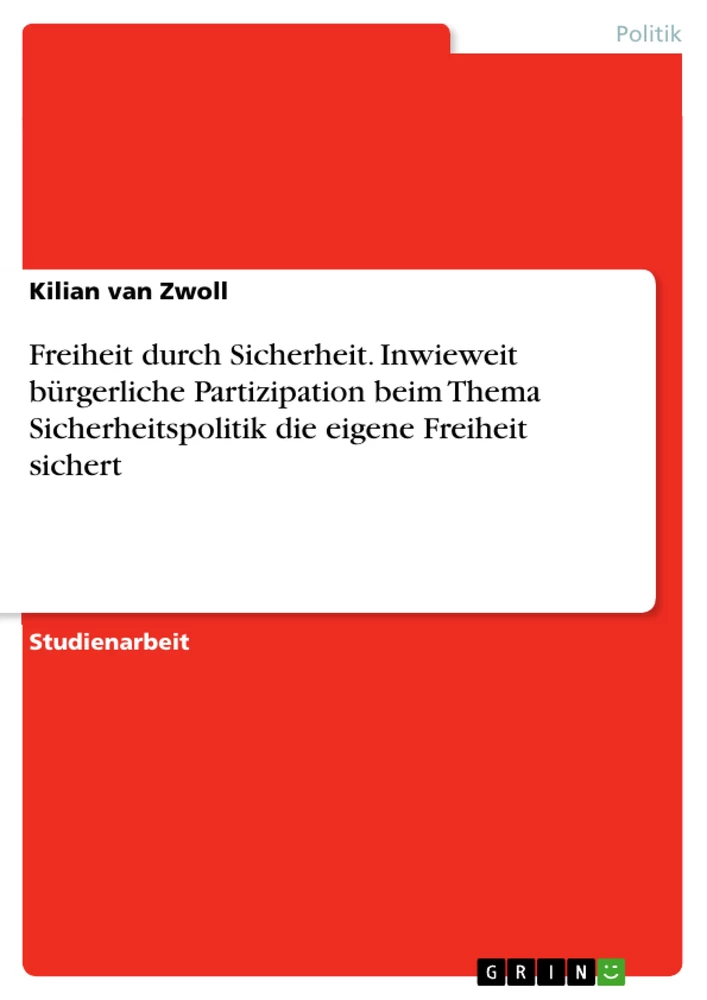Deutschland wurde in den vergangenen Jahren Ziel islamistischer Terroranschläge. Die Sicherheitsbehörden mussten sich zahlreiche Versäumnisse eingestehen. Doch gibt es tatsächlich Grund zur Sorge? Ist staatliches Handeln nicht mehr von verfassungsgemäßen Werten geleitet? Weshalb liegt es nun am Bürger, die Ausgestaltung der Sicherheitspolitik mitzubestimmen, um seine eigene Freiheit zu sichern? Diese Fragen hat sich diese Arbeit zur Aufgabe gemacht.
Am Anfang soll das Phänomen Terrorismus definiert werden. Anschließend soll die aktuelle Bedrohungslage Deutschlands aufgezeigt werden, um ein Verständnis für die hiesige Sicherheitspolitik zu bekommen. Schließlich sollen die konkreten Maßnahmen benannt und auf ihre Grundrechtskollisionen hin aufgezeigt werden. Letztlich folgt eine kritische Betrachtung des Spannungsverhältnisses zwischen Freiheit und Sicherheit. Hierfür wird die Anti-Terror-Datei als Fallbeispiel dienen.
Inhaltsverzeichnis
1. Einleitung
2. Terrorismus
2.1 Definition von Terrorismus
Das Konfliktfeld der einheitlichen Definition von Terrorismus
Festlegung auf eine Definition
2.2 Historische Entwicklung von Terrorismus in Deutschland
2.3 Aktuelle Bedrohung durch Terrorismus in Deutschland
3. Terrorismusbekämpfung in Deutschland
3.1 Anti-Terror: Mit welchen Mitteln?
Anti-Terror Gesetze der 1970er Jahre
Anti-Terror Gesetze nach dem 11. September 2001
3.2 Grenzen der Terrorismusbekämpfung
Rechtsstaatliche Schranken von Terrorismusbekämpfung
Emotional-ideelle Schranken von Terrorismusbekämpfung
3.3 Analyse: Sicherheit
Semantischer Wandel von Freiheit
Sicherheit - das Instrument für das Ideal der Freiheit
Fallbeispiel: Die Anti-Terror-Datei
4. Fazit
5. Literaturverzeichnis
6. Internetquellen
7. Rechtsquellen
-
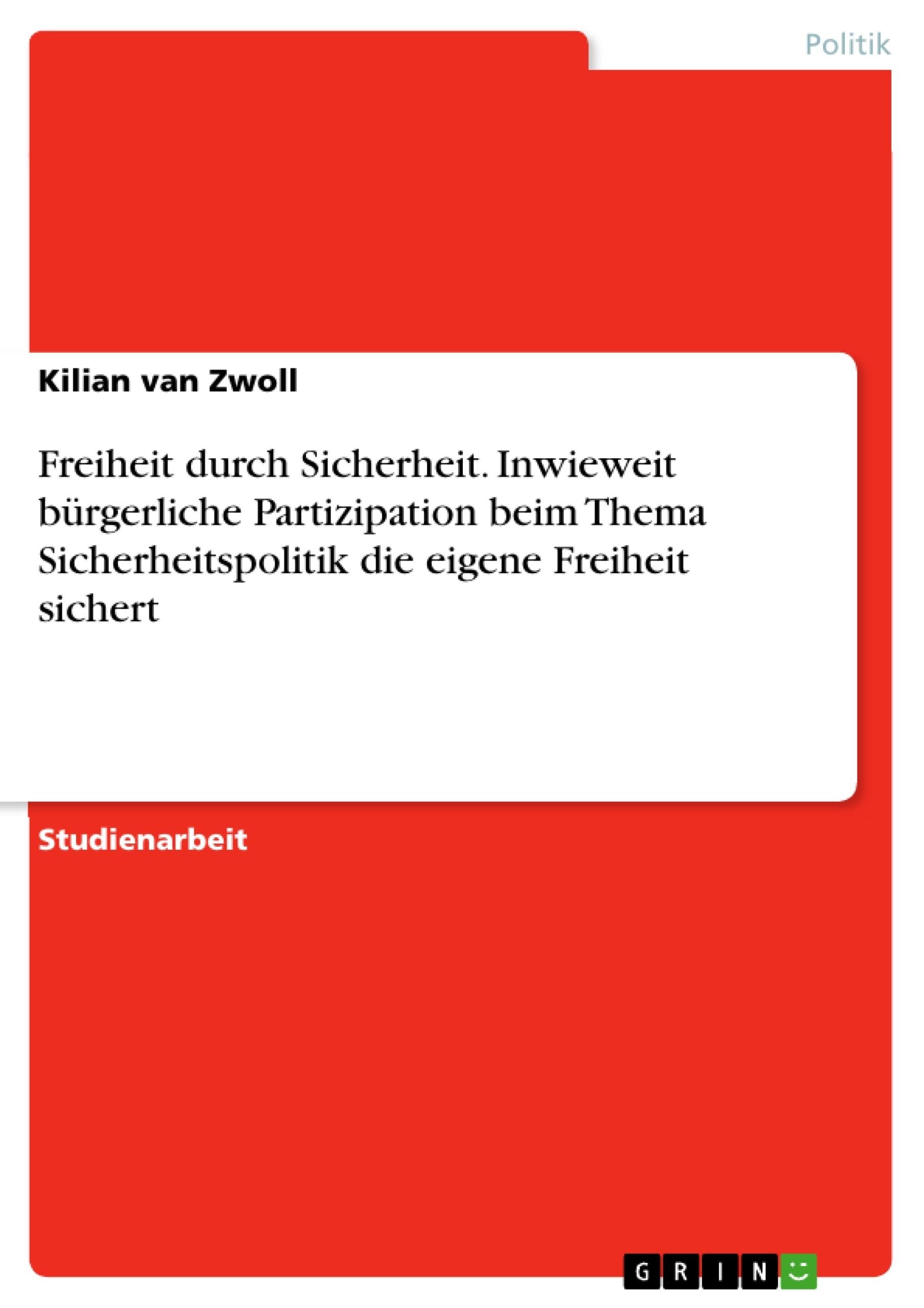
-

-

-
Laden Sie Ihre eigenen Arbeiten hoch! Geld verdienen und iPhone X gewinnen. -

-
Laden Sie Ihre eigenen Arbeiten hoch! Geld verdienen und iPhone X gewinnen. -

-
Laden Sie Ihre eigenen Arbeiten hoch! Geld verdienen und iPhone X gewinnen. -

-
Laden Sie Ihre eigenen Arbeiten hoch! Geld verdienen und iPhone X gewinnen. -

-
Laden Sie Ihre eigenen Arbeiten hoch! Geld verdienen und iPhone X gewinnen. -

-
Laden Sie Ihre eigenen Arbeiten hoch! Geld verdienen und iPhone X gewinnen. -

-
Laden Sie Ihre eigenen Arbeiten hoch! Geld verdienen und iPhone X gewinnen. -

-
Laden Sie Ihre eigenen Arbeiten hoch! Geld verdienen und iPhone X gewinnen.