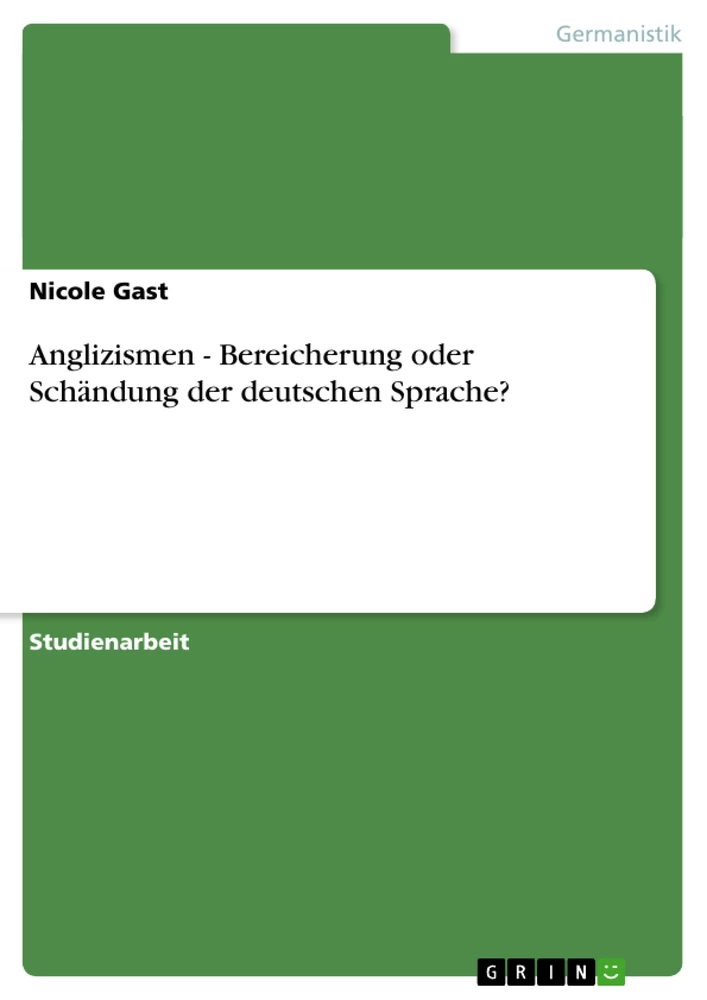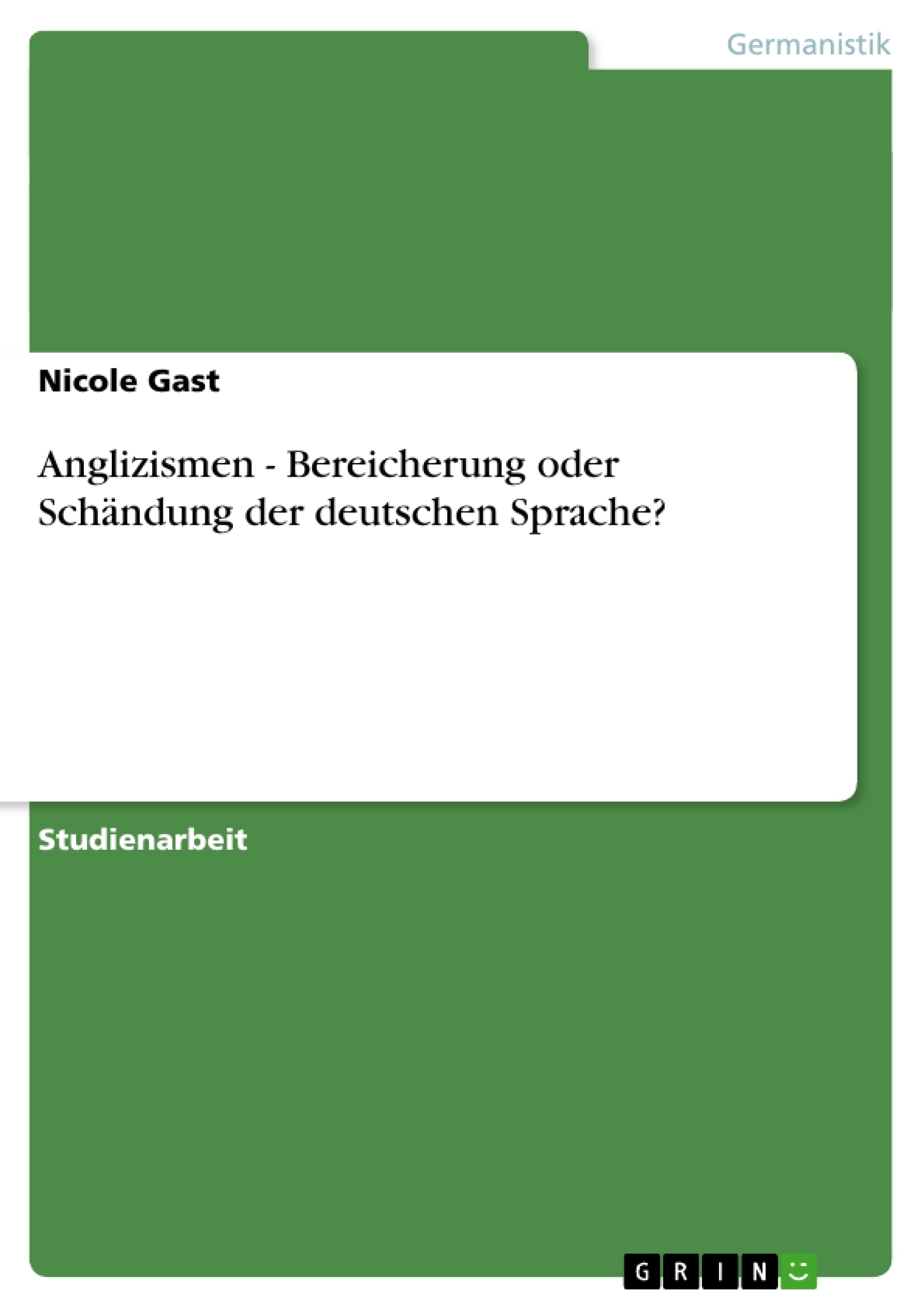Ursprünglich hatten alle Menschen die gleiche Sprache und waren ein Volk. Als sie auf die Idee kamen, einen Turm zu bauen, der bis zum Himmel reicht, um sich damit einen Namen zu machen, griff Gott ein, denn er sah, dass den Menschen nun nichts mehr unmöglich war. Er verwirrte die Sprache und zerstörte damit jede Verständigungsmöglichkeit. Das eine Volk zerfiel wie seine Sprache und der Turm blieb eine Ruine. Derart pluralisiert, verbreiteten sich die Völker und Sprachen über die Erde. Die elf Apostel saßen in Jerusalem zusammen, als plötzlich ein Brausen vom Himmel das Haus erfüllte und Feuerzungen erschienen, die sich auf sie verteilten. Der Heilige Geist, der sie dieserweise erfüllte, hieß sie nun, in fremden Sprachen zu sprechen. Und so kam es, dass alle Menschen in der Vielvölkerstadt zu ihrem größten Erstaunen die Apostel, die doch nur einfache Galiläer waren, in ihrer je eigenen Muttersprache (idia dialekto) reden hörten. Das sind die beiden kommunikativen Urszenen, die uns die Bibel vor Augen führt : der Turmbau zu Babel ( Genesis 11, 1-9) und das Pfingstwunder ( Apostelgeschichte 2, 1 - 13). Heute scheint die Wirklichkeit die theologische Vorstellung eingeholt zu haben - und zwar beide Urszenen zugleich.
Über die Gesamtzahl der heute auf der Erde gesprochenen Sprachen herrscht keine Einigkeit. Die meisten Nachschlagewerke nennen eine Zahl zwischen 4000 und 5000, doch andere Schätzungen schwanken zwischen 3000 und 10 000. Ein Grund für diese schwankenden Zahlen besteht darin, dass in unerforschten Gebieten der Erde selbst heute noch neue Völker und damit neue Sprachen entdeckt werden. Sprachenvielfalt ist also nichts Neues. Sie besteht seit Jahrtausenden und jedes Volk unternahm gezielte Bemühungen seine Sprache von fremdsprachlichen Einflüssen freizuhalten. Diese puristischen Bestrebungen sollten dem Sprachzerfall bzw. der “Muttersprachzertrümmerung“ Einhalt gebieten und zielten in erster Linie darauf ab, Ausdrücke fremder Herkunft durch spracheigene Ausdrücke zu ersetzen.
Doch trotz intensiver Bemühungen war diese Aufgabe nicht zu erfüllen. Schon immer mischten sich fremdartige Ausdrücke in das Vokabular einer Sprache, die von ihren Sprechern genutzt wurden ohne dass sie vorher übersetzt wurden. Und auch die deutsche Sprache konnte sich vor der Invasion fremder (insbesondere englischer) Vokabeln und Redewendungen nicht ewig schützen. Und exakt dieses Thema behandelt diese Arbeit. [...]
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Anglizismen
- Geschichte der englischen Sprache
- Englischer Spracheinfluss vom Mittelalter bis 1945
- Englischer Spracheinfluss von 1945 bis heute
- Integration von Anglizismen
- Anglizismen in modernen Werbe- und Medientexten
- Chat Kommunikation
- Beispiele von Anglizismenbildung und -verwendung im täglichen Sprachgebrauch
- Analyse von Einzelentlehnungen
- Beispiele für Problemfälle
- Pluralbildungen
- Redewendungen
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Bedeutung und den Einfluss von Anglizismen auf die deutsche Sprache. Sie analysiert die Geschichte des englischen Spracheinflusses auf das Deutsche, beleuchtet die Integration von Anglizismen in den heutigen Sprachgebrauch und erörtert die Frage, ob Anglizismen eine Bereicherung oder eine Bedrohung für die deutsche Sprache darstellen.
- Die Geschichte des englischen Spracheinflusses auf die deutsche Sprache
- Die Integration von Anglizismen in den heutigen Sprachgebrauch
- Die Auswirkungen von Anglizismen auf die deutsche Sprache
- Die Rolle der Globalisierung in Bezug auf die Verbreitung von Anglizismen
- Beispiele für Anglizismen in verschiedenen Bereichen der Sprache
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung beleuchtet die historische Entwicklung des Sprachwandels und die Bedeutung von Fremdsprachen im Kontext der Sprachentwicklung. Das Kapitel über Anglizismen befasst sich mit der Geschichte der englischen Sprache und analysiert den Einfluss des Englischen auf die deutsche Sprache in verschiedenen Epochen. Es behandelt die Integration von Anglizismen in den deutschen Sprachgebrauch und beleuchtet verschiedene Aspekte der Anglizismenbildung. Das Kapitel über Anglizismen in modernen Werbe- und Medientexten untersucht den Einfluss von Anglizismen in der modernen Kommunikation, insbesondere im Bereich des Internets und der Online-Kommunikation. Abschließend werden konkrete Beispiele für Anglizismen und deren Verwendung im täglichen Sprachgebrauch vorgestellt.
Schlüsselwörter
Anglizismen, englischer Spracheinfluss, deutsche Sprache, Sprachentwicklung, Globalisierung, Mediensprache, Werbung, Sprachwandel, Fremdsprachen, Lexik, Semantik, Syntax, Integration, Lexikographie.
Häufig gestellte Fragen
Sind Anglizismen eine Bereicherung oder eine Gefahr für das Deutsche?
Die Arbeit analysiert beide Sichtweisen: Während Kritiker eine „Muttersprachzertrümmerung“ befürchten, sehen andere in Anglizismen eine notwendige Anpassung an die globale Kommunikation und moderne Lebenswelten.
Seit wann hat die englische Sprache Einfluss auf das Deutsche?
Ein gewisser Einfluss besteht bereits seit dem Mittelalter, nahm jedoch nach 1945 massiv zu und erreichte durch die Digitalisierung und Globalisierung seinen heutigen Höhepunkt.
In welchen Bereichen werden Anglizismen besonders häufig genutzt?
Besonders präsent sind sie in der Werbung, den Medien, der IT-Branche sowie in der täglichen Chat-Kommunikation und Jugendsprache.
Wie werden englische Begriffe in die deutsche Grammatik integriert?
Die Arbeit untersucht Phänomene wie die Pluralbildung bei Lehnwörtern, die Konjugation englischer Verben nach deutschen Regeln und die Verwendung in Redewendungen.
Was sind typische Problemfälle bei der Verwendung von Anglizismen?
Dazu gehören „Denglisch“-Formen, bei denen englische Wörter falsch verwendet werden oder die Verständlichkeit für Sprecher ohne Englischkenntnisse verloren geht.
- Quote paper
- M.A. Nicole Gast (Author), 2002, Anglizismen - Bereicherung oder Schändung der deutschen Sprache?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/49812