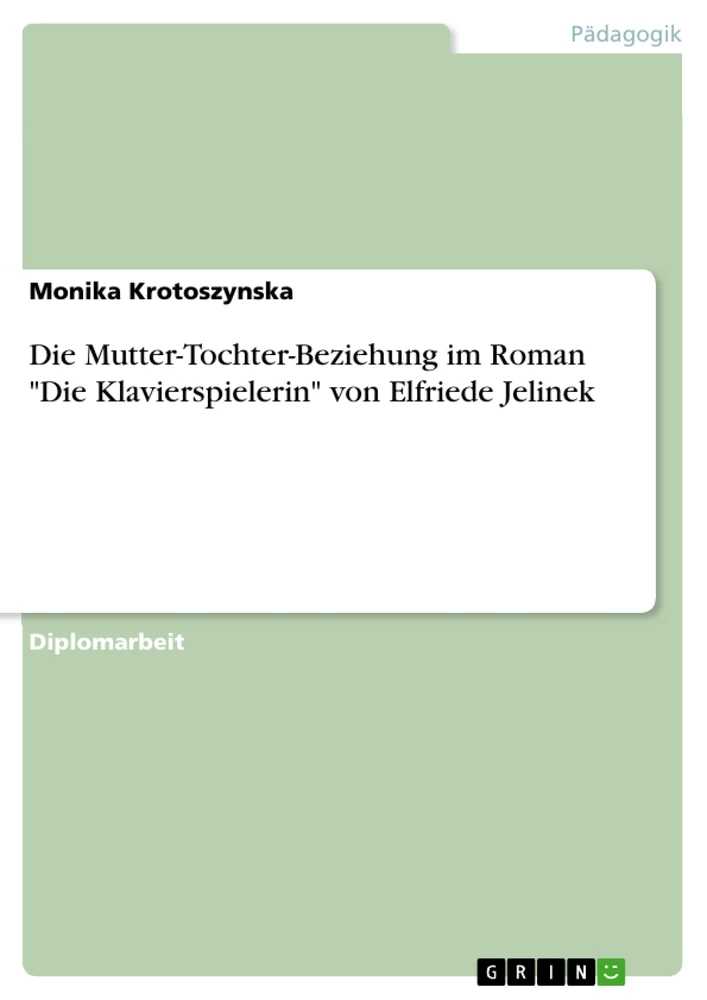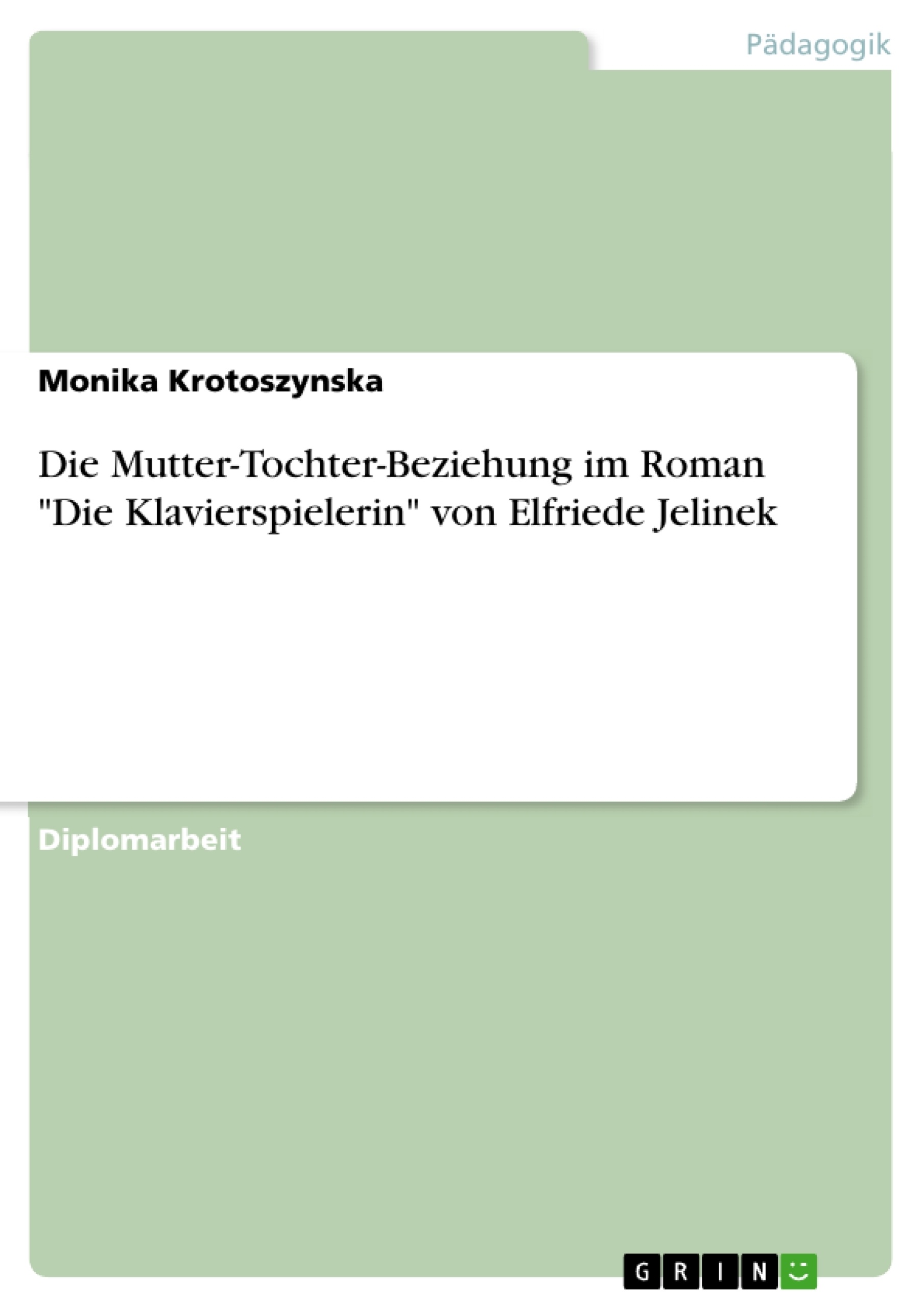In dieser Arbeit analysiert der Autor die Mutter-Tochter-Beziehung im Roman „Die Klavierspielerin“ von Elfriede Jelinek. Zunächst gibt der Autor Einblick in die Biographie von Elfriede Jelinek. Anschließend wird die Entwicklung der Rolle und Position der Frau in der Gesellschaft untersucht. Danach erläutert der Autor die Rolle von Mutter und Tochter und geht abschließend auf die Beziehung der Mutter und Tochter im Roman ein.
Es unterliegt keinem Zweifel, dass die Mutter-Tochter-Beziehung oft problematisch sein kann. Die Mütter wollen perfekt sein. Dieser Perfektionismus kann jedoch irreführend sein, weil es sehr oft passiert, dass sich die Töchter dadurch nie losgelassen und überbehütet fühlen. Auch in der Literatur ist das Thema Mutter-Tochter-Beziehung nach wie vor aktuell und es entstehen neue Werke, die sich mit diesem Problem auseinandersetzen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- 1. Elfriede Jelinek – Leben und Werk
- 1.1 Lebensweise
- 1.2 Werk
- 1.3,,Klavierspielerin\"- biographische Hintergründe
- 2. Das Frauenbild- feministische und psychologische Konzepte
- 2.1 Mutter
- 2.2 Tochter
- 3. Mutter und Tochter zwischen Macht und Symbiose
- 3.1 Erziehung zu Hause
- 3.2 Erikas Außenwelt
- 3.3 Dominanz der Mutter
- 3.4 Erika und Walter Klemmer
- 4. Zusammenfassung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Darstellung der Mutter-Tochter-Beziehung in Elfriede Jelineks Roman „Die Klavierspielerin“. Sie verfolgt das Ziel, die komplexe Dynamik dieser Beziehung im Kontext der feministischen und psychologischen Konzepte des Frauenbilds zu analysieren.
- Das Frauenbild in der Literatur
- Machtverhältnisse zwischen Mutter und Tochter
- Die Rolle der Erziehung in der Entwicklung der Figuren
- Die Bedeutung von sozialen Normen und Klischees
- Die Auswirkungen von Unterdrückung und Dominanz
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in die Thematik der Mutter-Tochter-Beziehung ein und erläutert die Relevanz des Romans „Die Klavierspielerin“ für die Untersuchung.
Das erste Kapitel gibt Einblick in das Leben und Werk von Elfriede Jelinek. Es skizziert ihre Biografie, ihre musikalischen Wurzeln und die Entwicklung ihrer literarischen Karriere.
Das zweite Kapitel beschäftigt sich mit feministischen und psychologischen Konzepten, die das Frauenbild beleuchten. Es untersucht die Rollen und Erwartungen, die an Frauen in der Gesellschaft gestellt werden.
Das dritte Kapitel analysiert die Beziehung zwischen Mutter und Tochter im Roman „Die Klavierspielerin“. Es beleuchtet die Erziehung, die Dominanz der Mutter und die Herausforderungen, denen Erika in ihrer Außenwelt begegnet.
Schlüsselwörter
Die wichtigsten Schlüsselwörter sind Mutter-Tochter-Beziehung, Feminismus, Psychoanalyse, Frauenbild, Literaturanalyse, Elfriede Jelinek, „Die Klavierspielerin“, Dominanz, Unterdrückung, soziale Normen, Erziehung.
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Hauptthema des Romans „Die Klavierspielerin“?
Der Roman thematisiert die zerstörerische, symbiotische und von Macht geprägte Mutter-Tochter-Beziehung zwischen Erika Kohut und ihrer Mutter.
Welche Rolle spielt die Mutter in Erikas Leben?
Die Mutter dominiert Erika durch einen extremen Perfektionismus und Überbehütung, was Erika daran hindert, eine eigene Identität und Sexualität zu entwickeln.
Gibt es biographische Hintergründe bei Elfriede Jelinek?
Ja, die Arbeit beleuchtet die Parallelen zwischen Erikas Erziehung zur Musikerin und Jelineks eigener Biographie und musikalischen Ausbildung.
Wie wird das Frauenbild im Roman dargestellt?
Jelinek dekonstruiert klischeehafte Rollenbilder und zeigt die Auswirkungen von Unterdrückung, Dominanz und gesellschaftlichen Normen auf die weibliche Psyche.
Welche Bedeutung hat die Figur Walter Klemmer?
Walter Klemmer stellt den Versuch Erikas dar, aus der mütterlichen Symbiose auszubrechen, was jedoch in Gewalt und einem Scheitern der Kommunikation endet.
- Quote paper
- Monika Krotoszynska (Author), 2018, Die Mutter-Tochter-Beziehung im Roman "Die Klavierspielerin" von Elfriede Jelinek, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/499096