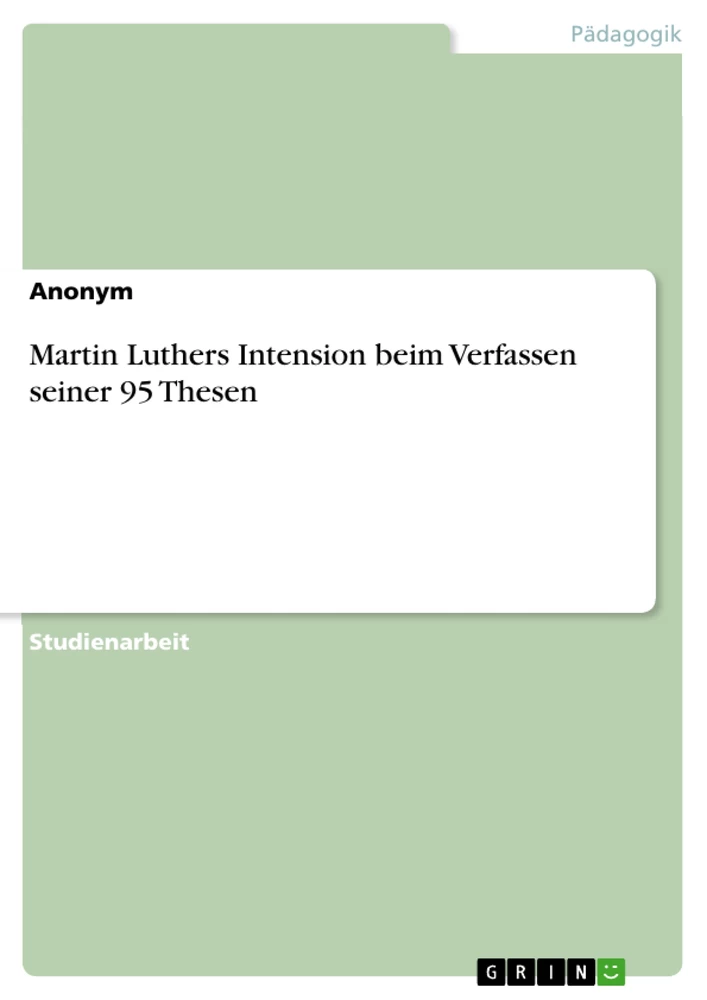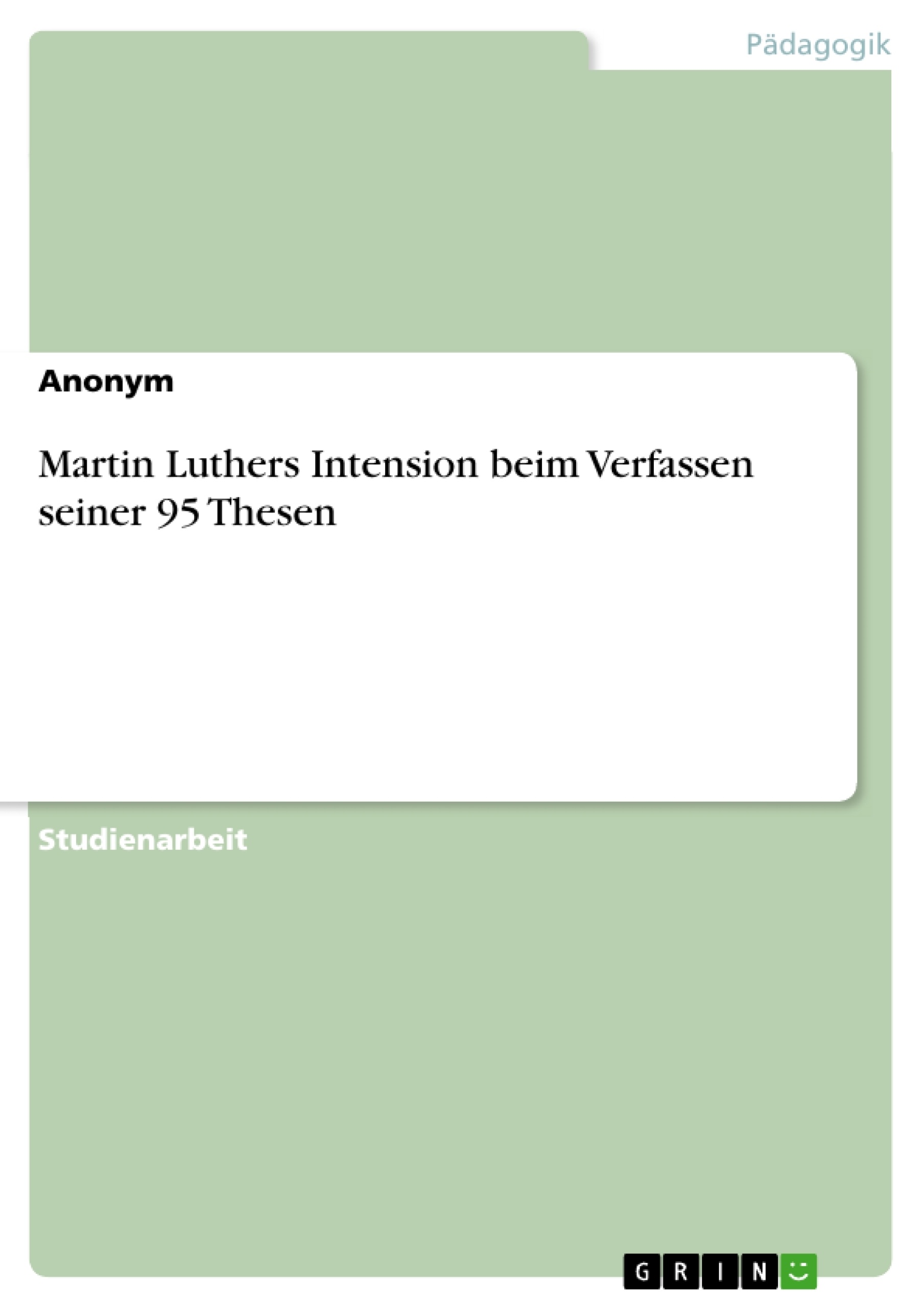In der folgenden Ausarbeitung wird das Leben Martin Luthers behandelt. Es wird die Frage gestellt, welche Intension Luther beim Verfassen seiner berühmten 95 Thesen hatte und welche Folgen sich aus seinem Handeln ergaben. Zunächst wird Luthers Biografie betrachtet. Wer war der Mensch Martin Luther?
Es wird der Weg zu Luthers 95 Thesen aufgezeigt. Was schrieb er? Was kritisierte er? Warum hat er sich zum Handeln entschieden? Wie war die Reaktion der Gesellschaft? Zum Schluss wird erörtert, wie sich Luthers Handeln auf seine und auf unsere heutige Zeit auswirkt.
500 Jahre Reformation. Damit verbunden ist der Name Martin Luther. Ohne Martin Luther keine evangelische Kirche. Ohne Martin Luther keinen getrennten Religionsunterricht. Ohne Martin Luther keine Bibelübersetzung ins deutsche. Ohne Martin Luther keine Reformation.
Luther gehört zu den am häufigsten abgebildeten Personen der deutschen Geschichte. Playmobil hat über 1 Million Martin Luther Figuren verkauft. Die Geschichte eines Rebellen. Der Name Martin Luther ist jedem Kind ein Begriff. Er und seine Geschichte ist ein zentraler Punkt im Religionsunterricht, sowohl katholisch als auch evangelisch.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Biografie Martin Luthers
- 2.1 Der junge Martin Luther 1483 - 1505
- 2.2 Mönch und Professor 1505 - 1517
- 2.3 Das Leben auf der Wartburg
- 2.4 Rückkehr nach Wittenberg 1522 – Tod 1546
- 3. Martin Luthers Kritik
- 3.1 Die 95 Thesen
- 3.2 Inhalte der 95 Thesen
- 4. Die Reformation
- 4.1 Beginn der Reformation
- 4.2 Folgen der Reformation heute
- 5. SCHLUSS
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Ausarbeitung befasst sich mit dem Leben Martin Luthers und analysiert seine Intention beim Verfassen der 95 Thesen sowie die Folgen seines Handelns. Die Arbeit beleuchtet die Biografie Luthers, die Hintergründe seiner Kritik am Ablasshandel, die Entstehung der Reformation und den Einfluss seines Werkes auf seine Zeit und die Gegenwart.
- Martin Luthers Biografie und Werdegang
- Die Kritik am Ablasshandel und die 95 Thesen
- Die Entstehung und Ausbreitung der Reformation
- Die Folgen der Reformation für die Gesellschaft und die Kirche
- Der Einfluss Martin Luthers auf Sprache, Kultur und Religion
Zusammenfassung der Kapitel
2. Biografie Martin Luthers
Dieses Kapitel beleuchtet die wichtigsten Stationen im Leben Martin Luthers von seiner Geburt im Jahr 1483 bis zu seinem Tod 1546. Es werden seine Kindheit, sein Studium, sein Eintritt ins Kloster, seine Zeit als Professor in Wittenberg und sein Exil auf der Wartburg behandelt. Die Zusammenfassung erörtert auch Luthers Tätigkeit als Bibelübersetzer und die Entstehung der neuhochdeutschen Schriftsprache.
3. Martin Luthers Kritik
Dieses Kapitel befasst sich mit Luthers Kritik am Ablasshandel und seiner Veröffentlichung der 95 Thesen. Es analysiert die Inhalte der Thesen und die Hintergründe seiner Kritik. Die Zusammenfassung beleuchtet Luthers Standpunkt zur Rechtfertigung des Menschen vor Gott und seine Kritik an der Macht des Papstes und der katholischen Kirche.
4. Die Reformation
Dieses Kapitel behandelt den Beginn der Reformation, die durch die 95 Thesen Luthers ausgelöst wurde. Es erörtert die wichtigsten Ereignisse der Reformation, die Verbreitung der lutherischen Lehre und die Folgen für die Gesellschaft und die Kirche. Die Zusammenfassung beleuchtet auch die bleibenden Auswirkungen der Reformation auf die europäische Geschichte und die heutige Zeit.
Schlüsselwörter
Martin Luther, Reformation, 95 Thesen, Ablasshandel, Theologie, Bibelübersetzung, neuhochdeutsche Sprache, Kirche, Glaube, Gesellschaft, Geschichte, Protestantismus, Katholizismus.
Häufig gestellte Fragen
Was war Martin Luthers Hauptkritikpunkt in den 95 Thesen?
Luthers Kritik richtete sich primär gegen den Ablasshandel der katholischen Kirche, also den Verkauf von Sündenvergebung gegen Geld.
Welche Bedeutung hatte Luthers Zeit auf der Wartburg?
Während seines Exils auf der Wartburg übersetzte Luther das Neue Testament ins Deutsche, was maßgeblich zur Entstehung der neuhochdeutschen Schriftsprache beitrug.
Wie reagierte die Gesellschaft auf Luthers Handeln?
Luthers Thesen lösten eine breite gesellschaftliche und religiöse Bewegung aus, die schließlich zur Reformation und zur Spaltung der Kirche führte.
Welche Auswirkungen hat die Reformation auf die heutige Zeit?
Die Reformation führte zur Entstehung der evangelischen Kirche, beeinflusste das Bildungswesen (getrennter Religionsunterricht) und prägte die deutsche Sprache und Kultur nachhaltig.
Warum ist Martin Luther heute noch so bekannt?
Als zentrale Figur der europäischen Geschichte wird er oft als Rebell und Reformator dargestellt; seine Biografie ist fester Bestandteil des Schulunterrichts und der Popkultur.
- Quote paper
- Anonym (Author), 2018, Martin Luthers Intension beim Verfassen seiner 95 Thesen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/499302