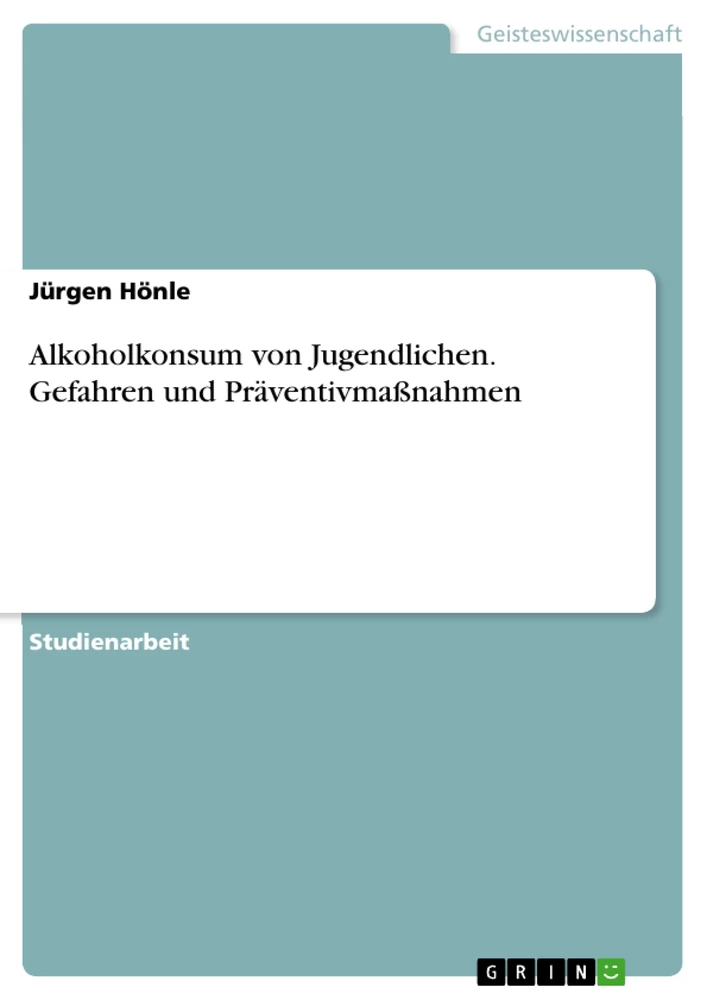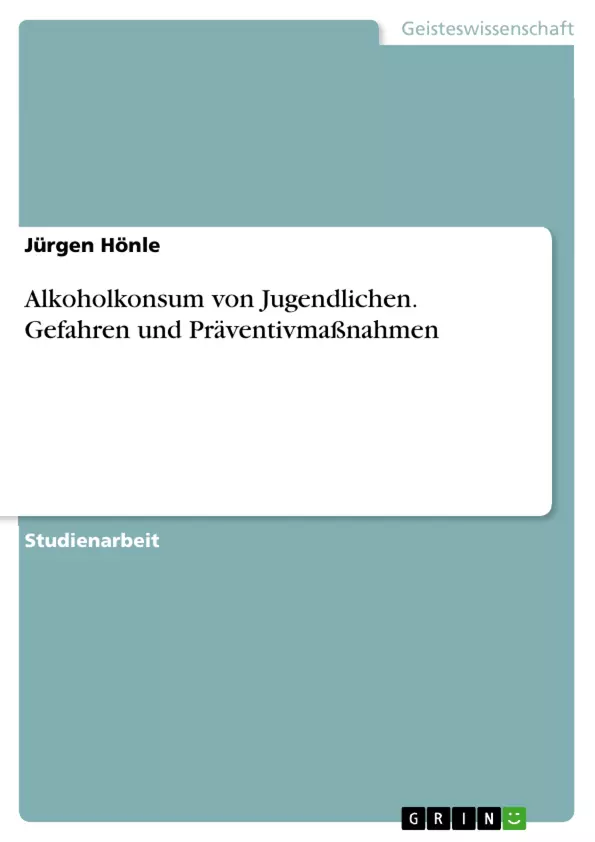Nach den Zahlen des Suchtberichts ist besonders das exzessive Rauschtrinken, also das sogenannte "Komasaufen" unter Jugendlichen immer noch weit verbreitet. Ein derartiges Trinkverhalten hat nicht nur negative Auswirkungen auf die gesundheitliche und (psycho-) soziale Entwicklung. Unter Umständen kann es auch lebensbedrohlich sein, wie die Zahl von über 23000 Kindern und Jugendlichen im Alter zwischen 10 und 20 Jahren illustriert, die 2007 aufgrund einer Alkoholvergiftung stationär behandelt werden mussten. Aber auch jüngere Berichte aus den Medien bestätigen die gravierenden Gefahren eines massiven Alkoholkonsums, der nicht selten im Krankenhaus, teilweise in der Bewusstlosigkeit oder im Einzelfall gar tödlich enden kann.
Präventive Angebote und Hilfen für die Betroffenen müssen daher auf jeden Fall fortgesetzt und ausgebaut werden. Diesbezüglich nehmen die verschiedenen Organisationen und Einrichtungen der öffentlichen und freien Jugend- bzw. Suchthilfe eine zentrale Rolle ein, da es letztlich ihnen obliegt, auf diese Problematik mit effektiven und nachhaltigen Maßnahmen adäquat zu reagieren. Vor diesem Hintergrund untersucht die vorliegende Arbeit die theoretischen Ansätze eines missbräuchlichen Alkoholkonsums und beschreibt ein mögliches methodisches Vorgehen anhand eines praktischen Beispiels.
Inhaltsverzeichnis
- 1 EINLEITUNG – DAS NEUE HOBBY „KOMASAUFEN”
- 2 ENTSTEHUNG UND AUFRECHTERHALTUNG EINES RISKANTEN KONSUMVERHALTENS
- 2.1 Verfügbarkeit und subjektive Funktionalität von Alkohol
- 2.2 Individuelle Demografie und biopsychische Disposition
- 2.3 Soziokulturelle Einflüsse und Rahmenbedingungen
- 3 DROGEN- UND SUCHTBERATUNG
- 3.1 Allgemeine Standards der Drogen- und Suchtberatung
- 3.2 Motivational Case Management als Methode der Suchtberatung
- 4 EXEMPLARISCHE ANWENDUNG DER METHODE
- 4.1 Ein Fallbeispiel aus der Praxis der Drogenberatung
- 4.2 Prozessuales Vorgehen und Falltransfer
- 4.2.1 Zugangserschließung
- 4.2.2 Assessment und Problem- bzw. Lebensweltanalyse
- 4.2.3 Zielvereinbarung und Hilfeplan
- 4.2.4 Durchführung, Vernetzung, Monitoring und Re-Assessment
- 4.2.5 Ergebnisbewertung und Beendigung
- LITERATUR
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Hausarbeit befasst sich mit dem Phänomen des riskanten Alkoholkonsums bei Jugendlichen, insbesondere dem sogenannten Komasaufen. Sie beleuchtet die Entstehung und Aufrechterhaltung dieses Verhaltens, indem sie verschiedene theoretische Ansätze und ihre kausalen Faktoren untersucht. Darüber hinaus präsentiert die Arbeit eine konkrete Fallbesprechung aus der Praxis der Drogenberatung und erläutert den Einsatz der Motivational Case Management-Methode im Rahmen der Suchtberatung.
- Ursachen und Einflussfaktoren des riskanten Alkoholkonsums bei Jugendlichen
- Die Rolle von Verfügbarkeit, subjektiver Funktionalität und individueller Demografie
- Soziokulturelle Einflüsse und Rahmenbedingungen als Determinanten des Konsumverhaltens
- Die Bedeutung von Drogen- und Suchtberatung in der Prävention und Intervention
- Die Anwendung der Motivational Case Management-Methode in der Fallarbeit
Zusammenfassung der Kapitel
Kapitel 1 widmet sich der Einführung in das Thema und beleuchtet die aktuelle Problematik des Komasaufens, wobei die Ergebnisse des Drogen- und Suchtberichts 2009 sowie die alarmierenden Zahlen zur stationären Behandlung von Alkoholvergiftungen bei Jugendlichen als Ausgangspunkt dienen.
Kapitel 2 beschäftigt sich mit der Entstehung und Aufrechterhaltung eines riskanten Konsumverhaltens. Es werden verschiedene wissenschaftliche Ansätze und deren Erklärungsmodelle beleuchtet, wobei die Bedeutung von Verfügbarkeit, subjektiver Funktionalität, individueller Demografie und soziokulturellen Einflüssen herausgestellt werden. Die These der individuellen Alkoholbilanz als entscheidender Faktor für die Konsumentscheidung wird ebenfalls diskutiert.
Kapitel 3 widmet sich der Drogen- und Suchtberatung und behandelt die allgemeinen Standards sowie die Methode des Motivational Case Management. Es wird die Bedeutung dieser Methode für die Unterstützung von Menschen mit Suchterkrankungen herausgestellt.
Kapitel 4 illustriert die exemplarische Anwendung der Motivational Case Management-Methode in der Praxis. Es präsentiert ein Fallbeispiel aus der Drogenberatung und erläutert das prozessuale Vorgehen im Detail, von der Zugangserschließung bis hin zur Ergebnisbewertung und Beendigung.
Schlüsselwörter
Riskanter Alkoholkonsum, Komasaufen, Binge-Drinking, Drogen- und Suchtberatung, Motivational Case Management, Suchtprävention, Interventionsstrategien, Verfügbarkeit, subjektive Funktionalität, Demografie, soziokulturelle Einflüsse, Fallarbeit, Prozessuales Vorgehen.
Häufig gestellte Fragen
Wie aktuell ist das Problem des "Komasaufens" bei Jugendlichen?
Laut Suchtbericht bleibt exzessives Rauschtrinken ein massives Problem; allein im Jahr 2007 mussten über 23.000 Kinder und Jugendliche wegen Alkoholvergiftungen stationär behandelt werden.
Welche Faktoren führen zu riskantem Alkoholkonsum bei Jugendlichen?
Die Arbeit untersucht die Verfügbarkeit von Alkohol, die subjektive Funktionalität (z. B. Stressbewältigung), individuelle biopsychische Dispositionen sowie soziokulturelle Einflüsse.
Was ist "Motivational Case Management" in der Suchtberatung?
Es ist eine Methode der Suchtberatung, die darauf abzielt, die Eigenmotivation der Betroffenen zu stärken und Hilfeleistungen individuell zu koordinieren.
Wie läuft ein Beratungsprozess bei Alkoholmissbrauch exemplarisch ab?
Der Prozess umfasst die Zugangserschließung, eine Lebensweltanalyse (Assessment), Zielvereinbarungen, die Durchführung der Hilfe sowie eine abschließende Ergebnisbewertung.
Welche Rolle spielen soziokulturelle Rahmenbedingungen?
Soziokulturelle Faktoren wirken als Determinanten des Konsumverhaltens, indem sie das Trinkverhalten in Peer-Groups und die gesellschaftliche Akzeptanz von Alkohol prägen.
- Quote paper
- Jürgen Hönle (Author), 2009, Alkoholkonsum von Jugendlichen. Gefahren und Präventivmaßnahmen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/499414