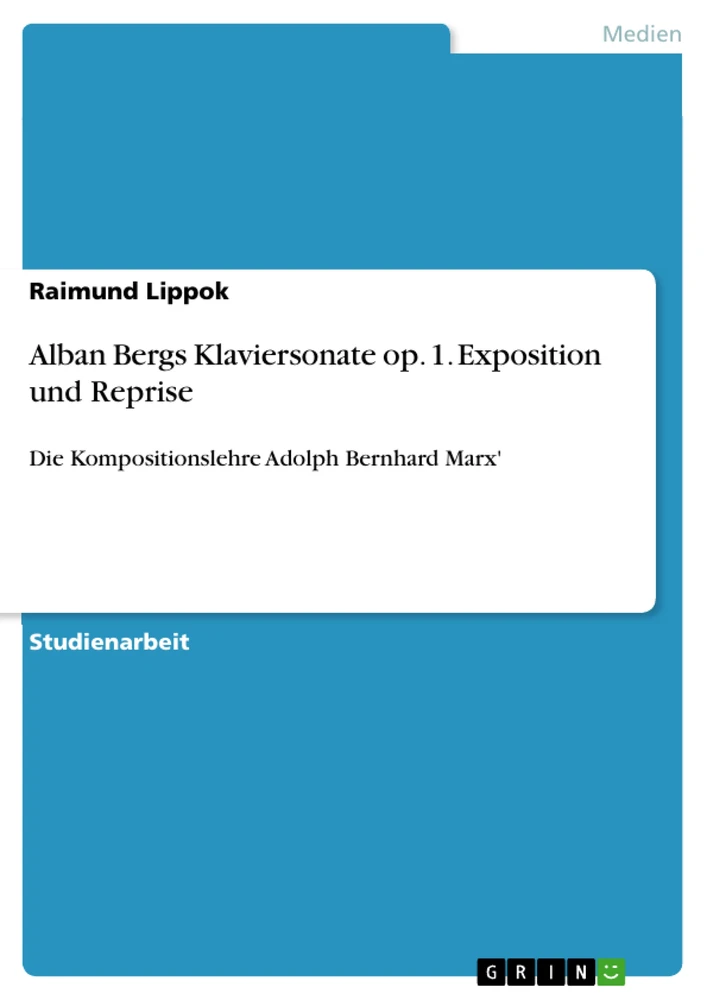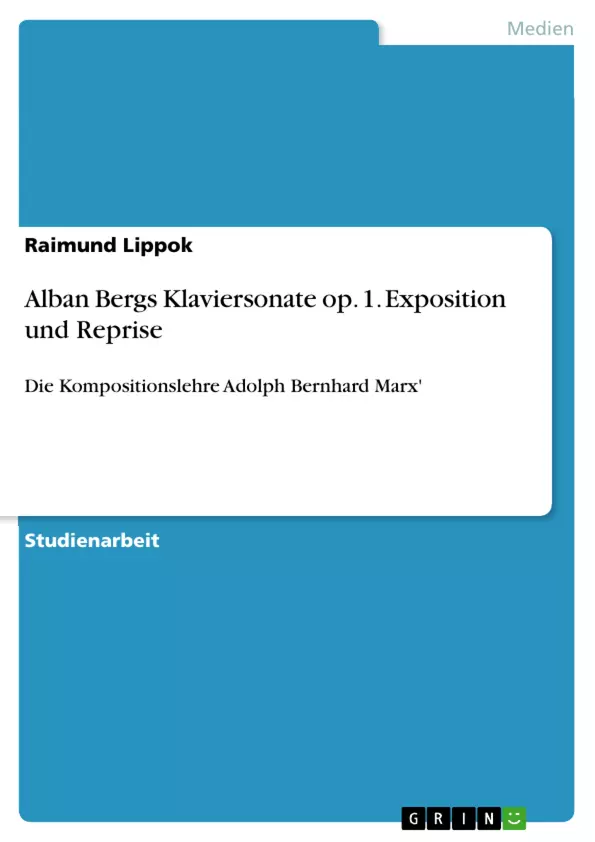Für meine Arbeit stellt sich die Frage, ob und in welcher Weise Bergs Sonate aus dem frühen 20. Jahrhunderts sich in eine klassisch-romantische Vorstellung eines Sonatensatzes einordnen lässt. Dabei ist es besonders interessant, ob die fest gefügten Elemente in "Theil 1" und "Theil 3" (Exposition und Reprise) "eingehalten" werden. Marx geht nämlich von der festen Ordnung Hauptsatz – Seitensatz – Gang – Schlusssatz aus.
Berg komponiert freitonal. Und obgleich deutliche Hinweise auf h-Moll zu finden sind, wird es schwierig werden in Marx' harmonischem Denken zu analysieren, weswegen meine Arbeit ihren Fokus auf rhythmische und melodische Aspekte richten wird. Alle Notenbeispiele, die in der Arbeit zu finden sind, seien dem Stück gemäß mit zwei Kreuzvorzeichen zu denken, sofern es nicht anders vermerkt ist.
Die Sonate für Klavier op.1 ist Alban Bergs erste und einzige Klaviersonate und besteht aus nur einem Satz. Sie ist als Gesellenstück in der Kompositionsschule Schönbergs anzusehen. Berg schrieb sie im zweiten Jahr, das er unter Schönbergs Fittichen verbrachte, nachdem er sich an einigen skizzenhaften Sonatensätzen versuchte.
Adolph Bernhard Marx war Komponist und Musiktheoretiker des frühen und mittleren 19. Jahrhunderts. In seiner Kompositionslehre systematisiert er eine Sonatenform, indem er besonders die Werke Beethovens, aber auch anderer mehr oder weniger bedeutender Komponisten, analysiert. Er kommt dabei zu einer dreiteiligen Form: Exposition, Durchführung, Reprise (keine Marxschen Termini).
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Theil 1 - Exposition
- 1.1 Hauptsatz
- 1.2 Übergang zum Seitensatz
- 1.3 Seitensatz
- 1.4 Schlusssatz
- 1.5 Rückführung zum Hauptsatz
- Theil 3 - Reprise
- 2.1 Hauptsatz
- 2.2 Seitensatz - Schlusssatz
- Fazit
- Literatur
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit analysiert Alban Bergs Sonate für Klavier op. 1 im Kontext der Kompositionslehre Adolph Bernhard Marx. Sie befasst sich mit der Frage, ob und in welcher Weise Bergs freitonale Komposition in die klassische Sonatenform des 19. Jahrhunderts einzuordnen ist. Dabei steht insbesondere die Frage im Vordergrund, ob die Elemente der Exposition und Reprise, wie sie Marx beschreibt, in Bergs Werk erkennbar sind.
- Analyse der Sonatenform in Bergs Sonate für Klavier op. 1
- Vergleich von Bergs Komposition mit Marx' Kompositionslehre
- Bedeutung von rhythmischen und melodischen Elementen in Bergs Werk
- Untersuchung der Exposition und Reprise in Bezug auf Marx' Definition
- Relevanz von Motiven und deren Gestaltung im Stück
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in die Sonate für Klavier op. 1 ein, die als Alban Bergs erste und einzige Klaviersonate gilt und als Gesellenstück im Kontext der Kompositionslehre Schönbergs entstanden ist. Die Arbeit stellt die Frage nach der Einordnung der Sonate in die klassische Sonatenform und widmet sich insbesondere der Analyse der Exposition und Reprise. Die Kapitel befassen sich mit der detaillierten Analyse des Hauptsatzes der Exposition und der darin vorkommenden Motive. Außerdem werden rhythmische und melodische Elemente untersucht, um die Einordnung in Marx' Kompositionslehre zu beleuchten.
Schlüsselwörter
Alban Berg, Sonate für Klavier op. 1, Kompositionslehre, Adolph Bernhard Marx, Exposition, Reprise, Hauptsatz, Motiv, Rhythmus, Melodie, freitonale Musik, klassische Sonatenform, erweiterte Periode, Motivverarbeitung, Intervalle, Achsendrehung.
Häufig gestellte Fragen
Folgt Alban Bergs Klaviersonate op. 1 der klassischen Sonatenform?
Die Arbeit untersucht, ob Bergs freitonales Werk die von Adolph Bernhard Marx definierten Elemente wie Hauptsatz, Seitensatz und Schlusssatz einhält.
Welche Rolle spielt Adolph Bernhard Marx für diese Analyse?
Marx systematisierte im 19. Jahrhundert die Sonatenform (Exposition, Durchführung, Reprise); seine Kriterien dienen als Vergleichsmaßstab für Bergs Komposition.
Ist Bergs Sonate op. 1 tonal oder atonal?
Das Stück wird als "freitonal" beschrieben; es gibt zwar Hinweise auf h-Moll, doch die harmonische Analyse nach klassischen Regeln ist schwierig.
Was ist das Besondere an der Struktur dieser Sonate?
Sie besteht aus nur einem Satz und entstand als "Gesellenstück" während Bergs Ausbildung bei Arnold Schönberg.
Worauf liegt der Fokus der Analyse, wenn Harmonik zweitrangig ist?
Die Analyse konzentriert sich primär auf rhythmische und melodische Aspekte sowie auf die Motivverarbeitung innerhalb der Exposition und Reprise.
- Quote paper
- Raimund Lippok (Author), 2017, Alban Bergs Klaviersonate op. 1. Exposition und Reprise, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/502389